Urteils-Kommentar zu Bundesverwaltungsgericht Urteil, 26. März 2025 - 6 C 6/23 von ra.de Redaktion
Bundesverwaltungsgericht Urteil, 26. März 2025 - 6 C 6/23
Tenor
Die Revision der Kläger gegen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 16. Juni 2023 wird zurückgewiesen.
Die Kläger tragen jeweils ein Drittel der Kosten des Revisionsverfahrens.
Tatbestand
Das Revisionsverfahren betrifft die Frage des für den Rechtsschutz gegen sogenannte schlichte Parlamentsbeschlüsse eröffneten Rechtsweges.
Die Kläger sind in der "Boycott, Divestment and Sanctions"-Bewegung (BDS-Bewegung) aktiv. Die Klägerin zu 1 ist Mitglied und Sprecherin der "Jüdisch-Palästinensischen Dialoggruppe München". Der Kläger zu 2 ist Sprecher der Gruppe "BDS-Initiative Oldenburg". Der Kläger zu 3 ist in der deutsch-palästinensischen Gruppe "Palästina spricht - Koalition für palästinensische Rechte und gegen Rassismus" aktiv. Die drei genannten Organisationen unterstützen die BDS-Kampagne.
Am 17. Mai 2019 fasste der Deutsche Bundestag auf Antrag der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen Beschluss mit dem Titel "Der BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten - Antisemitismus bekämpfen" (BT-Drs. 19/10191). Unter Gliederungspunkt I. des Beschlusses bekennt sich der Deutsche Bundestag zu seinem Versprechen, Antisemitismus in allen seinen Formen zu verurteilen und zu bekämpfen. Laut Arbeitsdefinition der Internationalen Allianz für Holocaust-Gedenken sei Antisemitismus eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken könne. Antisemitismus richte sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Darüber hinaus könne auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden werde, Ziel solcher Angriffe sein. Es gebe keine legitime Rechtfertigung für antisemitische Haltungen. Das entschiedene, unbedingte Nein zum Hass auf Jüdinnen und Juden gleich welcher Staatsangehörigkeit sei Teil der deutschen Staatsräson. Antisemitismus habe sich in seinen mörderischen Folgen als die verheerendste Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in der Geschichte unseres Landes und in ganz Europa erwiesen und sei heute noch eine Bedrohung sowohl für Menschen jüdischen Glaubens als auch für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Durch eine besondere historische Verantwortung sei Deutschland der Sicherheit Israels verpflichtet. Die Sicherheit Israels sei Teil der Staatsräson unseres Landes. Der Bundestag halte an der Zweistaatenlösung fest, wie sie der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in zahlreichen Resolutionen bekräftigt habe: einen jüdischen demokratischen Staat Israel und einen unabhängigen, demokratischen und lebensfähigen palästinensischen Staat.
Weiter wird unter I. des Beschlusses ausgeführt, dass die BDS-Bewegung seit Jahren auch in Deutschland zum Boykott gegen Israel, gegen israelische Waren und Dienstleistungen, israelische Künstler, Wissenschaftler sowie Sportler aufrufe. Der allumfassende Boykottaufruf führe in seiner Radikalität zur Brandmarkung israelischer Staatsbürger jüdischen Glaubens als Ganzes. Dies sei inakzeptabel und scharf zu verurteilen. Die Argumentationsmuster und Methoden der BDS-Bewegung seien antisemitisch. Die Aufrufe der Kampagne zum Boykott israelischer Künstler sowie Aufkleber auf israelischen Handelsgütern, die vom Kauf abhalten sollten, erinnerten zudem an die schrecklichste Phase der deutschen Geschichte. "Don't Buy"-Aufkleber der BDS-Bewegung auf israelischen Produkten weckten unweigerlich Assoziationen zu der NS-Parole "Kauft nicht bei Juden!" und entsprechenden Schmierereien an Fassaden und Schaufenstern. Der Bundestag verurteile alle antisemitischen Äußerungen und Übergriffe, die als vermeintliche Kritik an der Politik des Staates Israel formuliert würden, tatsächlich aber Ausdruck des Hasses auf jüdische Menschen und ihre Religion seien, und werde ihnen entschlossen entgegentreten.
In dem Abschnitt II. des Beschlusses begrüßt der Deutsche Bundestag, dass zahlreiche Gemeinden bereits beschlossen hätten, der BDS-Bewegung oder Gruppierungen, die die Ziele der Kampagne verfolgten, die finanzielle Unterstützung und die Vergabe von kommunalen Räumen zu verweigern. Unter dem abschließenden Gliederungspunkt III. heißt es, der Deutsche Bundestag beschließe, jeder Form des Antisemitismus schon im Entstehen in aller Konsequenz entschlossen entgegenzutreten und die BDS-Kampagne und den Aufruf zum Boykott von israelischen Waren oder Unternehmen sowie von israelischen Wissenschaftlern, Künstlern oder Sportlern zu verurteilen und Räumlichkeiten sowie Einrichtungen, die unter der Bundestagsverwaltung stehen, keinen Organisationen, die sich antisemitisch äußern oder das Existenzrecht Israels in Frage stellen, zur Verfügung zu stellen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, keine Veranstaltungen der BDS-Bewegung oder von Gruppierungen, die deren Ziele aktiv verfolgen, zu unterstützen. Der Bundestag werde seine Unterstützung für die Bundesregierung und den Beauftragten für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus sowohl in der Prävention als auch in der entschiedenen Bekämpfung von Antisemitismus und jeglichem Extremismus unvermindert fortsetzen. Er werde keine Organisationen oder Projekte finanziell fördern, die das Existenzrecht Israels in Frage stellten, zum Boykott Israels aufriefen oder die BDS-Bewegung aktiv unterstützten. Länder, Städte und Gemeinden und alle öffentlichen Akteure seien dazu aufgerufen, sich dieser Haltung anzuschließen.
Die Kläger haben vor dem Verwaltungsgericht Klage erhoben und beantragt, den Beschluss des Deutschen Bundestages vom 17. Mai 2019 in seiner Gesamtheit, hilfsweise in im Einzelnen bezeichneten Passagen, für mit ihren Grundrechten aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 Satz 1, Art. 8 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 GG sowie Art. 10 Abs. 1 und Art. 11 Abs. 1 EMRK unvereinbar und nichtig zu erklären, höchst hilfsweise festzustellen, dass der Beschluss in seiner Gesamtheit, hilfsweise in im Einzelnen bezeichneten Passagen, rechtswidrig ist, sowie der Beklagten bei Vermeidung eines vom Gericht für jede Verletzungshandlung festzusetzenden Ordnungsgelds bis zu 250 000 € zu untersagen, wörtlich oder sinngemäß über die Kläger den Inhalt des fraglichen Beschlusses - in seiner Gesamtheit, hilfsweise hinsichtlich im Einzelnen bezeichneter Passagen - zu behaupten, zu verbreiten und/oder behaupten oder verbreiten zu lassen. Zur Begründung haben sich die Kläger unter anderem darauf berufen, dass ihnen wiederholt unter Bezugnahme auf ihre Unterstützung der BDS-Kampagne Räume für Veranstaltungen versagt worden seien und sie diese gerichtlich hätten erstreiten müssen. Ferner sei es unter Berufung auf den Bundestagsbeschluss zu Beleidigungen, tätlichen Angriffen oder zu Redeverboten gekommen.
Das Verwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen. Es hat den Verwaltungsrechtsweg für eröffnet gehalten, weil es sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nicht verfassungsrechtlicher Art im Sinne des § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO handele. Die Klage sei jedoch teils unzulässig und im Übrigen - soweit die Kläger beantragt hätten, die Rechtswidrigkeit des Beschlusses hinsichtlich der dortigen Aussage festzustellen, die Argumentationsmuster und Methoden der BDS-Bewegung seien antisemitisch - nicht begründet.
Das Oberverwaltungsgericht hat die Berufung der Kläger gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts zurückgewiesen. Da die Klage eine Streitigkeit verfassungsrechtlicher Art betreffe, sei der Verwaltungsrechtsweg nicht eröffnet. Dies sei vom Oberverwaltungsgericht zu prüfen, obwohl das Verwaltungsgericht den Verwaltungsrechtsweg bejaht habe. Denn § 17a Abs. 5 GVG sei auf das Verhältnis zwischen dem Verwaltungsrechtsweg und dem Gang zu den Verfassungsgerichten nicht anwendbar. Entscheidendes Kriterium für die Abgrenzung verfassungsrechtlicher von verwaltungsrechtlichen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten sei der materielle Gehalt der Streitigkeit, das heißt die Frage, ob der geltend gemachte Anspruch in einem Rechtsverhältnis wurzele, das maßgeblich durch Verfassungsrecht geprägt sei. Dies sei dann der Fall, wenn der Rechtsstreit darauf gerichtet sei, ein Verfassungsrechtssubjekt als solches in die Pflicht zu nehmen, wenn also dessen spezifisch exklusive Rechte und Pflichten den Gegenstand des Rechtsstreits bildeten. Dagegen sei nicht - im Sinne der Formel von der sogenannten doppelten Verfassungsunmittelbarkeit - zwingend erforderlich, dass auch auf Klägerseite ein Verfassungsrechtssubjekt stehe, also ein Beteiligter, der in der Verfassung spezifisch mit eigenen Rechten und Pflichten ausgestattet worden sei.
Hieran gemessen sei der Rechtsstreit verfassungsrechtlicher Art. Der Deutsche Bundestag habe in dem angegriffenen Beschluss seine Einschätzung der BDS-Bewegung geäußert. Er sei damit als Verfassungsrechtssubjekt in Wahrnehmung seiner verfassungsrechtlichen Kompetenzen tätig geworden. Es handele sich um einen schlichten Parlamentsbeschluss, mit dem der Bundestag seine ungeschriebene, aber in seiner Stellung als durch allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche und geheime Wahl im Sinne des Art. 38 Abs. 1 GG legitimierte Volksvertretung gründende Kompetenz zur Meinungsbildung und Stellungnahme in politischen Fragen wahrgenommen habe. Parlamente hätten das Recht, grundsätzlich jede Thematik zu erörtern und ihre Ansicht in einer Resolution festzuhalten. Ob der Bundestag im konkreten Fall zum Erlass seines Beschlusses mit diesem Inhalt befugt gewesen sei oder ob er im Hinblick auf die Grundrechte der Kläger Beschränkungen unterlegen habe, sei damit eine materiell verfassungsrechtlich geprägte Frage und nicht der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle unterworfen. Es gehe weder um ein im Wesentlichen einfachgesetzlich ausgestaltetes Rechtsverhältnis noch um eine im Kern exekutive Tätigkeit des Deutschen Bundestages bzw. seiner Verwaltung oder die Beweiserhebung durch einen Untersuchungsausschuss. Der Deutsche Bundestag habe auch nicht in Wahrnehmung seiner Selbstbefassungskompetenz eine Warnung ausgesprochen, sondern in der Form eines Beschlusses seine (mehrheitliche) politische Meinung bekundet. Gegen Verwaltungshandeln zur Umsetzung des Aufrufs unter III. des Beschlusses, wie etwa die Ablehnung der Zulassung zu öffentlichen Einrichtungen, könne der von Art. 19 Abs. 4 GG gebotene Rechtsschutz im Verwaltungsrechtsweg erlangt werden.
Mit der vom Oberverwaltungsgericht zugelassenen Revision verfolgen die Kläger ihr Rechtsschutzbegehren weiter. Sie machen geltend, die erneute Prüfung der vom Verwaltungsgericht bereits bejahten Zulässigkeit des Rechtsweges sei gemäß § 17a Abs. 5 GVG ausgeschlossen. Zudem liege keine verfassungsrechtliche Streitigkeit vor. Nach der Theorie der doppelten Verfassungsunmittelbarkeit sei hierbei auf ein formelles und ein materielles Kriterium abzustellen. Da es sich bei den Klägern nicht um Verfassungsorgane oder am Verfassungsleben beteiligte Organe handele, fehle es bereits an der formellen Voraussetzung. Der Deutsche Bundestag habe mit dem angegriffenen Beschluss auch keine spezifische, nur ihm zustehende Kompetenz wahrgenommen. Entscheidend sei vielmehr, dass die Kläger eine Verletzung ihrer Grundrechte geltend machten. Der Beschluss habe materiell-faktische Wirkungen. Seine Formulierungen, insbesondere unter III., gingen über eine politische Meinungskundgabe hinaus. Die Öffentlichkeit betrachte ihn als bindend. Die Kläger würden seinetwegen von öffentlichen Einrichtungen und Finanzierungen ausgeschlossen. Genau dies sei auch intendiert. Der Bundestagsbeschluss sei aus mehreren Gründen rechtswidrig. Unter anderem enthalte er herablassende Aussagen über die BDS-Bewegung als "antisemitisch" anhand einer unbrauchbaren, unwissenschaftlichen und rechtlich nicht verbindlichen Antisemitismus-Definition.
Die Beklagte tritt der Revision entgegen und verteidigt die Entscheidung des Berufungsgerichts.
Gründe
Die Revision der Kläger ist unbegründet und deshalb zurückzuweisen (§ 144 Abs. 2 VwGO).
Das angefochtene Berufungsurteil beruht nicht auf einer Verletzung von Bundesrecht (§ 137 Abs. 1 VwGO). Das Oberverwaltungsgericht hat zu Recht geprüft, ob der Verwaltungsrechtsweg gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO eröffnet ist (1.). Es hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass die Klage eine Streitigkeit verfassungsrechtlicher Art betrifft, die nach § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO nicht in die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte fällt. Denn sie richtet sich gegen eine allgemeine politische Willensäußerung des Parlaments ohne rechtliche Verbindlichkeit in der Form eines sogenannten schlichten Parlamentsbeschlusses (2.). Da die Annahme einer verfassungsrechtlichen Streitigkeit nicht voraussetzt, dass ausschließlich Verfassungsrechtssubjekte an ihr beteiligt sind (3.), sondern lediglich erfordert, dass es in materieller Hinsicht um die spezifischen verfassungsrechtlichen Rechte und Pflichten eines obersten Staatsorgans geht (4.), ist für Rechtsschutzbegehren von Einzelpersonen gegen schlichte Parlamentsbeschlüsse der Verwaltungsrechtsweg generell nicht eröffnet (5.). Dass Rechtsschutzsuchende in diesen Fällen auf die Verfassungsbeschwerde verwiesen sind, ist mit der verfassungsrechtlichen Rechtsschutzgewährleistung vereinbar (6.).
1. Das Oberverwaltungsgericht hat sich zu Recht nicht durch § 17a Abs. 5 GVG i. V. m. § 173 Satz 1 VwGO an der Prüfung gehindert gesehen, ob der Verwaltungsrechtsweg gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO eröffnet ist. Zwar prüft das Gericht, das über ein Rechtsmittel gegen eine Entscheidung in der Hauptsache entscheidet, nach § 17a Abs. 5 GVG nicht, ob der beschrittene Rechtsweg zulässig ist. In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist jedoch geklärt, dass die Vorschriften der §§ 17ff. GVG, die nach § 173 Satz 1 VwGO entsprechend anzuwenden sind, nicht im Verhältnis zwischen der Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit gelten (BVerwG, Beschlüsse vom 27. August 2012 - 3 PKH 5.12 - juris Rn. 14 und vom 24. Mai 2024 - 5 BN 2.23 - juris Rn. 12). Ob die Prüfungssperre des § 17a Abs. 5 GVG - wie die Beklagte geltend macht - hier auch deshalb nicht greift, weil das Verwaltungsgericht auf die Rüge der Beklagten nicht gemäß § 17a Abs. 3 Satz 2 GVG vorab durch Beschluss über die Zulässigkeit des Rechtsweges entschieden hat, kann deshalb offenbleiben.
2. Bei dem von den Klägern angegriffenen Beschluss des Deutschen Bundestages vom 17. Mai 2019 mit dem Titel "Der BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten - Antisemitismus bekämpfen" (BT-Drs. 19/10191) handelt es sich um einen sogenannten schlichten Parlamentsbeschluss. Denn er ist weder im Gesetzgebungsverfahren ergangen noch betrifft er innerparlamentarische Rechtsverhältnisse. Vielmehr hat er eine allgemeine politische Willensäußerung des Parlaments zum Inhalt, der keine rechtliche Verbindlichkeit zukommt (vgl. zu diesen Merkmalen schlichter Parlamentsbeschlüsse: Achterberg, Parlamentsrecht, 1984, S. 738; Müller-Terpitz, in: Kahl/Waldhoff/Walter
Hinsichtlich der Ausführungen unter I. des angegriffenen Beschlusses besteht kein Zweifel, dass es sich um eine von der Parlamentsmehrheit getragene politische Bewertung der BDS-Bewegung handelt. Dies betrifft insbesondere die zentralen Aussagen mit dem Inhalt, dass der gegen Israel, gegen israelische Waren und Dienstleistungen, israelische Künstler, Wissenschaftler sowie Sportler gerichtete Boykottaufruf der BDS-Bewegung in seiner Radikalität inakzeptabel und scharf zu verurteilen sei, sowie dass die Argumentationsmuster und Methoden der BDS-Bewegung antisemitisch seien. Die inhaltliche Kritik der Kläger einschließlich ihres Einwands, der Bundestag gehe von einer unbrauchbaren, unwissenschaftlichen und rechtlich nicht verbindlichen Antisemitismus-Definition aus, ist nicht geeignet, den Charakter des Beschlusses als politische Willensäußerung in Frage zu stellen. Soweit der Deutsche Bundestag es unter II. des Beschlusses begrüßt, dass zahlreiche Gemeinden bereits beschlossen hätten, der BDS-Bewegung oder Gruppierungen, die die Ziele der Kampagne verfolgten, die finanzielle Unterstützung und die Vergabe von kommunalen Räumen zu verweigern, geht dies ebenfalls nicht über die Bekundung eines politischen Standpunktes hinaus.
Keine andere Bewertung ergibt sich schließlich auch in Bezug auf die Ausführungen unter III. des angegriffenen Beschlusses. Entgegen der Auffassung der Kläger kommt den in den Nummern 2., 4., 5. und 6. dieses Abschnitts enthaltenen Aussagen des Bundestages kein imperativer "Anweisungscharakter" zu. Vielmehr erklärt der Bundestag darin lediglich seine Absicht, Räumlichkeiten und Einrichtungen, die unter Bundestagsverwaltung stehen, keinen Organisationen zur Verfügung zu stellen, die sich antisemitisch äußern oder das Existenzrecht Israels in Frage stellen, und fordert die Bundesregierung auf, keine Veranstaltungen der BDS-Bewegung oder von Gruppierungen, die deren Ziele aktiv verfolgen, zu unterstützen (Nr. 2.). Ferner bekundet der Bundestag seinen Willen, keine Organisationen finanziell zu fördern, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen (Nr. 4), sowie keine Projekte finanziell zu fördern, die zum Boykott Israels aufrufen oder die die BDS-Bewegung aktiv unterstützen (Nr. 5.). Schließlich werden Länder, Städte und Gemeinden und "alle öffentlichen Akteurinnen und Akteure" dazu aufgerufen, sich dieser Haltung anzuschließen (Nr. 6). Keine dieser Aussagen rechtfertigt die Annahme, dass der Deutsche Bundestag über die Kundgabe eines politischen Standpunktes hinaus das Ziel verfolgt hat, ohne Gesetzgebungsverfahren eine für die angesprochenen Stellen verbindliche Regelung zu treffen.
3. Nach § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO ist der Verwaltungsrechtsweg grundsätzlich - vorbehaltlich gesetzlicher Sonderzuweisungen - in allen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art gegeben. Wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, setzt die Annahme einer der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte entzogenen verfassungsrechtlichen Streitigkeit nicht voraus, dass ausschließlich Verfassungsrechtssubjekte beteiligt sind. Vielmehr kommt es allein auf den materiellen Gehalt der Streitigkeit an.
Die Auffassung der Revision, verfassungsrechtliche Streitigkeiten setzten eine sogenannte doppelte Verfassungsunmittelbarkeit voraus, erforderten also, dass nicht nur der Streitgegenstand, sondern auch die Beteiligten des Rechtsstreits dem Verfassungsrecht zuzuordnen seien, kann sich nicht auf aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung stützen. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar einerseits für Klagen des Bürgers gegen den Staat wegen Verletzung seiner subjektiv-öffentlichen Rechte nach § 40 Abs. 1 VwGO den Verwaltungsrechtsweg grundsätzlich auch dann für eröffnet gehalten, wenn diese Rechte von einem Verfassungsorgan verletzt worden seien (BVerfG, Kammerbeschluss vom 14. Oktober 1987 - 2 BvR 64/87 - NVwZ 1988, 817). Es hat jedoch andererseits hervorgehoben, dass die Rechtslage hinsichtlich der gerichtlichen Überprüfbarkeit von "schlichten" Parlamentsbeschlüssen, die gerade auch hier in Rede steht, nicht geklärt sei, und insoweit auf den vorrangig in Anspruch zu nehmenden fachgerichtlichen Rechtsschutz verwiesen (BVerfG, Kammerbeschluss vom 28. August 1992 - 1 BvR 632/92 - NVwZ 1993, 357 f.). Das Bundesverwaltungsgericht ist zwar in älteren Entscheidungen noch davon ausgegangen, dass zu den von der Rechtswegzuweisung des § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO ausgenommenen verfassungsrechtlichen Streitigkeiten nur solche Prozesse gehörten, die die Rechtsbeziehungen von Verfassungsorganen oder am Verfassungsleben beteiligten Organen zueinander beträfen, nicht hingegen Streitigkeiten zwischen Bürger und Staat, selbst wenn ein Verfassungsorgan daran beteiligt sei (BVerwG, Urteile vom 28. Oktober 1970 - 6 C 55.68 - BVerwGE 36, 218 <228>, vom 28. November 1975 - 7 C 53.73 - NJW 1976, 637 und vom 2. Juli 1976 - 7 C 71.75 - BVerwGE 51, 69 <71>). Allerdings hat das Bundesverwaltungsgericht bereits damals darauf hingewiesen, es lasse sich nicht ausschließen, dass dieser gleichsam allgemeine Begriff der verfassungsrechtlichen Streitigkeiten für besondere Materien ausnahmsweise der Modifizierung bedürfe (BVerwG, Urteil vom 2. Juli 1976 - 7 C 71.75 - BVerwGE 51, 69<71>). In seiner jüngeren Rechtsprechung hat das Bundesverwaltungsgericht schließlich nur noch auf den materiellen Gehalt der Streitigkeit abgestellt. Eine verfassungsrechtliche Streitigkeit liegt danach vor, wenn das streitige Rechtsverhältnis entscheidend vom Verfassungsrecht geformt ist (BVerwG, Urteil vom 27. Februar 2019 - 6 C 1.18 - BVerwGE 164, 368 Rn. 13 m. w. N.).
An der ausschließlichen Maßgeblichkeit des materiellen Kriteriums für die Abgrenzung zwischen verwaltungsrechtlichen und verfassungsrechtlichen Streitigkeiten hält der Senat fest (ebenso z. B. Ehlers/Schneider, in: Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, Stand August 2024, § 40 VwGO Rn. 138 ff.; Ruthig, in: Kopp/Schenke, VwGO, 30. Aufl. 2024, § 40 Rn. 32; Wöckel, in: Eyermann, VwGO, 16. Aufl. 2022, § 40 Rn. 21, 27; Sodan, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 5. Aufl. 2018, § 40 Rn. 195; Haack, in: Gärditz
4. Für die Auslegung des § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO entscheidend ist nach alledem der Sinn und Zweck des Ausschlusses des Verwaltungsrechtsweges für verfassungsrechtliche Streitigkeiten. Das Handeln und die Willensbildung oberster Staatsorgane in Wahrnehmung ihrer spezifischen verfassungsrechtlichen Rechte und Pflichten soll keiner fachgerichtlichen, sondern ausschließlich der verfassungsgerichtlichen Kontrolle unterliegen (vgl. Ehlers/Schneider, in: Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, Stand August 2024, § 40 VwGO Rn. 140, 150; Unruh, in: Fehling/Kastner/Störmer
Dass § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO dieses Regelungsziel zugrunde liegt, folgt aus der Entscheidung des Grundgesetzes für die Einführung einer eigenständigen Verfassungsgerichtsbarkeit mit dem Bundesverfassungsgericht als einem allen übrigen Verfassungsorganen gegenüber selbständigen und unabhängigen Gerichtshof des Bundes (Art. 93 Abs. 1 GG). Bereits vor der seit dem 28. Dezember 2024 geltenden Neufassung wurde Art. 93 GG insoweit als Grundsatznorm verstanden (vgl. Voßkuhle, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 93 Rn. 1; Walter, in: Dürig/Herzog/Scholz
Das einfachgesetzliche Verwaltungsprozessrecht würde diese verfassungsrechtliche Grundsatzentscheidung für ein auf die Wahrung der spezifischen Rechte und Pflichten der Staatsorgane und anderen Verfassungsrechtssubjekten bezogenes Kontrollmonopol des Bundesverfassungsgerichts unterlaufen, wenn es die Zuständigkeit für diesen verfassungsrechtlichen Kernbereich den Verwaltungsgerichten übertragen würde. Dies gilt unabhängig von der Person und den subjektiven Rechten desjenigen, der im konkreten Fall um Rechtsschutz nachsucht. Denn hätten die Verwaltungsgerichte auf Antrag einzelner Betroffener über die Reichweite der genuin verfassungsrechtlichen Kompetenzen oberster Staatsorgane zu entscheiden, läge hierin ein Übergriff auf den der Verfassungsgerichtsbarkeit vorbehaltenen Zuständigkeitsbereich.
Aus den dargelegten teleologischen Erwägungen folgt zugleich, dass das streitige Rechtsverhältnis nicht bereits dann - wie es das Bundesverwaltungsgericht für den Ausschluss des Verwaltungsrechtsweges nach § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO fordert - entscheidend vom Verfassungsrecht geformt ist, wenn seine Beurteilung nicht unerheblich von verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten abhängt (BVerwG, Urteil vom 11. Juli 1985 - 7 C 64.83 - NJW 1985, 2344). Insbesondere ist eine Streitigkeit nicht allein deshalb verfassungsrechtlicher Art, weil ein gegen ein Verfassungsrechtssubjekt gerichtetes Rechtsschutzbegehren auf Grundrechte gestützt wird. Da diese nach Art. 1 Abs. 3 GG sämtliche Hoheitsträger binden, geht das Grundgesetz insoweit von dem Regelfall der fachgerichtlichen Kontrolle aus.
Andererseits schließt die Berufung auf Grundrechte den verfassungsrechtlichen Charakter einer Streitigkeit auch nicht zwingend aus. Maßgeblich ist vielmehr, ob es im Kern des Rechtsstreits um das staatsorganisationsrechtliche Können, Dürfen oder Müssen eines Verfassungsrechtssubjekts als solches, das heißt gerade um dessen besondere verfassungsrechtliche Funktionen und Kompetenzen geht (vgl. Ehlers/Schneider, in: Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, Stand August 2024, § 40 VwGO Rn. 151; Sodan, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 5. Aufl. 2018, § 40 Rn. 215 f.; Unruh, in: Fehling/Kastner/Störmer
5. Nach den dargelegten Maßstäben handelt es sich bei Rechtsschutzbegehren von Einzelpersonen gegen schlichte Parlamentsbeschlüsse, das heißt allgemeine politische Willensäußerungen des Deutschen Bundestages bzw. eines Landesparlaments ohne rechtliche Verbindlichkeit, generell um Streitigkeiten verfassungsrechtlicher Art, für die nach § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO der Verwaltungsrechtsweg nicht eröffnet ist. Denn das Parlament nimmt insoweit eine ihm durch die Verfassung spezifisch zugewiesene Funktion wahr.
Anders als einige Landesverfassungen, die das Parlament - den jeweiligen Landtag - beispielsweise auch als "Stätte der politischen Willensbildung" (Art. 39 Abs. 2 Alt. 3 der Verfassung des Freistaates Sachsen; Art. 55 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung des Landes Brandenburg; Art. 20 Abs. 1 Satz 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern) oder "öffentliches Forum für die öffentliche Willensbildung" (Art. 30 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in der seit 2016 geltenden Fassung) bezeichnen und damit dessen Recht hervorheben, Grundsätze und Leitlinien der Landespolitik auf der Basis eines breiten Meinungsspektrums vor der Öffentlichkeit zu diskutieren und zu bewerten (vgl. Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen, Urteil vom 23. April 2008 - Vf. 87-I-06 - NVwZ-RR 2008, 585 <590>), enthält das Grundgesetz für die Ebene des Bundes zwar keine vergleichbare ausdrückliche Regelung. Dass auch der Deutsche Bundestag eine entsprechende Funktion der öffentlichen Willensbildung wahrnimmt, folgt jedoch aus seiner Stellung im Verfassungsgefüge. Denn als nach Art. 38 Abs. 1 GG unmittelbar gewählte Volksvertretung ist er zentrales Organ der repräsentativen Demokratie (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG) und Verkörperung der Volkssouveränität (Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG). Als solchem kommt ihm die Aufgabe zu, das Volk nicht nur formal, sondern auch inhaltlich zu repräsentieren. Dazu gehört, dass er die alle gemeinsam angehenden Fragen des Zusammenlebens in einer Weise verhandelt und entscheidet, dass der Volkswille aktualisiert wird und zur Darstellung kommt (vgl. Böckenförde, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Bd. III, 3. Aufl. 2005, § 34 Rn. 29 ff.). Dies setzt die Kompetenz voraus, ein beliebiges politisches Thema unabhängig von einem förmlichen Gesetzgebungsverfahren aufzugreifen, öffentlich zu erörtern und auf dieser Grundlage gegebenenfalls einen eigenen Standpunkt festzuhalten.
Damit erfüllen schlichte Parlamentsbeschlüsse eine grundlegend andere Funktion als etwa die Öffentlichkeitsarbeit der Regierung oder als Appelle, Warnungen und andere Äußerungen von Regierungsmitgliedern, gegen die betroffene Bürger nach Maßgabe des Prozessrechts Rechtsschutz vor den Verwaltungsgerichten erlangen können. Derartige Äußerungen von Regierungsmitgliedern gehören regelmäßig nicht zu denjenigen Betätigungen, die die Verfassung spezifisch dem Verfassungsorgan Regierung oder seinen Teilen vorbehält. Zwar gehört es in der Demokratie zur Aufgabe der Regierung, die Öffentlichkeit über wichtige Vorgänge auch außerhalb oder im Vorfeld der eigenen gestaltenden politischen Tätigkeit zu unterrichten. In der verfassungsunmittelbaren Aufgabenzuweisung der Staatsleitung liegt deshalb grundsätzlich eine Ermächtigung der Regierung zum Informationshandeln (BVerfG, Beschlüsse vom 26. Juni 2002 - 1 BvR 558, 1428/91 - BVerfGE 105, 252 <268 f.> und - 1 BvR 670/91 - BVerfGE 105, 279<301 f.>). Dies rechtfertigt jedoch nicht den Schluss, dass exekutives Informationshandeln stets ausschließlich auf einer spezifisch verfassungsrechtlichen Grundlage erfolgt. Die Befugnis einer öffentlichen Stelle zum Betreiben von Öffentlichkeitsarbeit besteht vielmehr grundsätzlich auf Grund einer Annexkompetenz zu der jeweiligen Sachaufgabenzuständigkeit (vgl. BVerwG, Urteil vom 18. September 2019 - 6 A 7.18 - BVerwGE 166, 303 Rn. 28). Zudem kann einer Behörde die Ermächtigung zum Informationshandeln durch einfaches Gesetz eingeräumt werden.
6. Ist für die Klage eines Bürgers, der geltend macht, durch einen schlichten Parlamentsbeschluss in seinen subjektiven Rechten betroffen zu sein, der Verwaltungsrechtsweg gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO aus den dargelegten Gründen nicht eröffnet, bleibt dem Betroffenen zwar nur die Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde. Gegen die darin liegende Beschränkung der Rechtsschutzmöglichkeiten bestehen jedoch keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Weder die Rechtsschutzgewährleistung (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG) noch der allgemeine Justizgewährleistungsanspruch (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG), der zur Anwendung käme, falls schlichte Parlamentsbeschlüsse nicht als öffentliche Gewalt im Sinne des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG zu qualifizieren sein sollten, verlangen ausnahmslos eine fachgerichtliche Zuständigkeit.
Verfassungsrechtliche Bedenken bestehen insbesondere auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Anspruchs des Bürgers auf eine möglichst wirksame gerichtliche Kontrolle. Zwar prüft das Bundesverfassungsgericht auf Verfassungsbeschwerden gegen Verwaltungshandlungen oder gerichtliche Entscheidungen diese nicht in vollem Umfang nach, sondern im Wesentlichen nur unter dem Gesichtspunkt, ob spezifisches Verfassungsrecht verletzt ist (BVerfG, Urteile vom 16. Januar 1957 - 1 BvR 253/56 - BVerfGE 6, 32 <43> und vom 14. Januar 2025 - 1 BvR 548/22 - NJW 2025, 1037 Rn. 37; Beschluss vom 10. Juni 1964 - 1 BvR 37/63 - BVerfGE 18, 85 <92 f.>). Soweit es um die Verletzung anderer, im einfachen Recht wurzelnder subjektiver Rechte geht, bietet eine Verfassungsbeschwerde gegen Maßnahmen der öffentlichen Gewalt deshalb keinen hinreichenden Rechtsschutz. In dem Umfang, in dem das Bundesverfassungsgericht zur Überprüfung von Rechtsverletzungen auf Initiative des Betroffenen hin uneingeschränkt verpflichtet ist, ist das Rechtsschutzgebot des Art. 19 Abs. 4 GG jedoch gewahrt (vgl. W. Schenke, in: Kahl/Waldhoff/Walter, Bonner Kommentar zum GG, Stand Februar 2025, Art. 19 Rn. 224 ff.). Hiervon ist regelmäßig auszugehen, wenn sich Bürger - wie die Kläger - unter Berufung auf ihre Grundrechte gegen einen schlichten Parlamentsbeschluss wenden. Denn in einem solchen Fall des Grundrechtsschutzes gegen das Handeln eines Verfassungsrechtssubjekts, das seine spezifisch verfassungsrechtlichen Kompetenzen wahrnimmt, sind sämtliche entscheidungserheblichen Normen der Verfassung zu entnehmen und einfaches Recht kommt als Prüfungsmaßstab nicht in Betracht.
7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1, § 159 Satz 1 VwGO, § 100 Abs. 1 ZPO.
II. Sachverhalt und Verfahrensgang
Ausgangspunkt war die sog. BDS-Resolution des Deutschen Bundestags vom 17. Mai 2019 („Der BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten – Antisemitismus bekämpfen“, BT-Drs. 19/10191). Sie wertete die Argumentationsmuster der BDS-Bewegung als antisemitisch und forderte Bund, Länder und Kommunen auf, ihr keine Räume oder Fördermittel bereitzustellen.
Drei Aktivisten („BT3P“) klagten auf Feststellung der Rechtswidrigkeit dieser Resolution. Sie sahen sich in ihrer Meinungsfreiheit sowie mittelbar in der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit beeinträchtigt.
-
VG Berlin (2021): sah den Verwaltungsrechtsweg zunächst als eröffnet an, wies die Klage aber im Ergebnis ab.
-
OVG Berlin-Brandenburg (2023): verneinte die Zulässigkeit der Klage mit der Begründung, es handele sich um eine verfassungsrechtliche Streitigkeit.
-
BVerwG (2025): bestätigte diese Sicht in letzter Instanz.
III. Rechtliche Würdigung
1. Maßgebliche Norm
Zentral ist § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO:
„Der Verwaltungsrechtsweg ist in allen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art eröffnet …“
Damit hängt die Rechtswegfrage an der negativen Voraussetzung „nichtverfassungsrechtlicher Art“.
2. Aufgabe der Theorie der „doppelten Verfassungsunmittelbarkeit“
Bislang wurde verlangt, dass
-
ausschließlich Verfassungsorgane beteiligt sind und
-
die Streitigkeit ihre Grundlage unmittelbar im Verfassungsrecht hat.
Nur dann wurde ein Verfahren als „verfassungsrechtlicher Art“ eingeordnet. Diese restriktive Sicht wurde vielfach kritisiert, weil sie einen großen Bereich des staatlichen Handelns den Verwaltungsgerichten unterstellte, obwohl der Bezug zur Verfassungsordnung evident war.
Das BVerwG verabschiedet sich hiervon:
Maßgeblich sei, „ob im Kern das staatsorganisationsrechtliche Können, Dürfen oder Müssen eines Verfassungsorgans verhandelt wird“ (BVerwG, Urt. v. 26.03.2025 – 6 C 6.23, juris Rn. 28).
Damit wird der funktionale Charakter des Handelns betont, nicht die personelle Beteiligung.
3. Anwendung auf Parlamentsresolutionen
Eine schlichte Parlamentsresolution ist keine Verwaltungsmaßnahme, sondern eine politische Willensbekundung des Bundestages in Ausübung seiner verfassungsrechtlichen Stellung. Sie unterscheidet sich grundlegend vom exekutiven Informationshandeln (Appelle, Warnungen, Pressemitteilungen von Regierungen), das verwaltungsgerichtlich überprüfbar ist.
Folge: Betroffene müssen direkt vor das Bundesverfassungsgericht (oder die jeweiligen Landesverfassungsgerichte bei Landtagsbeschlüssen) ziehen.
4. Rechtsschutzgarantie (Art. 19 Abs. 4 GG)
Ein möglicher Einwand lautete: Wird der Verwaltungsrechtsweg versperrt, könne dies einen Verstoß gegen die Rechtsschutzgarantie bedeuten.
Das BVerwG verneint dies: Eine Verfassungsbeschwerde sei ausreichend, da bei schlichten Parlamentsbeschlüssen ohnehin nur Verfassungsrecht Prüfungsmaßstab sein könne.
Meinung: Diese Argumentation ist dogmatisch sauber, praktisch aber problematisch. Die Hürden der Verfassungsbeschwerde (Beschwerdebefugnis, Subsidiarität, Frist) sind hoch; die Möglichkeit einer konkreten Überprüfung durch Fachgerichte entfällt.
IV. Kritische Würdigung
1. Richtigkeit der Entscheidung
Das Urteil überzeugt insoweit, als es die besondere verfassungsrechtliche Stellung parlamentarischer Beschlüsse hervorhebt. Es vermeidet eine Vermischung von politischem Willensbildungsakt und rechtsverbindlichem Verwaltungshandeln.
Die Abgrenzung zum exekutiven Informationshandeln ist sachgerecht: Eine Resolution repräsentiert den Willen des gesamten Parlaments und besitzt allein dadurch eine verfassungsrechtliche Qualität.
2. Problemkreise und abweichende Auffassungen
-
Informationshandeln der Exekutive: Teile der Literatur wollten Parlamentsresolutionen wie Regierungsappelle behandeln. Das VG Berlin hatte dem zunächst zugestimmt.
-
Art. 19 Abs. 4 GG: Kritiker sehen eine Aushöhlung der Rechtsschutzgarantie, da faktisch kaum eine Verfassungsbeschwerde gegen Resolutionen Erfolg haben dürfte.
-
Verfassungsprozessuale Alternativen: Unklar bleibt, ob neben der Verfassungsbeschwerde auch Organstreitverfahren oder abstrakte Normenkontrolle eröffnet sein könnten. Da Einzelpersonen hierfür nicht antragsbefugt sind, entsteht eine Rechtsschutzlücke.
-
Abgrenzungsschwierigkeiten: Künftige Fälle könnten unklar bleiben, etwa wenn parlamentarische Beschlüsse zwar formal als Resolution auftreten, aber faktisch verbindliche Rechtsfolgen auslösen (z. B. Haushaltsbeschlüsse, Ressourcenzuweisungen).
3. Verhältnis zu früherer Rechtsprechung
-
BVerwG 2022 (8 C 9.21): Dort hatte das Gericht Raumverbote gegen BDS-Anhänger als Eingriff in die Meinungsfreiheit verurteilt. Der Unterschied: Es ging um eine konkrete Verwaltungspraxis, nicht um eine parlamentarische Willensäußerung.
-
BVerfG st. Rspr. zu Art. 19 Abs. 4 GG: Das BVerwG folgt der Linie, dass es keine umfassende „Vollüberprüfung“ jeder staatlichen Handlung geben muss, solange eine gerichtliche Instanz für die Geltendmachung von Grundrechtsverletzungen existiert.
V. Bedeutung für Praxis und Wissenschaft
-
Prozessrechtlich:
-
Verwaltungsgerichte sind künftig bei Klagen gegen Parlamentsresolutionen nicht zuständig.
-
Betroffene müssen den Weg der Verfassungsbeschwerde wählen – mit allen Zulässigkeitshürden.
-
-
Politisch-rechtlich:
-
Parlamentsresolutionen werden als „unverbindliche Meinungsäußerungen“ gestärkt, die praktisch kaum angreifbar sind.
-
Politische Minderheiten oder NGOs haben es schwerer, solche Beschlüsse gerichtlich überprüfen zu lassen.
-
-
Dogmatisch:
-
Die Abkehr von der „doppelten Verfassungsunmittelbarkeit“ zugunsten einer funktionalen Betrachtung prägt künftig die Auslegung von § 40 VwGO.
-
Ob dies zu mehr Klarheit oder zu neuen Abgrenzungsproblemen führt, bleibt abzuwarten.
-
VI. Fazit
Das BVerwG-Urteil 6 C 6.23 ist ein Weichensteller:
-
Richtig ist, dass schlichte Parlamentsbeschlüsse keine Verwaltungsakte darstellen und damit nicht der Fachgerichtsbarkeit unterliegen.
-
Fraglich bleibt jedoch, ob die faktische Beschränkung des Rechtsschutzes durch die Verweisung auf das BVerfG mit Art. 19 Abs. 4 GG in der Praxis vereinbar ist.
-
Abweichende Meinungen betonen die Nähe zu exekutivem Informationshandeln und warnen vor einer Schutzlücke.
Lehre: Wer gegen Parlamentsbeschlüsse vorgehen will, muss künftig verfassungsprozessuale Wege beschreiten. Die Entscheidung verschiebt die Gewichte im Spannungsfeld von Demokratie, Rechtsschutz und Gewaltenteilung – zugunsten der politischen Eigenständigkeit des Parlaments.
moreResultsText

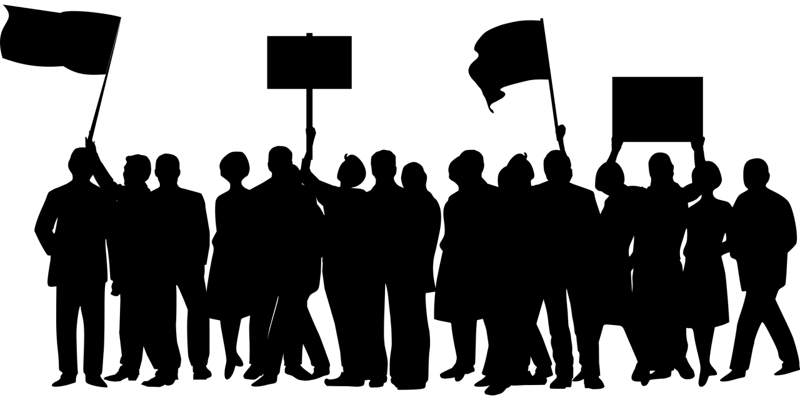




Annotations
(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen.
(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.
(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind.
(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.


