Urteils-Kommentar zu Bundesgerichtshof Urteil, 7. Nov. 2024 - III ZR 79/23 von Dirk Streifler
Bundesgerichtshof Urteil, 7. Nov. 2024 - III ZR 79/23
Tenor
Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart - 12. Zivilsenat - vom 30. März 2023 aufgehoben.
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsrechtszugs, an einen anderen Zivilsenat des Berufungsgerichts zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Kläger nehmen die Beklagte aus unerlaubter Handlung (Beihilfe zum Betrug, sittenwidrige vorsätzliche Schädigung) im Zusammenhang mit einer Kapitalanlage bei der inzwischen insolventen EN S. GmbH auf Schadensersatz in Anspruch.
Die EN S. GmbH (im Folgenden: ENS) wurde im Jahr 2011 durch E. N. gegründet. Das Unternehmen war nach eigenen Angaben hauptsächlich im Bereich der Vermietung von elektronischen Datenspeichern (sog. Storagesysteme) tätig. Nach dem Geschäftsmodell sollten die zuvor erworbenen Storagesysteme an gewerbliche und staatliche Nutzer vermietet werden. Kapitalanleger konnten in dieses Geschäftsmodell investieren. Zur Kapitalbeschaffung schloss die ENS zunächst Kauf- und Überlassungsverträge mit den Anlegern ab, die durch eine Seriennummer individualisierte Storagesysteme von der ENS erwerben und sodann an diese vermieten sollten, die ihrerseits die Systeme weitervermieten sollte. Die Anleger sollten regelmäßige Mietzahlungen und am Ende der zwischen 12 und 36 Monaten liegenden Vertragslaufzeit eine Schlusszahlung erhalten, wobei eine Rendite von etwa acht bis zwölf Prozent in Aussicht gestellt wurde. Da die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Herbst 2014 die Kauf- und Überlassungsverträge als unerlaubtes Einlagengeschäft im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 i.V.m. § 32 Abs. 1 KWG beanstandete, musste die ENS die bis dahin geschlossenen Verträge rückabwickeln, was sie dadurch zu kompensieren versuchte, dass sie den Anlegern den Abschluss neuer, den Vorgaben der BaFin nunmehr entsprechender Kauf- und Überlassungsverträge anbot. Ab Ende 2015 vertrieb die ENS zudem Anleihen (Inhaber-Teilschuldverschreibungen) mit einem Volumen von insgesamt 48 Millionen Euro.
Geschäftsführer der ENS waren E. N. und L. B. . Die Beklagte war seit 2011 für die ENS als Steuerberaterin und Buchhalterin tätig. Im Herbst 2014 heiratete sie den Mitgeschäftsführer L. B. . Als Steuerberaterin der ENS erhielt die Beklagte ein monatliches Fixum von 13.090 €. Das Geschäftsführergehalt ihres Ehemannes betrug zuletzt 40.000 € im Monat.
Die Geschäftstätigkeit der ENS war weitgehend fiktiv. Die an die Anleger verkauften Speichermedien existierten nicht. Es handelte sich um ein sogenanntes "Schneeballsystem", bei dem die immer neue Beschaffung von Anlegerkapital die einzige nennenswerte Einnahmequelle darstellte. Um die Zahlung von Nutzungsentgelten fingieren zu können, ohne dass die entsprechende Liquidität zur Verfügung stand, täuschte E. N. einen "abgekürzten Zahlungsweg" vor. Hiernach leisteten die angeblichen Nutzer der Speichermedien die von ihnen gegenüber der ENS geschuldeten Nutzungsentgelte unmittelbar an die angeblichen Lieferanten.
Die Kläger schlossen unter dem 22. April 2015 insgesamt vier Kauf- und Überlassungsverträge ab (Kläger zu 1: 29.560 € und 29.508 €; Klägerin zu 2: 16.000 € und 37.400 €). In der Folgezeit erhielten der Kläger zu 1 und die Klägerin zu 2 Mietzahlungen von 36.152,58 € beziehungsweise 27.545,20 €.
Nach einer Selbstanzeige des Geschäftsführers N. im Februar 2017 stellte die ENS am 3. März 2017 einen Insolvenzantrag, der zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen führte. N. wurde vom Landgericht Stuttgart mit rechtskräftig gewordenem Urteil vom 7. August 2018 wegen Betruges in drei Fällen (Tat 1: in dem Zeitraum vom 17. September 2014 bis zum 13. Mai 2015 abgeschlossene Kauf- und Überlassungsverträge mit einem Gesamtschaden in Höhe von 42,7 Mio. €; Tat 2: Inhaber-Teilschuldverschreibung im Volumen von 15 Mio. €; Tat 3: zwei Inhaber-Teilschuldverschreibungen im Volumen von insgesamt 33 Mio. €) zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren und zehn Monaten verurteilt. Der Mitgeschäftsführer L. B. und die Beklagte wurden als Mittäter angeklagt. Nach 39 Hauptverhandlungsterminen verstarb L. B. am 8. Januar 2019 völlig unerwartet während der Untersuchungshaft. Die Beklagte legte daraufhin ein Geständnis ab. Mit rechtskräftigem Urteil vom 26. Februar 2019 verurteilte das Landgericht Stuttgart (20 KLs 163 Js 20674/17) die Beklagte (nur) wegen Beihilfe zum Betrug in drei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zugleich ordnete es die Einziehung des Wertes von Taterträgen in Höhe von 340.340 € an.
Die Kläger haben beantragt, die Beklagte zur Zahlung von 22.915,42 € an den Kläger zu 1 sowie von 25.854,80 € an die Klägerin zu 2 zu verurteilen, jeweils nebst Zinsen und Zug um Zug gegen die Übertragung/Abtretung der Rechte der Kläger als Gläubiger im Insolvenzverfahren der ENS, und den Annahmeverzug der Beklagten festzustellen. Daneben verlangen sie vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von 2.099,76 €. Sie haben geltend gemacht, die Beklagte hafte für den durch die gezeichneten Anlagen entstandenen Schaden gemäß § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 263 StGB, § 826 BGB, da sie in das Betrugssystem als Steuerberaterin, Buchhalterin und Ehefrau des Geschäftsführers L. B. eingebunden gewesen sei ("Head of Finance"). Spätestens nach der Beanstandung der BaFin im Herbst 2014 habe sie erkannt, dass die angeblichen Datenspeicher nicht existierten. Das von der ENS betriebene "Schneeballsystem" sei aus der Buchhaltung auf einen Blick erkennbar gewesen. Das vor der Strafkammer abgelegte Geständnis sei daher inhaltlich richtig gewesen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Das "Schneeballsystem" habe sie nicht erkannt. Vielmehr habe sie darauf vertraut, dass die Datenspeichersysteme tatsächlich vorhanden seien. Das Geständnis sei im Strafprozess allein deshalb erfolgt, um einer drohenden Haftstrafe zu entgehen. Es habe sich darin erschöpft, dass sie die Vorhalte des Strafkammervorsitzenden bestätigt habe.
Das Landgericht Stuttgart hat die Klage - nach informatorischer Anhörung der Beklagten und Vernehmung des E. N. als Zeugen - abgewiesen. Die Berufung der Kläger hat keinen Erfolg gehabt. Mit der vom erkennenden Senat zugelassenen Revision verfolgen sie ihr Klagebegehren weiter.
Gründe
Die zulässige Revision der Kläger hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an einen anderen Senat des Berufungsgerichts.
I.
Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung im Wesentlichen ausgeführt:
Das Urteil des Landgerichts sei richtig. Auf Grund der Beweislage im Zivilprozess könne der Beklagten keine vorsätzliche Beihilfe zum Betrug (§ 823 Abs. 2, § 830 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 263, 27 StGB) oder zur sittenwidrigen Schädigung (§ 826 BGB) nachgewiesen werden. Das rechtskräftige Strafurteil vom 26. Februar 2019 sei im Zivilprozess nicht bindend (Hinweis auf Senat, Urteil vom 26. August 2021 - III ZR 189/19, NJW 2022, 705 Rn. 11 ff). Die Beklagte habe den Inhalt des Strafurteils und die Richtigkeit ihres Geständnisses schlüssig bestritten. Sie habe ausgeführt, dass ihr nach dem Tod des Ehemannes durch die Strafkammer signalisiert worden sei, im Falle eines Geständnisses könne sie mit einer Bewährungsstrafe rechnen. Um einer Haftstrafe zu entgehen, habe sie sich sodann nach Rücksprache mit ihrem Verteidiger entschlossen, ein Geständnis abzulegen, obwohl dieses "eine Lüge" gewesen sei.
Nach Auffassung des Berufungsgerichts hat die Beklagte auch zu den tragenden Gründen des Strafurteils schlüssig dargelegt, warum diese aus ihrer Sicht nicht den Nachweis der Kenntnis des betrügerischen Handelns des E. N. zuließen. Es erscheine zwar durchaus möglich, dass die Beklagte von den fingierten Geschäften und damit auch von dem Betrugsmodell Kenntnis gehabt haben könnte, nachgewiesen sei das aber nicht. Da sich die Kenntnis der Beklagten von dem Betrugsmodell nicht nachweisen lasse, hafte sie auch nicht nach § 826 BGB.
Zu diesem Ergebnis ist das Berufungsgericht gelangt, indem es sich im Wesentlichen mit den bereits vom Landgericht festgestellten Belastungsindizien auseinandergesetzt hat, wobei es jeweils der Würdigung des Landgerichts gefolgt ist.
Erkennbarkeit des Schneeballsystems anhand des Geschäftsmodells und der Geschäftszahlen (BU 12-14)
Es lasse sich vorliegend nicht mit der nötigen Sicherheit feststellen, dass das Geschäftsmodell der ENS mit einem Blick erkennbar auf Täuschung und Schädigung ausgerichtet gewesen sei und die Beklagte dies auch erkannt habe. Das Landgericht weise zu Recht darauf hin, dass sich allein aus den Zahlungsflüssen nicht notwendig ein Betrugsmodell ergebe. Das Landgericht habe zutreffend dargelegt, dass die Tatsache, dass ein Unternehmen aus seinem operativen Geschäft einen negativen Cashflow erziele, nicht zwingend auf fehlende Nachhaltigkeit schließen lasse, sondern eine "Überbrückung" durch Kredite oder neue Anlegergelder in Betracht komme. Das Landgericht habe jedenfalls nicht feststellen können, dass mittelfristig auch dann kein positiver Cashflow hätte generiert werden können, wenn die Speichermedien und die hierüber geschlossenen Nutzungsverträge real existiert hätten.
Erkennbarkeit der fingierten Geschäftsvorgänge durch Information vonseiten des Geschäftsführers N. (BU 14 f)
E. N. habe bei seiner Vernehmung vor dem Landgericht ausgesagt, mit der Beklagten nicht über fingierte Geschäftsvorfälle und Scheinrechnungen gesprochen zu haben (Protokoll vom 16. März 2022 in der Sache 24 O 495/20, S. 3 = GA I 196). Der Schluss des Landgerichts, dass N. auch gegenüber der Beklagten den Anschein einer real praktizierten Geschäftstätigkeit aufrechterhalten und Ausreden erfunden habe, könne ohne Weiteres geteilt werden.
Erkennbarkeit der fingierten Geschäftsvorfälle wegen Austausches von Rechnungen (BU 15-19)
Trotz der Aussage des Zeugen N. , dass die Beklagte den nachträglichen Austausch von Rechnungen "mitbekommen" habe, sei der Schluss des Landgerichts, dass sich im Ergebnis - mangels genauerer, detaillierter Kenntnisse zu den einzelnen Vorgängen und der Beteiligung der Beklagten hieran - nicht sicher feststellen lasse, was im Hinblick auf den angeblichen "Austausch" von Rechnungen tatsächlich passiert sei, nicht zu beanstanden. Im Ergebnis möge es allerdings möglich sein, dass die Beklagte Rechnungen oder Lieferscheine getauscht haben könnte.
Erkennbarkeit der fingierten Geschäftsvorgänge durch schlecht gefälschte Rechnungen in der Anfangsphase (BU 19-21)
Im Berufungsverfahren hätten keine neuen Erkenntnisse zu der schlechten Qualität der Rechnungsfälschungen in der Anfangszeit und zur Kenntnis der Beklagten bezüglich eines "Schneeballsystems" auf Grund der gefälschten Rechnungen gewonnen werden können. Das gelte auch bezüglich gleich aussehender Rechnungen trotz verschiedener Rechnungssteller. Es könne nicht widerlegt werden, dass die Beklagte aus diesen Vorgängen weder auf ein "Schneeballsystem" noch auf nicht existierende Datenspeicher geschlossen habe. Auch eine Anweisung des Geschäftsführers N. , zweifelhafte Rechnungen zu bezahlen, hätte nicht zwingend auf betrügerische Geschäfte hinweisen müssen.
Erkennbarkeit der fingierten Geschäftsvorgänge auf Grund des Geldmangels nach der Beanstandung durch die BaFin im Herbst 2014 (BU 21, 23)
Dem Landgericht sei ohne Weiteres darin zuzustimmen, dass aus der Beanstandung des bisherigen Geschäftsmodells durch die BaFin kein Rückschluss möglich sei, dass bislang fingierte Geschäfte vorgelegen hätten. Dass der erforderliche Kapitalbedarf zur Rückzahlung der Anlegerbeträge nicht zur Verfügung gestanden habe, habe sich daraus ergeben, dass neue Geschäfte nicht durch Bankkredite, sondern durch Neuanleger finanziert worden seien. Daraus, dass die Beklagte in die Liquiditätsplanung eingebunden gewesen sei, Geld immer knapp gewesen sei, weil es wenig Rückfluss gegeben habe, und das nötige Kapital überwiegend von den Neuanlegern genommen worden sei, könne nicht auf die Kenntnis der Beklagten von fingierten Geschäften oder eines "Schneeballsystems" geschlossen werden.
Erkennbarkeit der fingierten Geschäftsvorgänge auf Grund des abgekürzten Zahlungsweges (BU 21-23)
Der Zeuge N. habe zwar bekundet, die Beklagte habe den "abgekürzten Zahlungsweg" akzeptiert, obwohl die ENS die Liquidität aus den (angeblichen) Nutzungsentgelten dringend benötigt habe. Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt habe, sei der Rückschluss auf die Kenntnis der Beklagten von unrealen Geschäftsvorfällen nach Akzeptanz des abgekürzten Zahlungsweges (um die Zahlung von Nutzungsentgelten fingieren zu können) jedoch nicht zwingend. Aus dem abgekürzten Zahlungsweg könne nicht ohne Weiteres der Schluss gezogen werden, die Beklagte habe die Fiktion der Geschäftsvorfälle gekannt.
Entnahme hoher Barbeträge durch Geschäftsführer N. und deren Buchung (BU 23 f)
Es sei unstreitig, dass N. hohe Barbeträge von den Geschäftskonten zur angeblichen Bezahlung von Forderungen im Ausland erhalten habe. Im Ergebnis lasse sich jedoch aus diesen Vorgängen nicht ableiten, dass die Beklagte vorsätzlich Beihilfe zum Betrug an den Anlegern geleistet habe.
Nichtaufzeichnung der Standorte der Speichersysteme in der Buchhaltung (BU 24)
Hinsichtlich der Nichtaufzeichnung der Standorte der Storagesysteme habe die Beklagte ausgeführt, dass bezüglich der Systeme, deren Eigentümerin sie (sic!) nicht gewesen sei, sie auch nicht verpflichtet gewesen sei, entsprechende Bestandsverzeichnisse zu führen. Es könne daher nicht ausgeschlossen werden, dass dies der Grund für die Beklagte gewesen sei, die betroffenen Systeme nicht nach ihrem Standort aufzuzeichnen.
II.
Diese Ausführungen halten der rechtlichen Überprüfung nicht stand. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung lässt sich ein - hier allein in Betracht gezogener - deliktischer Schadensersatzanspruch gegen die Beklagte aus § 823 Abs. 2, § 830 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 263, 27 StGB beziehungsweise aus § 826 BGB nicht verneinen. Die tatrichterliche Beweiswürdigung ist in mehrfacher Hinsicht rechtsfehlerhaft.
Hinsichtlich der Frage einer vorsätzlichen Beihilfe bei berufstypischen "neutralen" Handlungen (hier: Steuerberatung, Buchhaltung) hat das Berufungsgericht den nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung geltenden Prüfungsmaßstab unzulässig verkürzt, indem es allein auf die positive Kenntnis des "Schneeballsystems" abgestellt hat (1.). Darüber hinaus hat es überspannte Anforderungen an die richterliche Überzeugungsbildung (§ 286 ZPO) gestellt (2.). Die isolierte Würdigung der einzelnen Beweisindizien ohne eine Gesamtabwägung aller für und gegen die Täterschaft der Beklagten sprechenden Umstände ist ebenfalls rechtsfehlerhaft (3. und 4.). Schließlich hat das Berufungsgericht auch den Anspruch der Kläger auf rechtliches Gehör (Art. 103Abs. 1 GG) verletzt, indem es deren Vortrag zu den Angaben der Zeugin Nü. im Strafverfahren gegen E. N. und L. B. übergangen hat (5.).
1. Die Revision rügt zu Recht, das Berufungsgericht habe sich rechtsfehlerhaft allein mit der Frage einer positiven Kenntnis der Beklagten hinsichtlich des von E. N. ins Werk gesetzten "Schneeballsystems" befasst.
a) Die Gehilfenhaftung richtet sich auch im Zivilrecht nach strafrechtlichen Grundsätzen (Senat, Urteil vom 11. Juli 2024 - III ZR 176/22, NJOZ 2024, 1141 Rn. 13). Gemäß § 27 Abs. 1 StGB wird als Gehilfe bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe leistet. Beihilfe ist danach die vorsätzliche Hilfeleistung zu einer Vorsatztat eines anderen. Objektiv muss die Beihilfehandlung für den Taterfolg nicht ursächlich gewesen sein; sie muss die tatbestandsmäßige Handlung lediglich gefördert, erleichtert oder den Täter in seinem Entschluss bestärkt haben. Gehilfenvorsatz liegt vor, wenn der Gehilfe zwar nicht alle Einzelheiten, aber dennoch die zentralen Merkmale der Haupttat sowie deren Förderung durch sein Verhalten kennt oder zumindest im Sinne bedingten Vorsatzes für möglich hält und in Kauf nimmt (Senat, Urteile vom 26. August 2021 - III ZR 189/19, NJW 2022, 705 Rn. 18 und vom 11. Juli 2024 aaO).
b) Als Steuerberaterin und Buchhalterin der ENS hat die Beklagte sogenannte berufstypische Tätigkeiten ausgeübt, wodurch allerdings unstreitig das von N. entwickelte betrügerische "Schneeballsystem" objektiv gefördert wurde. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs können auch solche "neutralen" Handlungen eine strafbare Beihilfe darstellen (Senat aaO). Dies bedarf einer bewertenden Betrachtung im Einzelfall, wobei eine strafbare Beihilfe bereits aus objektiven Gründen zu verneinen sein kann, wenn dem Handeln des Täters - was vorliegend jedoch ausscheidet - der "deliktische Sinnbezug" fehlt, weil das vom Gehilfen geförderte Tun des Haupttäters nicht allein auf die Begehung einer strafbaren Handlung abzielt und der Beitrag des Gehilfen auch ohne das strafbare Handeln des Täters für diesen sinnvoll bleibt (vgl. BGH, Urteil vom 22. Januar 2014 - 5 StR 468/12, NZWiSt 2014, 139 Rn. 28).
In subjektiver Hinsicht sind zwei Fallgruppen zu unterscheiden: Zielt das Handeln des Haupttäters ausschließlich darauf ab, eine strafbare Handlung zu begehen, und weiß dies der Hilfeleistende (Fallgruppe 1), so ist sein Tatbeitrag als Beihilfehandlung zu werten. In diesem Fall verliert sein Tun stets den "Alltagscharakter"; es ist als Solidarisierung mit dem Täter zu deuten und dann auch nicht mehr als sozialadäquat anzusehen. Weiß der Hilfeleistende dagegen nicht, wie der von ihm geleistete Beitrag vom Haupttäter verwendet wird, hält er es lediglich für möglich, dass sein Tun zur Begehung einer Straftat genutzt wird (Fallgruppe 2), so ist sein Handeln regelmäßig noch nicht als strafbare Beihilfehandlung zu beurteilen, es sei denn, das von ihm erkannte Risiko strafbaren Verhaltens des von ihm Unterstützten war derart hoch, dass er sich mit seiner Hilfeleistung die Förderung eines erkennbar tatgeneigten Täters angelegen sein ließ (st. Rspr.; vgl. nur Senat, Urteile vom 26. August 2021 und vom 11. Juli 2024 jew. aaO; BGH, Urteile vom 1. August 2000 - 5 StR 624/99, BGHSt 46, 107, 109 ff; vom 22. Januar 2014 aaO Rn. 26 ff und vom 19. Dezember 2017 - 1 StR 56/17, NStZ 2018, 328 f).
c) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft nur die Fallgruppe 1 in den Blick genommen. Dabei ist es davon ausgegangen, dass die Beklagte durch ihre Tätigkeit als Steuerberaterin und Buchhalterin die (fingierte) Geschäftstätigkeit der ENS fortlaufend unterstützt und den Taterfolg im Sinne des § 263 StGB somit objektiv gefördert habe (was zutrifft), ihr jedoch nicht nachzuweisen sei, dass sie Kenntnis von dem Betrugsmodell gehabt habe, auch wenn die Behauptung der Kläger, die Beklagte habe den betrügerischen Charakter des Geschäftsmodells erkannt, plausibel sei (BU 12 Abs. 1) und es im Ergebnis durchaus als möglich erscheine, dass die Beklagte von den fingierten Geschäften und damit auch von dem Betrugsmodell Kenntnis gehabt haben könnte (BU 27 Abs. 3). Mit der sich hiernach aufdrängenden Frage, ob die Beklagte angesichts einer Vielzahl von Belastungsindizien (dazu sogleich) es für "sehr wahrscheinlich" (vgl. BGH, Urteil vom 22. Januar 2014 aaO Rn. 32) oder jedenfalls "überwiegend wahrscheinlich" (vgl. BGH, Urteil vom 19. Dezember 2017 aaO S. 329) gehalten hat, dass der Geschäftstätigkeit der ENS ein betrügerisches "Schneeballsystem" zugrunde lag, und sie sich mit ihrer Tätigkeit für die ENS - nicht zuletzt zur Aufrechterhaltung ihres gehobenen Lebensstandards und des hohen Geschäftsführergehalts ihres Ehemanns - die Förderung eines erkennbar tatgeneigten Täters angelegen sein ließ (Fallgruppe 2), hat sich das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft nicht auseinandergesetzt. Dabei war maßgeblich, ob es für die Beklagte Anhaltspunkte gab, die es als sehr oder jedenfalls überwiegend wahrscheinlich erscheinen ließen, dass die gesamte durch ihr Tun geförderte Geschäftstätigkeit der ENS auf die Begehung von Betrugsstraftaten angelegt war. Dies hätte das Berufungsgericht im Rahmen einer Gesamtwürdigung aller für und gegen die Beklagte sprechenden Umstände prüfen müssen. Soweit in dem Senatsurteil vom 26. August 2021 (aaO Rn. 19) von einer "hochgradigen Wahrscheinlichkeit" die Rede ist, ist darin kein abweichender strengerer Prüfungsmaßstab, sondern nur eine auf die konkreten Fallumstände bezogene Formulierung zu sehen.
2. Das Berufungsgericht hat darüber hinaus das gemäß § 286 ZPO anzuwendende Beweismaß unzutreffend eingeschätzt und überspannte Anforderungen an die richterliche Überzeugungsbildung gestellt. Denn es hat bei der Würdigung der einzelnen Belastungsindizien rechtsfehlerhaft verlangt, dass sich daraus "zwingende" Schlüsse ergeben müssten (z.B. BU 13 Abs. 4, 14 Abs. 2, 20 Abs. 3, 22 Abs. 2; siehe auch LGU 13 Abs. 2, 16 Abs. 2, 18 Abs. 3, 21 Abs. 2, 22 Abs. 2).
Nach § 286 ZPO hat der Tatrichter ohne Bindung an Beweisregeln und nur seinem Gewissen unterworfen die Entscheidung zu treffen, ob er an sich mögliche Zweifel überwinden und sich von einem bestimmten Sachverhalt als wahr überzeugen kann. Die Überzeugung des Tatgerichts von einem bestimmten Sachverhalt erfordert keine absolute, das Gegenteil denknotwendig ausschließende Gewissheit. Es genügt vielmehr ein nach der Lebenserfahrung ausreichendes Maß an Sicherheit, das vernünftige Zweifel nicht aufkommen lässt. Das Gesetz setzt eine von allen Zweifeln freie Überzeugung nicht voraus. Das Gericht darf keine unerfüllbaren Beweisanforderungen stellen und keine unumstößliche Gewissheit bei der Prüfung verlangen, ob eine Behauptung wahr und erwiesen ist. Anders als das Berufungsgericht und (wohl auch) das Landgericht meinen, muss ein Beweisergebnis deshalb nicht "zwingend" sein (vgl. BGH, Urteile vom 14. Januar 1993 - IX ZR 238/91, NJW 1993, 935, 937 und vom 7. Juni 2023 - 5 StR 80/23, NStZ 2023, 729 Rn. 41). Dies gilt in besonderem Maß bei der Würdigung von Indizien. Denn es ist gerade deren Wesensmerkmal, dass sie isoliert betrachtet keine zwingenden Schlüsse zulassen, sondern ihren Beweiswert erst im Rahmen einer Gesamtbetrachtung aller für und gegen die Täterschaft sprechenden Gesichtspunkte gewinnen (BGH, Urteil vom 26. April 2023 - 5 StR 457/22, juris Rn. 13).
3. Die Bewertung der für den Gehilfenvorsatz der Beklagten sprechenden Indizien ist aus einem weiteren Grund rechtsfehlerhaft. In den Urteilen der Vor-instanzen werden zwar zahlreiche für die subjektive Tatseite der Beihilfe (§ 27 StGB, § 830 Abs. 2 BGB) sprechende Indizien aufgeführt und jeweils einzeln gewürdigt (LGU 12-22 und BU 6-27). Die Beweiswürdigung sowohl des Landgerichts als auch des Berufungsgerichts lässt jedoch die erforderliche Gesamtschau der Beweisergebnisse vermissen. Liegen - wie hier - mehrere Beweisanzeichen vor, so genügt es nicht, diese jeweils nur einzeln abzuhandeln. Denn der Beweiswert einzelner Indizien ergibt sich regelmäßig erst aus dem Zusammenhang mit anderen Hilfstatsachen, weshalb der Inbezugsetzung der Indizien zueinander im Rahmen der gebotenen Gesamtwürdigung besonderes Gewicht zukommt. Auch wenn einzelne Hilfstatsachen jeweils für sich genommen nicht ausreichen, den Schluss auf die von einer Partei behauptete Haupttatsache zu begründen, können doch mehrere von ihnen in ihrer Gesamtheit und gegebenenfalls in Verbindung mit dem übrigen Prozessstoff eine tragfähige Grundlage für die Überzeugungsbildung des Tatrichters sein, die Haupttatsache sei gegeben. Eine Indiztatsache reicht für den Nachweis der Haupttatsache nur dann nicht aus, wenn das Indiz für sich allein und im Zusammenhang mit weiteren Indizien sowie dem sonstigen Sachverhalt nicht den ausreichend sicheren Schluss auf die Haupttatsache zulässt (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteile vom 14. Januar 1993 aaO S. 938; vom 27. Januar 1994 - I ZR 326/91, NJW 1994, 2289, 2291; vom 15. Juni 1994 - IV ZR 126/93, NJW-RR 1994, 1112 f; vom 5. November 2014 - 1 StR 327/14, NStZ-RR 2015, 83, 85; vom 23. September 2020 - KZR 35/19, NJW 2021, 848 Rn. 88; vom 8. März 2023 - 6 StR 374/22, juris Rn. 10 ff; vom 26. April 2023 aaO Rn. 8; vom 7. Juni 2023 aaO Rn. 40 und vom 28. Juni 2023 - 1 StR 421/22, juris Rn. 10, 15).
4. Vorliegend erscheint es nicht nur möglich, sondern sogar naheliegend, dass das Berufungsgericht auch den subjektiven Tatbestand der Beihilfe bejaht hätte, wenn es im Rahmen der gebotenen Gesamtbetrachtung die nachfolgenden feststehenden Indiztatsachen zueinander in Beziehung gesetzt und unter Berücksichtigung des sonstigen Prozessstoffs umfassend gewürdigt hätte:
a) Das im Strafverfahren nach 42 Hauptverhandlungsterminen abgelegte umfassende Geständnis der Beklagten (auf Vorhalte des Gerichts, keine lediglich verlesene Verteidigererklärung) ist ein starkes Indiz für die Wahrheit der zugestandenen Tatsachen, zumal die Strafkammer ausdrücklich festgestellt hat, dass das Geständnis durch das Ergebnis der sonstigen Beweisaufnahme bestätigt und ergänzt worden und auch die innere Tatseite praktisch nicht mehr abstreitbar gewesen sei (Strafurteil vom 26. Februar 2019, S. 152 ff; im Folgenden: SU). Die Beklagte akzeptierte auch die Einziehung ihres Steuerberaterhonorars in Höhe von 340.340 €.
b) Die aus der Buchhaltung ersichtlichen Zahlungsströme waren typisch für ein "Schneeballsystem". Der laufende Liquiditätsbedarf konnte nur aus den Geldern der Neuanleger gedeckt werden (vgl. Senat, Versäumnisurteil vom 4. Februar 2021 - III ZR 7/20, NJW 2021, 1759 Rn. 16). In den Geschäftsjahren 2013/2014 bis 2016/2017 standen "verbuchten Nutzungsentgelten" in Höhe von insgesamt 11,14 Mio. € Ausgaben in Höhe von insgesamt 98,8 Mio. € gegenüber. Die angeblichen "Nutzungsentgelte" sanken im Geschäftsjahr 2016/2017 auf 240.000 € bei Ausgaben von 24,6 Mio. € (SU 153 ff).
c) Der Haupttäter N. hat bei seiner Zeugenvernehmung durch das Landgericht ausgesagt, dass das "Schneeballsystem" jedenfalls nach der Beanstandung durch die BaFin "doch recht offensichtlich" gewesen sei, "weil kein Geld da war". Die Beklagte habe den (fingierten) abgekürzten Zahlungsweg ohne Weiteres akzeptiert (Protokoll vom 16. März 2022, S. 3 = GA I 196). Das "Schneeballsystem" sei als solches erkennbar gewesen, "wenn man tiefer geschaut hätte" (aaO, S. 13 = GA I 206). Die Beklagte habe auch den nachträglichen Austausch der in der Anfangsphase dilettantischen Rechnungsfälschungen "mitbekommen" (aaO, S. 4 = GA I 197).
d) Der vom Haupttäter N. erfundene "abgekürzte Zahlungsweg" führte dazu, dass die angeblichen Nutzungsentgelte für die vermieteten Speichersysteme die ENS nie erreichten, so dass zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Aussicht bestand, die den Anlegern versprochenen Rück- und Renditezahlungen zu leisten. An dieser Situation änderte sich bis zuletzt nichts. Im Gegenteil: Die von Anfang an bestehende finanzielle Schieflage der ENS verschlechterte sich zu Beginn des Jahres 2017 derart dramatisch, dass der Haupttäter N. eine Selbstanzeige erstattete. Die Zeugin Nü. hat im Strafverfahren gegen L. B. und die Beklagte bekundet, dass von den angeblichen staatlichen Nutzern "seit Jahren keine Zahlungen auf den Bankkonten der EN S. GmbH eingegangen waren" (SU 154 Abs. 1).
e) Trotz fehlender Liquidität der ENS veranlasste die Beklagte Barauszahlungen in Millionenhöhe von den Geschäftskonten an den Haupttäter N. zur angeblichen "Bezahlung von Forderungen im Ausland" (BU 23, SU 154).
f) Die seit August 2016 als Buchhalterin und Controllerin bei der ENS beschäftigte Zeugin Nü. gab im Strafverfahren an, ihr seien schon nach einigen Monaten so viele Ungereimtheiten in den Geschäftsabläufen aufgefallen, dass sie eine Strafanzeige erwogen habe (u.a. Fehlen jedweder Aufzeichnungen über die Standorte der angeblichen Datenspeichergeräte, keine im Internet abrufbaren nennenswerten Informationen über die Lieferanten und Nutzerkunden, seit Jahren keine Zahlungseingänge vonseiten der angeblichen staatlichen Nutzer). Auf Anweisung der Beklagten habe sie ohne die erforderlichen Belege angebliche Direktzahlungen der Nutzer an die Hardwarelieferanten verbuchen sollen (SU 154 Abs. 1).
Auch wenn die Beobachtungen der Zeugin den Zeitraum erst ab Mitte 2016 unmittelbar betreffen, ergibt sich daraus, dass handgreifliche Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass der gesamte Geschäftsbetrieb der ENS mit hoher Wahrscheinlichkeit von Anfang an auf betrügerischen Machenschaften der Verantwortlichen basierte, zu denen auch die Beklagte gehörte.
g) Der Ehemann der Beklagten, L. B. , war nach Gründung der ENS deren Mitgeschäftsführer neben E. N. . Das Landgericht hat hierzu festgestellt, es sei schwer vorstellbar, dass er nicht bemerkt habe, über Jahre hinweg Geschäftsführer eines Unternehmens (fast) ohne reale Geschäftstätigkeit gewesen zu sein (LGU 22 Abs. 2). An den wöchentlich stattfindenden "Statusmeetings" der Geschäftsführer nahm auch die Beklagte persönlich teil.
Der Haupttäter N. hat im Strafverfahren gegen L. B. und die Beklagte ausgesagt, diese hätten "selbst massivste Auffälligkeiten in der Regel ‚einfach so‘ akzeptiert". So etwa, als er im Jahr 2013 zusammen mit dem gesondert verfolgten "Hardwarelieferanten" und "Rechnungsfälscher" R. C. das "EU-Infrastrukturprojekt" in Serbien erfunden habe, bei dem sich die ENS angeblich bei einer EU-weiten Ausschreibung im Zusammenhang mit der Speicherung von Daten in ehemaligen Tito-Bunkern gegen international aufgestellte Großkonzerne durchgesetzt habe. Obwohl über die angebliche Ausschreibung nicht einmal gefälschte Unterlagen vorhanden gewesen seien und C. nunmehr als Professor und Projektleiter aufgetreten sei, seien weder von L. B. noch von der Beklagten kritische Nachfragen gekommen. Selbst als von den angeblichen Nutzern die vermeintlich von der Europäischen Union finanzierten Nutzungsentgelte nicht entrichtet worden seien, hätten das L. B. und die Beklagte jahrelang hingenommen (SU 152 f).
5. Das Berufungsgericht hat schließlich im Zusammenhang mit der Würdigung der Angaben der Zeugin Nü. , die diese in dem Ermittlungsverfahren gegen E. N. und L. B. gemacht hat, den Anspruch der Kläger auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) in entscheidungserheblicher Weise verletzt.
Die Kläger haben vorgetragen, die Zeugin Nü. habe kurz nach ihrem Arbeitsbeginn bemerkt, dass auf den Rechnungen von Hauptlieferanten sowie vielen weiteren Rechnungen E-Mail-Adressen und Internet-Adressen angegeben gewesen seien, die es tatsächlich nicht gegeben habe. Auch E-Mail-Adressen und Internet-Adressen von Kunden hätten nicht existiert. Die Zeugin habe im Herbst 2016 die Eheleute B. auf die unrichtigen Adressen angesprochen. Diese hätten die Problematik jedoch mehr oder weniger lapidar abgetan (Schriftsatz vom 6. März 2023, S. 18 ff = eGA 252 ff und polizeiliches Vernehmungsprotokoll betreffend die Zeugin Nü. vom 14. März 2017, S. 6 f = eGA 223 f). Die Kläger haben zudem vorgetragen, der Zeugin Nü. seien am 7. Februar 2017 Rechnungen verschiedener Unternehmen im Gesamtumfang von 400.000 € aus den letzten zwei Jahren aufgefallen, die sich in fast allen Details geglichen hätten. Am nächsten Tag habe sie die einzelnen fast identischen Rechnungen zusammengefügt, einzelne davon gescannt und in einer E-Mail an die Beklagte geschickt. In dieser E-Mail vom 8. Februar 2017 (eGA 142) habe sie der Beklagten auch die offensichtlichen Gemeinsamkeiten/Übereinstimmungen beschrieben. Als erste Reaktion habe die Beklagte wörtlich gesagt: "Vergessen Sie’s!" (Schriftsatz vom 6. März 2023, S. 18, 20 ff = eGA 252, 254 ff; polizeiliches Vernehmungsprotokoll aaO, S. 8 f = eGA 225 f).
Der Aussage der Zeugin Nü. kam eine wichtige Indizfunktion zu, weil sich daraus ergab, dass die Rechnungen der "Lieferanten" und "Kunden" der ENS massive Auffälligkeiten aufwiesen (nicht existente E-Mail- und Internet-Adressen, nahezu identische Rechnungen unter verschiedenen Firmennamen) und die Beklagte - hierauf angesprochen - nicht alarmiert, sondern beschwichtigend reagierte und letztlich nichts veranlasste ("Vergessen Sie’s"). Mit dieser Zeugenaussage, die zentrale Bedeutung für den Nachweis der subjektiven Tatseite hatte und deren Inhalt zum wesentlichen Kern des klägerischen Tatsachenvortrags gehörte, hätte sich das Berufungsgericht im Rahmen der anzustellenden Gesamtwürdigung zwingend auseinandersetzen müssen. Stattdessen hat es sich, worauf die Revision zu Recht hinweist, damit begnügt, die Aussage der Zeugin ohne nähere Würdigung pauschal als unerheblich anzusehen (BU 25). Dadurch wurde der Anspruch der Kläger auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) entscheidungserheblich verletzt.
III.
Das angefochtene Urteil ist demnach aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Die Sache ist, da sie noch nicht zur Endentscheidung reif ist, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, damit es sich mit den aufgezeigten Aspekten auseinandersetzen und die bislang unterbliebene Gesamtschau der Beweisergebnisse nachholen kann (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Sollte das Berufungsgericht eine Beihilfe der Beklagten zum Betrug weiterhin für nicht nachweisbar erachten, wird es das Klägervorbringen, die Anleger hätten ihr Kapital zweckgebunden ausschließlich für den Erwerb von Storagesystemen eingezahlt, unter dem Gesichtspunkt des Untreuetatbestandes (§ 266 StGB) zu würdigen haben.
Der Senat hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, nach § 563 Abs. 1 Satz 2 ZPO zu verfahren.
I. Ausgangspunkt der Entscheidung
1. Sachverhalt
Die Beklagte, eine Steuerberaterin und Buchhalterin, war seit 2011 für die inzwischen insolvente EN S. GmbH (ENS) tätig. Die Gesellschaft betrieb ein betrügerisches Schneeballsystem, bei dem Kapitalanlegern vorgegaukelt wurde, sie würden in reale Speichertechnologien investieren. Tatsächlich existierten die angeblichen Speichersysteme nicht, und die Auszahlungen an Anleger wurden durch Neuanleger finanziert. Nach der Beanstandung des Geschäftsmodells durch die BaFin im Jahr 2014 und einer Selbstanzeige des Haupttäters wurde die Beklagte strafrechtlich wegen Beihilfe zum Betrug verurteilt. In einem Zivilverfahren forderten Anleger Schadensersatz von der Beklagten. Die Vorinstanzen wiesen die Klage mit der Begründung ab, es könne der Beklagten kein vorsätzliches Verhalten nachgewiesen werden.
2. Rechtsfrage
Im Mittelpunkt des Rechtsstreits stand die Frage, unter welchen Voraussetzungen berufstypische, „neutrale“ Handlungen wie Steuerberatung als Beihilfe zu einer Straftat gewertet werden können. Dabei war insbesondere zu klären, ob das Berufungsgericht die Anforderungen an die Feststellung des Gehilfenvorsatzes rechtsfehlerhaft verängt hat.
II. Entscheidungsgründe des BGH
1. Subjektive Tatseite der Beihilfe
Der BGH stellte klar, dass die Gehilfenhaftung nach strafrechtlichen Grundsätzen zu beurteilen ist, auch wenn sie zivilrechtlich geltend gemacht wird (§ 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 263, § 27 StGB). Dabei unterscheidet der BGH zwei Fallgruppen:
-
Fallgruppe 1: Der Gehilfe weiß, dass die Haupttat ausschließlich auf die Begehung einer Straftat abzielt, und solidarisiert sich mit dem Haupttäter.
-
Fallgruppe 2: Der Gehilfe erkennt das hohe Risiko eines strafbaren Verhaltens des Haupttäters und nimmt es billigend in Kauf.
Im vorliegenden Fall übersahen die Vorinstanzen, dass die zweite Fallgruppe eine bewertende Gesamtschau der Indizien verlangt. Der BGH rügte, dass die Vorinstanzen lediglich auf eine positive Kenntnis der Beklagten abstellten und damit die Maßstäbe verengten. Entscheidend sei, ob die Beklagte angesichts einer Vielzahl von Belastungsindizien das Schneeballsystem für „sehr wahrscheinlich“ hielt und durch ihre Handlungen bewusst förderte.
2. Beweiswürdigung
Ein zentraler Kritikpunkt des BGH war die fehlerhafte Beweiswürdigung der Vorinstanzen. Der BGH hob hervor, dass eine isolierte Betrachtung einzelner Indizien unzureichend ist. Vielmehr muss eine Gesamtabwägung aller Umstände vorgenommen werden. Die Vorinstanzen hatten rechtsfehlerhaft verlangt, dass jedes einzelne Indiz für sich genommen einen zwingenden Schluss zulassen muss. Nach § 286 ZPO genügt jedoch ein „nausreichendes Maß an Sicherheit“, das vernünftige Zweifel ausschließt.
Der BGH bemängelte zudem, dass wesentliche Belastungsindizien wie das Geständnis der Beklagten im Strafverfahren und ihre Kenntnis des „abgekürzten Zahlungswegs“ nicht angemessen in die Beweiswürdigung einbezogen wurden. Diese hätten im Kontext anderer Tatsachen, etwa der auffälligen Zahlungsströme, eine andere Bewertung nahegelegt.
III. Rechtspolitische und praktische Bedeutung
1. Bedeutung für die Feststellung des Vorsatzes
Das Urteil verdeutlicht die hohe Verantwortung von Zivilgerichten bei der Anwendung strafrechtlicher Maßstäbe. Es fordert eine differenzierte Bewertung der subjektiven Tatseite, insbesondere bei berufstypischen Handlungen. Dies hat weitreichende Konsequenzen für die Haftung von Steuerberatern und anderen Berufsgruppen, die in betrügerische Geschäftspraktiken eingebunden sein könnten.
2. Anforderungen an die Beweiswürdigung
Die Entscheidung betont, dass eine isolierte Betrachtung von Indizien unzureichend ist. Dies stellt hohe Anforderungen an die Argumentation und Urteilsbegründung der Gerichte und unterstreicht die Notwendigkeit, den Gesamtkontext zu berücksichtigen.
3. Abgrenzung zu bisherigen Entscheidungen
Das Urteil steht in einer Reihe von Entscheidungen, die sich mit der Abgrenzung zwischen strafbarer Beihilfe und neutralem berufstypischem Verhalten befassen. Der BGH betonte erneut, dass allein die Berufsausübung eine Haftung nicht ausschließt, wenn objektive Indizien auf eine Solidarisierung mit dem Haupttäter hinweisen.
IV. Fazit und Ausblick
Das Urteil des BGH setzt klare Maßstäbe für die Beurteilung von Beihilfehandlungen im Zivilrecht und betont die Bedeutung einer umfassenden Beweiswürdigung. Es bietet wichtige Leitlinien für die Praxis und wird voraussichtlich auch in der Fachliteratur intensiv diskutiert werden. Für die betroffenen Berufsgruppen zeigt das Urteil die Notwendigkeit auf, die Grenzen zulässiger beruflicher Handlungen klar zu beachten, um Haftungsrisiken zu minimieren.
moreResultsText


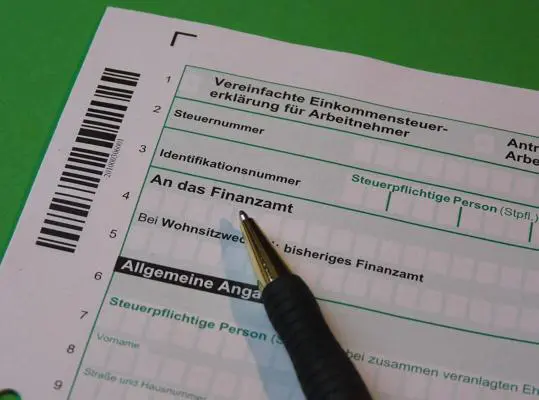


Annotations
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.
(1) Das Gericht hat unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlungen und des Ergebnisses einer etwaigen Beweisaufnahme nach freier Überzeugung zu entscheiden, ob eine tatsächliche Behauptung für wahr oder für nicht wahr zu erachten sei. In dem Urteil sind die Gründe anzugeben, die für die richterliche Überzeugung leitend gewesen sind.
(2) An gesetzliche Beweisregeln ist das Gericht nur in den durch dieses Gesetz bezeichneten Fällen gebunden.

