Urteils-Kommentar zu Bundesgerichtshof Urteil, 10. Nov. 2021 - 2 StR 185/20 von Dirk Streifler
Bundesgerichtshof Urteil, 10. Nov. 2021 - 2 StR 185/20
Bundesgerichtshof
Urteil vom 10. Nov. 2021
Az.: 2 StR 185/20
Tenor
1. Auf die Revisionen der Staatsanwaltschaft wird das Urteil des Landgerichts Köln vom 22. November 2019, soweit es die Angeklagten A. und R. G. betrifft, im gesamten Rechtsfolgenausspruch mit den jeweils zugehörigen Feststellungen aufgehoben; hinsichtlich des Angeklagten A. wird auch die Entscheidung, ihn für erlittene Untersuchungshaft zu entschädigen, aufgehoben.
2. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsmittel, an eine andere Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Gründe
Das Landgericht hat die Angeklagten A. und R. G. jeweils wegen Geldwäsche in der Tatbestandsvariante des Verschleierns gemäß § 261 Abs. 1 Satz 1 Var. 2, Satz 2 Nr. 4a StGB aF schuldig gesprochen, den Angeklagten A. in zwei Fällen und den Angeklagten R. G. in vier Fällen. Den Angeklagten A. hat es zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und einem Monat verurteilt und angeordnet, dass er für die erlittene Untersuchungshaft zu entschädigen ist, soweit diese die Gesamtfreiheitsstrafe übersteigt. Den zur Tatzeit heranwachsenden Angeklagten R. G. hat es verwarnt und ihm auferlegt, binnen sechs Monaten nach Rechtskraft des Urteils 100 Stunden gemeinnützige Arbeit nach näherer Weisung der Jugendgerichtshilfe zu leisten; zudem hat das Landgericht seinen 811,2522/10.000 Miteigentumsanteil an dem näher bezeichneten Grundstück in der straße in L. eingezogen.
Gegen dieses Urteil richten sich die zu Ungunsten der Angeklagten eingelegten, auf die Rüge der Verletzung materiellen Rechts gestützten und jeweils auf den Rechtsfolgenausspruch beschränkten Revisionen der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft beanstandet hinsichtlich des Angeklagten A. die Nichteinziehung des Grundstücks Straße in L. (Fall II. 1 der Anklage) sowie den gesamten Strafausspruch. Hinsichtlich des Angeklagten R. G. beanstandet sie die Nichteinziehung seiner Miteigentumsanteile an den Grundstücken straße in L. (Fall IV. 2 der Anklage) und straße in N. (Fall IV. 3 der Anklage) sowie des Fahrzeugs Porsche 993 Turbo (Fall IV. 4 der Anklage). Die Einziehung des Miteigentumsanteils an dem näher bezeichneten Grundstück in der straße in L. (Fall IV. 1 der Anklage) nimmt die Revision ebenso wie die gegen den Angeklagten R. G. verhängte jugendrichterliche Maßnahme von ihrem Rechtsmittelangriff aus. Die Rechtsmittel führen zur Aufhebung der gesamten Rechtsfolgenaussprüche.
I.
Das Landgericht hat im Wesentlichen folgende Feststellungen und Wertungen getroffen:
1. Der nichtrevidierende M. G. , Vater des Angeklagten R. G. , ging keiner legalen Erwerbstätigkeit nach und bestritt seinen Lebensunterhalt seit spätestens dem Jahr 2000 durch (gewerbsmäßige) Betrugstaten. Er beging die Taten aus dem Clan-Umfeld seiner in L. ansässigen Roma-Großfamilie und wurde mehrfach u.a. wegen Betruges, gewerbsmäßigen Betruges und gewerbsmäßigen Bandenbetruges zu Geld- und Freiheitsstrafen verurteilt. Er hat dabei mehrfach erhebliche Schäden von bis zu 233.000 EUR verursacht.
Im hiesigen Verfahren wurde er wegen falscher Versicherung an Eides statt und Betruges in 21 Fällen unter Einbeziehung einer früheren Freiheitsstrafe zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren rechtskräftig verurteilt; daneben wurde ein Geldbetrag in Höhe von 912.724,00 EUR gemäß § 73c StGB eingezogen. Dem lag zugrunde, dass M. G. im April 2017 gegenüber einer Obergerichtsvollzieherin bei dem Amtsgericht Leverkusen eine Vermögensauskunft nach § 802c ZPO abgegeben und deren Richtigkeit und Vollständigkeit an Eides Statt versichert hatte. Entgegen seiner Auskunft, im Haushalt seiner Eltern zu leben und keinerlei relevantes Eigentum an beweglichem Vermögen zu haben, lebte er mit seiner Familie in einer 201 qm großen Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses in der Straße in L. . Diese Wohnung hatte er in den Jahren 2014 und 2015 nach eigenen Vorstellungen und auf eigene Kosten hochwertig ausgestattet (u.a. mit einem elektrischen Hoftor, einer Videoüberwachung des Außenbereichs, einer teuren Einbauküche, einem Bad mit einer herzförmigen Badewanne für zwei Personen, drei Duschbereichen mit goldfarbenen Armaturen, einer Sauna, einem mit goldglänzenden Mosaikfliesen gestaltetem Barbereich mit Bierzapfanlage) und luxuriös möbliert. Überdies besaß er teure Uhren sowie Schmuck, und ihm stand mindestens ein hochpreisiges Fahrzeug des Typs Porsche Turbo S Cabriolet zur Verfügung.
Den abgeurteilten 21 Betrugstaten lag zugrunde, dass er ein älteres, vermögendes Ehepaar bei seinem Vorhaben, eine Immobilie zu verkaufen, "beraten" und den leichtgläubigen Ehemann im Verlauf des Jahres 2017 durch Vortäuschen von vermeintlich kurzfristigen finanziellen Schwierigkeiten und ohne Rückzahlungsabsicht zur Überlassung erheblicher Bargeldsummen, Schmuck und Gold veranlasst hatte; der Gesamtschaden betrug 938.024,00 EUR.
2. Der wegen Geldwäsche in drei Fällen rechtskräftig verurteilte Mitangeklagte R. erwarb zwischen 2012 und 2015 jeweils auf Geheiß des M. G. als Scheinkäufer für diesen zwei hochpreisige Fahrzeuge (Porsche 991 Carrera S Cabriolet, Porsche Turbo S Cabriolet). Diese - sowie ein weiteres Fahrzeug Mercedes SLS AMG - wurden jeweils auf den Mitangeklagten R. zugelassen, der die Darlehensraten zur Finanzierung sowie Versicherungs- und Reparaturkosten von seinem Konto bzw. dem Konto einer gutgläubigen Nachbarin beglich. Die notwendigen Geldbeträge hatte er jeweils vorab in bar von M. G. erhalten, der die Fahrzeuge auch ausschließlich nutzte. Die Geldmittel stammten zum erheblichen Teil aus dessen gewerbsmäßigen Betrugstaten, was R. ebenso billigend in Kauf nahm, wie dass mit Einspeisung der Gelder in den Wirtschaftskreislauf ihre wahre, illegale Herkunft verschleiert wurde.
3. Der Angeklagte A. , Eigentümer mehrerer Immobilien und mit M. G. bereits länger aus dem Orientteppichhandel bekannt, wollte im Jahr 2014 sein Immobilienportfolio erweitern. Hierzu nahm er von D. G. , dem Bruder des M. G. , ein Darlehen über eine Million Euro auf. Um sich bei der Bewirtschaftung seiner Immobilien nicht länger persönlich mit Mietern und Handwerkern auseinandersetzen zu müssen, vereinbarte er mit M. G. eine Arbeitsteilung dergestalt, dass dieser ihm Immobilien andienen und anschließend deren Verwaltung übernehmen sollte, wohingegen dem Angeklagten A. Kauf und Finanzierung oblagen. Die erwirtschafteten Mietüberschüsse sollten abzüglich der Verluste hälftig geteilt werden.
a) Die erste Immobilie, die nach diesem Muster erworben wurde, war ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus in der Straße in L. (Fall II. 1 der Anklage). Im Erdgeschoss befand sich ein leerstehender S. -Markt, der nicht zu vermieten war. Der damalige Eigentümer, der Zeuge K. , vereinbarte daher zum Jahresende 2013/14 mit M. G. , dass dieser das Erdgeschoss mit 201 qm als Wohnung für seine Familie anmieten und eine vom Zeugen K. beauftragte Architektin den Umbau nach den Vorstellungen M. G. s planen sollte. Nach Vermittlung M. G. s verkauften die Eheleute K. die Immobilie an den Angeklagten A. und unterzeichneten am 10. Dezember 2014 den notariellen Kaufvertrag. Die Kaufnebenkosten und die monatlichen Raten zur Tilgung des ihm von der Sparkasse L. gewährten Darlehens leistete der Angeklagte A. von seinen Konten.
Bereits zuvor hatte der Angeklagte A. mit M. G. vereinbart, dass dieser in Eigenregie und auf eigene Kosten die begonnenen Umbaumaßnahmen des ehemaligen Drogeriemarktes in Wohnraum fortführen und im Gegenzug dafür zehn Jahre mietfrei in der Erdgeschosswohnung wohnen dürfe. Zusätzlich stellte ihm der Angeklagte A. dafür ein zinsloses Darlehen über 150.000 EUR zur Verfügung.
Im Zuge der weiteren Baumaßnahmen wurden auf Kosten des Angeklagten A. die Fassade gestrichen, die Balkonbrüstungen erneuert und eine Wohnung im 2. Obergeschoss renoviert. M. G. übernahm vereinbarungsgemäß die Kosten für den luxuriösen Umbau der Erdgeschosswohnung, die er 2015 mit seiner Familie bezog. Spätestens ab 2017 veranlasste M. G. mit Zustimmung des A. auch den Umbau der 1. Etage auf seine (G. s) Kosten, bei dem zwei Appartements in eine großzügige Wohnung umgebaut wurden, in welche dann sein Sohn, der Angeklagte R. G. , mit Partnerin und Kindern einzog. Insgesamt investierte M. G. zusätzlich zu dem ihm vom Angeklagten A. eingeräumten Darlehen aus eigenem Vermögen Bargeld "im mindestens unteren sechsstelligen EUR-Bereich", was A. bewusst war.
Ein erheblicher Teil der in den Umbau der Wohnungen investierten Barmittel stammte aus gewerbsmäßig von M. G. begangenen Betrugstaten, was A. - ohne Kenntnis konkreter Hintergründe - ebenso billigend in Kauf nahm, wie den Umstand, dass mit Einspeisung der Gelder in den Wirtschaftskreislauf ihre wahre, illegale Herkunft verschleiert wurde; eine legale Herkunft der investierten Gelder schloss er aus.
b) Am 19. April 2015 fiel M. G. während einer Autobahnfahrt der vom Zeugen S. geführte Mercedes SLS AMG auf (Fall II. 6 der Anklage). Er überholte diesen und veranlasste ihn durch Handzeichen zum Anhalten auf dem Standstreifen, um mit ihm ein Verkaufsgespräch über den Sportwagen zu führen. Der Zeuge S. war nicht abgeneigt, musste sich jedoch zunächst mit dem leasinggebenden Autohaus in Verbindung setzen. Währenddessen diente M. G. dem Angeklagten A. das Fahrzeug als Kapitalanlage an. Einen von A. unterzeichneten Kaufvertrag legte M. G. am Folgetag dem Zeugen S. vor und übergab ihm eine Anzahlung von 1.000 EUR in bar aus eigenem Vermögen. Den Restkaufpreis in Höhe von 124.000 EUR überwies A. in zwei Raten zu 20.000 EUR und 100.000 EUR von seinem eigenen Konto auf das Konto des Zeugen S. ; die restlichen 5.000 EUR übergab er M. G. zur Weitergabe an den Verkäufer bzw. in Höhe von 1.000 EUR zum Ausgleich der von ihm ausgelegten Anzahlung. M. G. behielt den Gesamtbetrag für sich.
Als A. nach dem überstürzten Ankauf erkannte, dass er das Fahrzeug im Alltag nicht würde nutzen können, sagte er M. G. eine Nutzung unter der Voraussetzung der vollständigen Abzahlung des Kaufpreises zu. Die Bitte G. s, das Fahrzeug auf A. zuzulassen, lehnte dieser ab; letztlich willigte der Mitangeklagte R. ein, das Fahrzeug unter der Bedingung der vollständigen Kostenübernahme durch M. G. zum Schein auf sich zuzulassen. A. gestattete diese Scheinzulassung unter der Bedingung einer Vollkaskoversicherung.
Jedenfalls ein erheblicher Anteil der Anzahlung von 1.000 EUR stammte aus gewerbsmäßig von M. G. begangenen Betrugstaten.
c) Das Landgericht hat den Angeklagten A. der Geldwäsche in zwei Fällen schuldig gesprochen. Eine Einziehung der Immobilie hat es aus Gründen der Verhältnismäßigkeit abgelehnt; in die Immobilie seien - im Verhältnis zum aktuellen Verkehrswert zum Zeitpunkt der Entscheidung - nur 8,5 % Investitionen mit bemakelten Mitteln erfolgt. Das mache zwar die gesamte Immobilie zu einem geldwäschetauglichen Tatobjekt. Eine Einziehung des gesamten Immobilienobjekts stünde jedoch außer Verhältnis zur begangenen Tat. Eine Einziehung des Fahrzeugs scheitere bereits an der zu geringen Bemakelungsquote von weniger als 1 %.
Soweit die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten A. auch im Zusammenhang mit vier weiteren Immobilienkäufen Geldwäschehandlungen vorgeworfen hatte (Fälle II. 2-5 der Anklage), ist das Verfahren gemäß § 154 Abs. 2 StPO vorläufig eingestellt worden.
4. Ab dem Jahr 2016 setzte M. G. seinen heranwachsenden Sohn, den Angeklagten R. G. , für den Erwerb von drei Immobilien sowie einem Kraftfahrzeug ein. Während R. G. als Erwerber auftrat und Eigentümer wurde, organisierte M. G. die Finanzierung und veranlasste über seinen Sohn die Einspeisung von Bargeld, das aus seinen gewerbsmäßigen Betrugstaten stammte, in den Wirtschaftskreislauf. R. G. nahm dies ebenso billigend in Kauf, wie dass dadurch die wahre, illegale Herkunft des Geldes verschleiert wurde; eine legale Herkunft der ihm zur Verfügung gestellten Gelder schloss er - ohne Kenntnis konkreter Hintergründe - aus.
a) Bei der Zwangsversteigerung einer 3-Zimmer-Eigentumswohnung in der straße in L. (Fall IV. 1 der Anklage) stellte M. G. seinem Sohn die zur Teilnahme am Bieterverfahren erforderliche Sicherheitsleistung in Höhe von 13.400 EUR in bar zur Verfügung. Zu der Versteigerung am 14. März 2016 erschien R. G. in Begleitung eines älteren Familienangehörigen, der ihn zur Abgabe von Geboten anhielt, bis ihm für 136.000 EUR der Zuschlag erteilt wurde.
Nachdem das Anliegen, den Kaufpreis in bar entrichten zu dürfen, von der die Versteigerung leitenden Rechtspflegerin abgelehnt worden war, veranlasste M. G. den Zeugen P. , dem Angeklagten R. G. ein Darlehen in Höhe des Kaufpreises zu gewähren. Die Verhandlungen führte M. G. , R. G. erschien nur zur Leistung der Unterschrift. M. G. sagte dem Zeugen P. die Eintragung einer Grundschuld als Sicherung sowie die Tilgung der Darlehensverbindlichkeiten aus eigenen Mitteln zu; beides erfolgte nicht.
Der Zeuge P. überwies am 10. Juni 2016 123.801,01 EUR auf das Konto des Verkäufers. Der Angeklagte R. G. überwies von seinem Konto bei der Santander Bank am 1. April 2016 Gebühren in Höhe von 633,00 EUR an die Justizkasse Nordrhein-Westfalen sowie am 28. Juni 2016 Grunderwerbssteuern in Höhe von 9.016,00 EUR an das Finanzamt Düsseldorf. Um für die nötige Deckung zu sorgen, zahlte er jeweils unmittelbar vor den Überweisungen ihm von seinem Vater überlassenes Bargeld auf dieses Konto ein. Am 17. August 2016 wurde R. G. als Eigentümer im Grundbuch eingetragen.
b) Den Erwerb der Eigentumswohnung in der straße in L. (Fall IV. 2 der Anklage), einer 4-Zimmer-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus für einen Kaufpreis in Höhe von 100.000 EUR, vermittelte der Großvater des Angeklagten R. G. zwischen dem Verkäufer und M. G. . Dieser veranlasste erneut den Erwerb über seinen Sohn, so dass es am 28. September 2016 zur Unterzeichnung des notariellen Kaufvertrags durch R. G. und den Verkäufer kam.
Zur Finanzierung bat M. G. zunächst den Zeugen P. , für den Angeklagten R. G. bei der Sparkasse L. als Fürsprecher einen Finanzierungskredit zu erwirken. Als die Bank ablehnte, erklärte sich der Zeuge P. erneut bereit, R. G. ein weiteres Darlehen zu gewähren. M. G. sicherte ihm die Rückzahlung nach Weiterverkauf der Immobilie zu. Am 20. Mai 2017 unterzeichnete R. G. den zwischen seinem Vater und dem Zeugen P. ausgehandelten Darlehensvertrag, ohne ihn zu lesen. Der Zeuge P. überwies sodann den Kaufpreis an den Verkäufer; Zahlungen auf das Darlehen erhielt er nicht.
Am 21. November 2017 wurde R. G. als neuer Eigentümer in das Grundbuch eingetragen. Für den Zeugen P. wurden Grundschulden in Höhe von 100.000 EUR bestellt.
Die Kaufnebenkosten in Höhe von insgesamt 7.572,39 EUR wurden über den Angeklagten R. G. aus dem Vermögen des M. G. wie folgt beglichen: Rechnungen der Justizkasse Nordrhein-Westfalen in Höhe von 591,00 EUR wurden in bar gezahlt. Von seinem Konto bei der Santander Bank überwies der Angeklagte R. G. am 26. Mai 2017 an das Finanzamt Leverkusen 6.919,39 EUR Grunderwerbssteuer sowie am 8. Juni 2017 weitere 62,00 EUR an die Justizkasse Nordrhein-Westfalen. Um für die nötige Deckung zu sorgen, zahlte er jeweils unmittelbar vor den Überweisungen ihm von seinem Vater überlassenes Bargeld auf dieses Konto ein.
c) Die zwischenzeitlich verstorbene Zeugin B. war Eigentümerin einer Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Gebäudekomplex der straße in N. (Fall IV. 3 der Anklage). Ende 2017 befand sie sich in einer finanziellen und persönlichen Notlage und wollte ihre Wohnung für 30.000 EUR schnellstmöglich verkaufen. M. G. , der über Dritte von der Verkaufsabsicht erfahren hatte, erkannte, dass der aufgerufene Kaufpreis weit unter dem tatsächlichen Wert der Wohnung von ca. 100.000 EUR lag. Anlässlich eines vereinbarten Besichtigungstermins drängte er auf schnellen Abschluss des Vertrages und vereinbarte mit der Zeugin eine Zahlung dergestalt, dass 5.000 EUR nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages in bar übergeben und die weiteren 25.000 EUR anschließend überwiesen werden sollten.
Zum Beurkundungstermin erschien erstmals der Angeklagte R. G. , der zur Überraschung der Zeugin B. den Kaufvertrag unterzeichnete. Vereinbarungsgemäß übergab M. G. der Zeugin im Anschluss 5.000 EUR. Ob auch der weitere Kaufpreis entrichtet wurde, vermochte die Strafkammer nicht festzustellen; gleichwohl wurde R. G. als Eigentümer im Grundbuch eingetragen.
Folgende Kaufnebenkosten in Höhe von insgesamt 2.182,50 EUR wurden über den Angeklagten R. G. aus dem Vermögen des M. G. beglichen: Rechnungen der Justizkasse Nordrhein-Westfalen in Höhe von 160,00 EUR wurden in bar gezahlt. Von seinem Konto bei der Santander Bank überwies der Angeklagte R. G. am 30. Januar 2018 an das Finanzamt Leverkusen 1.950,00 EUR Grunderwerbssteuer sowie am 27. Dezember 2018 weitere 72,50 EUR an die Justizkasse Nordrhein-Westfalen. Um für die nötige Deckung zu sorgen, zahlte er jeweils unmittelbar vor den Überweisungen ihm von seinem Vater überlassenes Bargeld auf dieses Konto ein.
d) Im Oktober 2017 stieß M. G. in einem Internetportal auf eine Verkaufsanzeige eines Berliner Porschehändlers, der einen Porsche 993 Turbo (Fall IV. 4 der Anklage) für 96.000 EUR anbot. Nach Begutachtung erklärte M. G. , dass sein Sohn R. G. das Fahrzeug erwerben werde. Als der Berliner Händler nicht gewillt war, an eine Privatperson zu veräußern, überzeugte M. G. einen Autohändler aus Leverkusen, den Kauf gegen eine Provision von 1.000 EUR für ihn abzuwickeln; den Vorschlag M. G. s, den Kaufpreis und die Provision in bar anzunehmen, lehnte er jedoch ab.
Zur Finanzierung veranlasste M. G. erneut den Zeugen P. , seinem Sohn R. G. ein Darlehen zu gewähren. Nach Unterzeichnung des Darlehensvertrages am 18. Oktober 2017 überwies der Zeuge P. den Kaufpreis. Das Darlehen sollte R. G. in monatlichen Raten von 500,00 EUR zurückzahlen. Zur Sicherung der Forderung erhielt der Zeuge P. den Fahrzeugbrief ausgehändigt und im Grundbuch der Immobilie straße in L. wurde eine weitere Grundschuld in Höhe von 100.000 EUR eingetragen.
Am 19. Oktober 2017 unterzeichnete R. G. den Kaufvertrag über 97.000 EUR; davon überwies der Leverkusener Autohändler 96.000 EUR an den Berliner Porschehändler. Nach Abholung des Porsches ließ M. G. das Interieur nach seinen Vorstellungen verändern; dafür wandte er mindestens 3.300 EUR in bar auf.
Zur Tilgung des Darlehens überwies R. G. zwischen dem 8. November und dem 9. Dezember 2017 insgesamt 5.000 EUR von seinem Konto bei der Santander Bank sowie am 9. Februar 2018 weitere 1.000 EUR von seinem Konto bei der Deutschen Bank auf das Konto des Zeugen P. . Sämtliche Geldmittel hatte er zuvor von seinem Vater in bar erhalten und auf seine Konten eingezahlt. Auch M. G. übergab dem Zeugen P. Bargeld zur Begleichung des Darlehens; eine konkrete Höhe dieser Zahlungen konnte nicht festgestellt werden. Der Wagen wurde im März 2018 in der zu der Straße zugehörigen Garage beschlagnahmt, ohne bis dahin zugelassen worden zu sein.
e) Das Landgericht hat den Angeklagten R. G. der Geldwäsche in vier Fällen schuldig gesprochen und die Einziehung seines Miteigentumsanteils an dem näher bezeichneten Grundstück in der straße in L. angeordnet. Die Einziehung der Miteigentumsanteile an den beiden anderen Immobilien hat die Strafkammer aus Gründen der Verhältnismäßigkeit abgelehnt. Bei allen Immobilien handele es sich grundsätzlich um geldwäschetaugliche Tatobjekte. Die Bemakelungsquoten betrügen bezogen auf den Zeitpunkt der Hauptverhandlung 13,56 % für das Objekt straße in L. , 6,31 % für das Objekt straße in L. und 7,11 % für das Objekt straße in N. . Eine Einziehung der beiden letztgenannten Objekte stünde - vor allem angesichts der niedrigen Bemakelungsquote - außer Verhältnis zu den begangenen Taten. Der Einziehung des Porsches stehe die zu geringe Bemakelungsquote von 3,4 % entgegen.
II.
Die Revisionen der Staatsanwaltschaft sind jeweils auf den Rechtsfolgenausspruch beschränkt. Diese Beschränkung ist wirksam, da keine Umstände vorliegen, aus denen sich ausnahmsweise eine untrennbare Verknüpfung von Schuld- und Straffrage ergibt (vgl. Senat, Urteil vom 11. September 2019 - 2 StR 563/18, juris Rn. 8).
Hingegen ist die weitere Beschränkung innerhalb der Rechtsfolgenaussprüche unwirksam. Wegen des untrennbaren Zusammenhangs und der wechselseitigen Beeinflussung können die Bemessung der Strafe bzw. der jugendrichterlichen Maßnahmen und die (Nicht-)Einziehung von Vermögensgegenständen nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Die Einziehung nach § 74 Abs. 1 und 3 StGB hat den Charakter einer Nebenstrafe und stellt damit eine Strafzumessungsentscheidung dar. Wird dem Täter auf diese Weise ein ihm gehörender Gegenstand von nicht unerheblichem Wert entzogen, so ist dies als ein bestimmender Gesichtspunkt sowohl bei der Bemessung der zu verhängenden Einzelstrafen als auch bei der Gesamtstrafe zu berücksichtigen (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Juni 2021 - 4 StR 523/20, wistra 2021, 441).
Geht es - wie hier - um die Einziehung von Tatobjekten nach § 74 Abs. 2 StGB ist zu differenzieren: Handelt es sich bei den eingezogenen Gegenständen - wie z. B. bei Waffen und Munition oder Betäubungsmitteln - um Gegenstände, die der Täter überhaupt nicht besitzen durfte, weil bereits der Besitz selbst unter Strafe steht, besteht zu einer mildernden Berücksichtigung der Einziehung kein Anlass, denn der Täter erleidet hierdurch keinen ausgleichsfähigen Nachteil (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Juni 2021 - 4 StR 523/20, wistra 2021, 441 mwN). Gleiches gilt, wenn der Besitz aus einer strafbaren Handlung, z. B. einer Geldwäsche, herrührt und das Tatobjekt ausnahmslos mit inkriminierten Mitteln erworben wurde (vgl. Schäfer/Sander/van Gemmeren, Praxis der Strafzumessung, 6. Aufl. Rn. 369). Anderes gilt hingegen, wenn der nach § 74 Abs. 2 StGB einzuziehende Gegenstand - wie möglicherweise hier - mit Bargeld aus einer Geldwäschevortat und legal erworbenem Vermögen finanziert wurde. In Fällen der Mischfinanzierung wird dem Täter nämlich ein Gegenstand entzogen, dessen Wert den deliktisch erlangten Vermögenszuwachs übersteigt. Dies ist ein bei der Strafzumessung zu berücksichtigender Umstand.
1. Die Beweiswürdigung zu den Fällen II. 1, II. 6 sowie IV. 1-4 der Anklage hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand, soweit sich die Strafkammer nicht davon zu überzeugen vermochte, dass die Angeklagten A. und R. G. in einem größeren als dem festgestellten Umfang inkriminierte Gelder des M. G. in die Immobilien und Fahrzeuge fließen ließen.
a) Die Beweiswürdigung ist Sache des Tatgerichts, § 261 StPO. Ihm obliegt es, das Ergebnis der Hauptverhandlung festzustellen und zu würdigen. Seine Schlussfolgerungen brauchen nicht zwingend zu sein, es genügt, dass sie möglich sind (st. Rspr.; vgl. Senat, Urteil vom 20. November 2019 - 2 StR 554/18, juris Rn. 24; BGH, Urteil vom 12. Februar 2015 - 4 StR 420/14, NStZ-RR 2015, 148 mwN). Es kommt nicht darauf an, ob das Revisionsgericht angefallene Erkenntnisse anders gewürdigt oder Zweifel überwunden hätte. Vielmehr hat es die tatgerichtliche Überzeugungsbildung selbst dann hinzunehmen, wenn eine andere Beurteilung nähergelegen hätte oder überzeugender gewesen wäre (vgl. Senat, Urteil vom 26. August 2020 - 2 StR 587/19, juris Rn. 5 mwN). Die revisionsgerichtliche Prüfung beschränkt sich allein darauf, ob dem Tatgericht Rechtsfehler unterlaufen sind. Dies ist in sachlich-rechtlicher Hinsicht der Fall, wenn die Beweiswürdigung widersprüchlich, unklar oder lückenhaft ist oder gegen die Denkgesetze oder gesicherten Erfahrungssätze verstößt oder wenn an die zur Verurteilung erforderliche Gewissheit überspannte Anforderungen gestellt werden (vgl. Senat, Urteil vom 5. April 2017 - 2 StR 593/16, juris Rn. 11). Das Urteil muss erkennen lassen, dass das Tatgericht solche Umstände, die geeignet sind, die Entscheidung zu Gunsten oder zu Ungunsten des Angeklagten zu beeinflussen, erkannt und in seine Überlegungen einbezogen hat. Aus den Urteilsgründen muss sich ferner ergeben, dass die einzelnen Beweisergebnisse nicht nur isoliert gewertet, sondern in eine umfassende Gesamtwürdigung eingestellt wurden (st. Rspr.; vgl. nur Senat, Urteil vom 26. August 2020 - 2 StR 587/19, juris Rn. 5 mwN).
b) Gemessen hieran begegnet die Beweiswürdigung zum Umfang der im Übrigen rechtsfehlerfrei festgestellten Geldwäschehandlungen der Angeklagten durchgreifenden rechtlichen Bedenken.
aa) Durchgreifend rechtsfehlerhaft ist bereits die Zugrundelegung eines Betrages von (nur) 100.000 EUR als Anteil inkriminierter Gelder im Fall II. 1 der Anklage.
Ausgehend von rund 635.000,00 EUR als geschätzter Maximalgröße für den Umbau auf Basis eines Sachverständigengutachtens hat das Landgericht "die Vornahme eines Abschlags von 50 %" für "erforderlich, aber auch ausreichend" erachtet. Bei Abzug eines weiteren Betrages von 150.000 EUR wegen des Darlehens, das der Angeklagte A. dem M. G. für die Umbaumaßnahmen gewährt hat, ergibt sich rechnerisch ein Betrag von 167.500 EUR, den das Landgericht mit "ein mindestens im unteren sechsstelligen EUR-Bereich anzusiedelnder Geldbetrag" zusammengefasst hat. Im Rahmen seiner Einziehungsentscheidung hat es dann hingegen nur einen Betrag in Höhe von 100.000 EUR zugrunde gelegt. Der nicht näher begründete (weitere) Abschlag in Höhe von 67.500 EUR steht im Widerspruch zum bereits vorgenommenen und für ausreichend erachteten Sicherheitsabschlag.
bb) Im Übrigen vermochte sich das Landgericht nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nur davon zu überzeugen, dass in die Immobilie " Straße " (Fall II. 1 der Anklage) und in den Mercedes SLS AMG (Fall II. 6 der Anklage) inkriminierte Gelder aus dem Vermögen M. G. s lediglich in Höhe des festgestellten Umfangs geflossen sind. Die Einlassung des Angeklagten A. , keine weitere finanzielle Unterstützung von M. G. erhalten zu haben, hat es im Wesentlichen als nicht zu widerlegen erachtet.
Insoweit ist die Beweiswürdigung widersprüchlich, lücken- und damit rechtsfehlerhaft. Einlassungen des Angeklagten, für deren Richtigkeit oder Unrichtigkeit es keine objektiven Anhaltspunkte gibt, sind nicht ohne weiteres als "unwiderlegbar" hinzunehmen und den Feststellungen zu Grunde zu legen. Das Tatgericht hat vielmehr auf der Grundlage des gesamten Beweisergebnisses zu entscheiden, ob derartige Angaben geeignet sind, seine Überzeugungsbildung zu beeinflussen. Es ist weder im Hinblick auf den Zweifelssatz noch sonst geboten, zu Gunsten des Angeklagten Geschehensabläufe zu unterstellen, für deren Vorliegen es außer den nicht widerlegbaren, aber auch durch nichts gestützten Angaben des Angeklagten keine Anhaltspunkte gibt (vgl. Senat, Urteil vom 22. Mai 2019 - 2 StR 353/18, juris Rn. 40; BGH, Urteil vom 18. August 2009 - 1 StR 107/09, NStZ-RR 2010, 85, 86).
Zwar hat die Strafkammer zutreffend die Vollfinanzierung der Immobilie durch die Sparkasse L. gesehen und auch die jeweiligen Einwirkungsmöglichkeiten des M. G. auf Immobilie und Fahrzeug in seine Überlegungen einbezogen. Soweit sie indes im Übrigen maßgeblich darauf abstellt, dass weitere als die festgestellten Geldflüsse aus dem Vermögen M. G. s sowie konkrete Anhaltspunkte für die Übergabe von Bargeldern oder Kontoverdichtungen des A. nicht festzustellen seien, greift die Beweiswürdigung zu kurz.
So bleiben etwa Herkunft, Grund, Zweck und konkrete Verwendung des von D. G. gewährten Darlehens unerörtert. Nach den Feststellungen verfügte der Angeklagte A. über Geldmittel in beträchtlichem Umfang und war auf Darlehen Dritter nicht ohne weiteres angewiesen. Insbesondere, weil es sich bei dem Darlehensgeber um den Bruder M. G. s handelte, durfte die naheliegende Möglichkeit eines Scheinvertrages mit dem Ziel, dem Angeklagten A. durch das Darlehen (inkriminierte) Geldmittel des M. G. zur Finanzierung der Immobilie verdeckt zur Verfügung zu stellen, nicht unerörtert bleiben.
Als nicht frei von Widersprüchen erweist es sich, dem Angeklagten A. zuzugestehen, ein lebens- und kaufmännisch erfahrener Geschäftsmann zu sein, dann aber ohne weitere Erörterung seiner Einlassung zu folgen, er habe M. G. ohne jede Sicherheit und unter Zusicherung von zehn Jahren mietfreien Wohnens zinslose Darlehen im sechsstelligen Bereich zur Vornahme eines sehr individuellen Umbaus gewährt.
Schließlich fehlt es auch an einer umfassenden Gesamtwürdigung, die sich mit der Möglichkeit einer Strohmanntätigkeit des Angeklagten A. hinreichend auseinandersetzt. Die dafür sprechenden und rechtsfehlerfrei festgestellten Indizien, wie etwa das Auftreten M. G. s als Eigentümer nach außen und die Bareinzahlungen auf das Konto von A. in Höhe von über zwei Millionen Euro, hat die Strafkammer nicht in eine Gesamtbetrachtung eingestellt.
Die Beweiswürdigung beschränkt sich vielmehr darauf, einzelne Indizien herauszugreifen und ihnen in isolierter Betrachtung einen Beweiswert abzusprechen.
cc) Auch hinsichtlich des Angeklagten R. G. vermochte sich das Landgericht lediglich davon zu überzeugen, dass beim Erwerb der drei Immobilien (Fälle IV. 1-3 der Anklage) nur die Kaufnebenkosten, im Fall IV. 1 zusätzlich die zur Teilnahme am Bieterverfahren erforderliche Sicherheitsleistung, sowie nach Erwerb des Porsche (Fall IV. 4 der Anklage) nur 3.300 EUR für Innenausstattung aus inkriminierten Geldern des M. G. investiert worden sind.
Die Beweiswürdigung erweist sich hier insbesondere, was die Rolle des Zeugen P. als Darlehensgeber angelangt, als lückenhaft. Der Zeuge P. will sich trotz abredewidrigen Verhaltens M. G. s, der angesichts vollständig fehlender Bonität seines Sohnes jeweils die Tilgung zusagte und sich damit wiederum als wirtschaftlicher Eigentümer gerierte, in den Fällen IV. 1, IV. 2 und IV. 4 der Anklage immer wieder als maßgeblicher Darlehensgeber zur Verfügung gestellt haben. Gleichermaßen ist auch die sich nach der vermeintlichen Vereinbarung über 16 Jahre erstreckende zinslose Darlehensrückzahlung des für den Erwerb des Porsche zur Verfügung gestellten Geldes kaum als übliches Geschäftsgebaren nachvollziehbar.
Deshalb hätte die Möglichkeit, dass es sich um Scheinverträge zur Verdeckung der Finanzierung mit inkriminierten Geldern M. G. s gehandelt haben könnte, der Erörterung bedurft, zumal die Strafkammer im Fall IV. 4 der Anklage ein entsprechendes Tatmuster - Begleichung von Raten zur Darlehensrückzahlung aus inkriminiertem Bargeld M. G. s über das Konto des Angeklagten R. G. - explizit festgestellt hat.
Auch dass sich die Kammer von Kosten für den Innenumbau des Porsche (u.a. Inspektion, Windschutzscheibe, Neuausstattung mit Teppichen, Lederbezügen und Felgen) im Fall IV. 4 nur in Höhe von 3.300 EUR zu überzeugen vermochte, ist nicht nachvollziehbar, denn ein Luxusumbau im festgestellten Umfang an einem solchen Fahrzeug kann mit diesem Betrag nicht abgegolten sein.
dd) Schließlich erweist sich die Beweiswürdigung insoweit als lückenhaft, als es an einer alle Fälle in den Blick nehmenden und die Geldwäschehandlungen aller Angeklagten übergreifenden Gesamtwürdigung fehlt. Dies gilt insbesondere für die in allen Fällen erkennbare systematische Vorgehensweise M. G. s, für von ihm selbst oder von Familienangehörigen genutzte Grundstücke oder Fahrzeuge Dritte als Käufer einzuschalten und die Finanzierung - sofern eine Barzahlung nicht möglich ist - über Konten Dritter vorzunehmen und mit inkriminierten Bargeldern auszugleichen. So sind die vom Landgericht hierzu festgestellten Tatsachen, wie die Barzahlungen oder entsprechende Versuche, das Vorschieben Dritter wie den eigenen Sohn oder den Mitangeklagten R. bei Erwerbsgeschäften und die in erster Linie M. G. selbst zugutekommenden Nutzungen, nicht in die Gesamtwürdigung eingeflossen.
Dies lässt besorgen, dass der Strafkammer bei der Gesamtbetrachtung der Geldwäschehandlungen der Angeklagten A. und R. G. wesentliche, für einen größeren Schuldumfang der Angeklagten sprechende Beweisanzeichen aus dem Blick geraten sind.
2. Sämtliche (Nicht-)Einziehungsentscheidungen des Landgerichts halten rechtlicher Nachprüfung ebenfalls nicht stand.
a) Noch zutreffend hat die Strafkammer (allein) § 261 Abs. 7 Satz 1 StGB aF, § 74 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 4 StGB idF vom 13. November 1998 (für die Fälle II. 1, II. 6, IV. 1 und IV. 2 der Anklage) bzw. § 261 Abs. 7 Satz 1 StGB aF, § 74 Abs. 2, Abs. 3 StGB idF vom 13. April 2017 (Fälle IV. 3 und IV. 4 der Anklage) als Rechtsgrundlage einer möglichen Einziehung herangezogen. Nach damaliger Rechtslage konnte gemäß § 261 Abs. 7 Satz 1 StGB aF der durch die Geldwäsche erlangte Vermögensgegenstand nur als Tatobjekt eingezogen werden; eine ersatzweise Einziehung als Tatertrag nach § 73, § 73c StGB war unzulässig (vgl. Senat, Beschluss vom 27. März 2019 - 2 StR 561/18, NJW 2019, 2182, 2183; BGH, Beschluss vom 27. November 2018 - 5 StR 234/18, NJW 2019, 533, 535 f.; anders nunmehr nach Neufassung des § 261 Abs. 10 Satz 3 StGB idF vom 9. März 2021, vgl. BT-Drucks. 19/24180, S. 37).
b) Rechtsfehlerhaft hat das Landgericht hingegen bei der Ermittlung der Bemakelungsquoten auf den Anteil der festgestellten inkriminierten Geldmittel gemessen am Verkehrswert der Immobilien bzw. der PKWs auf den Zeitpunkt des Urteils abgestellt. In die Berechnung einzustellen ist vielmehr der entsprechende Wert zum Tatzeitpunkt.
aa) Ausgehend von den vom Landgericht getroffenen Feststellungen stellen sämtliche verfahrensgegenständliche Immobilien der Angeklagten grundsätzlich geldwäschetaugliche Gegenstände dar. Gleiches gilt für die von den Angeklagten erworbenen Sportwagen.
Taugliches Tatobjekt der Geldwäsche ist jeder Vermögensgegenstand, der seinem Inhalt nach bewegliche oder unbewegliche Sachen oder Rechte umfasst. Dazu gehören auch solche Gegenstände, die erst durch eine Verwertung des vom Vortäter ursprünglich Erlangten als Surrogat erworben werden und daher nur mittelbar aus der Vortat stammen (vgl. Senat, Urteil vom 27. Juli 2016 - 2 StR 451/15, NStZ 2017, 28, 29; BGH, Urteil vom 15. August 2018 - 5 StR 100/18, NZWiSt 2019, 148, 150). Nach dem Willen des Gesetzgebers soll durch die Wahl des weiten Begriffs des "Herrührens" eine für Geldwäsche typische Kette von Verwertungshandlungen erfasst werden, bei denen der ursprünglich bemakelte Gegenstand gegebenenfalls mehrfach durch einen anderen oder auch durch mehrere Surrogate ersetzt wird (vgl. BT-Drucks. 12/989, S. 27; 12/3533, S. 12). Maßgeblich ist eine wirtschaftliche Betrachtungsweise, wonach Gegenstände als bemakelt anzusehen sind, wenn sie sich im Sinne eines Kausalzusammenhangs auf die Vortat zurückführen lassen und nicht wesentlich auf der Leistung Dritter beruhen (BGH, Urteil vom 15. August 2018 - 5 StR 100/18, NZWiSt 2019, 148, 150).
In Fällen der Vermischung legal erworbener und inkriminierter Geldmittel kommt es entscheidend darauf an, dass der aus Vortaten herrührende Anteil bei wirtschaftlicher Betrachtung nicht völlig unerheblich ist (ausf. dazu BGH, Urteil vom 15. August 2018 - 5 StR 100/18, NZWiSt 2019, 148, 150; Beschlüsse vom 20. Mai 2015 - 1 StR 33/15, NJW 2015, 3254, 3255; Urteil vom 12. Juli 2016 - 1 StR 595/15, NStZ 2017, 167, 169; vom 27. November 2018 - 5 StR 234/18, NJW 2019, 533, 535, und vom 10. Januar 2019 - 1 StR 311/17, NStZ-RR 2019, 145, 146). Maßgeblich für die Prüfung, ob der Anteil inkriminierter Gelder an der investierten Gesamtsumme bei wirtschaftlicher Betrachtung nicht völlig unerheblich ist, ist der Zeitpunkt der Tatbegehung (vgl. BGH, Beschluss vom 20. Mai 2015 - 1 StR 33/15, NJW 2015, 3254 f.).
bb) Gleiches gilt für die Bestimmung der Bemakelungsquote bei der Prüfung, ob es sich bei dem mit inkriminierten Geldern erworbenen Gegenstand überhaupt um ein der Einziehung zugängliches Objekt handelt. Dafür sprechen der systematische Zusammenhang und der mit der Einziehung verfolgte Zweck.
(1) Die der fakultativen Einziehung nach § 261 Abs. 7 StGB aF unterliegenden "Gegenstände, auf die sich die Straftat bezieht" sind nach der Legaldefinition des § 74 Abs. 2 StGB idF vom 13. April 2017 "Tatobjekte". Nach alter Rechtslage war dafür der Terminus "Beziehungsgegenstände" gebräuchlich, die aufgrund von Sondervorschriften wie § 261 Abs. 7 StGB aF nach Maßgabe des § 74 Abs. 2 und 3 StGB aF eingezogen werden konnten (vgl. BGH, Beschluss vom 25. März 2010 - 5 StR 518/09, NStZ-RR 2011, 338; MüKo-StGB/Joecks, 3. Aufl. § 74 Rn. 19 f.; Schönke/Schröder/Eser, StGB, 29. Aufl., § 74 Rn. 12a mit Hinweis auf die "Tatobjekt-Funktion" der Beziehungsgegenstände; ebenso BT-Drucks. 18/9525, S. 69 und SSW-StGB/Heine, 5. Aufl., § 74 Rn. 1 für die Neufassung). Eine inhaltliche Änderung war mit der Neufassung des § 74 StGB durch das Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung nicht verbunden (vgl. BT-Drucks. 18/9525, S. 69).
(2) Die Einziehung nach § 74 StGB hat hier den Charakter einer Nebenstrafe und stellt damit eine Strafzumessungsentscheidung dar (vgl. oben II.).
(a) Die Einziehung von Tatobjekten nach § 261 Abs. 7 Satz 1 StGB aF, § 74 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 4 StGB aF bzw. § 261 Abs. 7 Satz 1 StGB aF, § 74 Abs. 2, Abs. 3 StGB nF führt im Falle der Vermischung inkriminierten Vermögens mit legalem Vermögen - wie vom Gesetzgeber gewollt - dazu, dass dem Tatbeteiligten mehr als der inkriminierte Anteil entzogen wird. Dies findet seine Berechtigung darin, dass nur die konsequente Abschöpfung und Entziehung der aus illegalen Handlungen generierten Gewinne, die insbesondere Triebfeder für die organisierte Kriminalität sind, in der Lage ist, diese im Kern zu treffen und sie wirksam zu bekämpfen (vgl. BT-Drucks. 12/989, S. 26).
(b) Würde man - wie das Landgericht - für die Berechnung der Bemakelungsquote auf den Zeitpunkt der Einziehungsentscheidung abstellen, kämen einem "Geldwäscher" zwischenzeitliche Wertsteigerungen des Tatobjekts dergestalt zugute, dass eine Einziehung unter Umständen wegen Sinkens der Bemakelungsquote nicht mehr möglich wäre. Umgekehrt könnte ein zwischenzeitlicher Wertverlust des Einziehungsgegenstandes zu einer Erhöhung der Bemakelungsquote und damit zu einer Schlechterstellung eines Angeklagten führen. Um derlei Zufälligkeiten bei lange Zeit unentdeckt gebliebenen Geldwäschetaten oder bei Verzögerungen im Verfahrensablauf auszuschließen, bedarf es für die Berechnung der Bemakelungsquote des (einheitlichen) Abstellens auf den Anteil inkriminierter Gelder gemessen am Verkehrswert des Tatobjektes zum Tatzeitpunkt. Nur so wird auch der gesetzgeberischen Intention Rechnung getragen, dass Täter der Geldwäsche nicht von in den Wirtschaftskreislauf eingeschleusten Geldern profitieren und unter Umständen noch an Wertsteigerungen faktisch teilhaben sollen.
(c) Unangemessene Härten, die durch Wertveränderungen zwischen Tat- und Entscheidungszeitpunkt entstehen, können gegebenenfalls im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung nach § 74b Abs. 1 StGB aF bzw. § 74f Abs. 1 StGB nF entsprechend berücksichtigt und im Rahmen der Strafzumessung ausgeglichen werden (vgl. BGH, Beschluss vom 26. April 1983 - 1 StR 28/83, NJW 1983, 2710, 2711).
3. Das Urteil beruht auf den aufgezeigten Rechtsfehlern. Es ist nicht auszuschließen, dass das Landgericht bei rechtsfehlerfreier Beweiswürdigung zu einem höheren Schuldumfang der Angeklagten und bei zutreffender Berechnung der Bemakelungsquoten für sämtliche als Einziehungsobjekte in Betracht kommende Immobilien und PKW auch unter Berücksichtigung der gemäß § 74b Abs. 1 StGB aF bzw. § 74f Abs. 1 StGB nF vorzunehmenden Verhältnismäßigkeitsprüfung zu anderen Entscheidungen hinsichtlich der Einziehung gelangt wäre.
Ungeachtet dessen sind Strafausspruch und Einziehungsentscheidung nicht getrennt voneinander zu bewerten (vgl. oben II.).
4. Mit der Aufhebung des angefochtenen Urteils im Strafausspruch entfällt auch der Ausspruch, den Angeklagten A. für erlittene Untersuchungshaft zu entschädigen. Über diese Frage ist gemäß § 8 Abs. 1 StrEG neu zu befinden (vgl. Senat, Urteile vom 7. Februar 1990 - 2 StR 601/89, NJW 1990, 1428, 1429 und vom 18. Oktober 2017 - 2 StR 529/16, juris Rn. 39).
5. Der Senat verweist die Sache gemäß § 354 Abs. 2 Satz 1 StPO an eine Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts zurück (vgl. BGH, Urteil vom 23. September 2021 - 3 StR 38/21, juris Rn. 42 zur Zurückverweisung an den zuständigen Spezialspruchkörper). Zwischen erstinstanzlichem Urteil und der Revisionsentscheidung hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche vom 9. März 2021, gültig ab 18. März 2021 (BGBl. I, S. 327), die Zuständigkeit der Wirtschaftsstrafkammer auf Straftaten der Geldwäsche erweitert, soweit zur Beurteilung des Falles - wie hier - besondere Kenntnisse des Wirtschaftslebens erforderlich sind, § 74c Abs. 1 Satz 1 Nr. 6a) GVG. Der Vorrang der Wirtschaftsstrafkammer gegenüber der Jugendstrafkammer ergibt sich aus § 103 Abs. 2 Satz 2, § 112 JGG, wenn es sich - wie vorliegend - um ein verbundenes Verfahren gegen einen Heranwachsenden und einen Erwachsenen handelt.
6. Für die neue Hauptverhandlung weist der Senat darauf hin, dass das neu zur Entscheidung berufene Tatgericht in einem ersten Schritt die Bemakelungsquoten für sämtliche in Betracht kommende Einziehungsobjekte bezogen auf den Zeitpunkt der Einspeisung des illegalen Geldes in den Wirtschaftskreislauf zu bestimmen haben wird. Sollte die so ermittelte Bemakelungsquote eine Einziehung als Tatobjekte rechtfertigen, wird in einem zweiten Schritt zu erwägen sein, ob eine Einziehung der bemakelten Objekte mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gemäß § 74b Abs. 1 StGB aF bzw. § 74f Abs. 1 StGB nF vereinbar ist. In diesem Zusammenhang kann neben der Höhe der Bemakelungsquote und dem aktuellen Verkehrswert auch Berücksichtigung finden, wer ggf. wirtschaftlicher Eigentümer der bemakelten Immobilien bzw. PKW ist und ob die in die Tatobjekte darüber hinaus investierten Mittel "faktisch" aus strafbaren Handlungen stammen, es sich mithin um inkriminierte Gelder handelt, die über eine Darlehenskonstruktion in den Wirtschaftskreislauf eingespeist worden sind. Nach der Intention des Gesetzgebers soll mit dem weiten Begriff des "Herrührens" im § 261 StGB auch eine Kette von Verwertungshandlungen erfasst werden, die Darlehen und mit der ausgezahlten Darlehenssumme erworbene Gegenstände als gleichsam "wirtschaftliches Synallagma" umfasst (vgl. BT-Drucks. 12/3533, S. 12; MüKo-StGB/Neuheuser, 4. Aufl., § 261 Rn. 59), sich der Gegenstand mithin bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise auf die Vortat zurückführen lässt (vgl. BGH, Beschluss vom 18. Februar 2009 - 1 StR 4/09, BGHSt 53, 205, 208).
Im Übrigen wird das neue Tatgericht zu erwägen haben, dass M. G. von Anfang an plante, sich selbst den Mercedes SLS AMG (Fall II. 6 der Anklage) anzueignen, was es nahelegt, von ihm geleistete Barzahlungen an A. in Höhe von 40.000 EUR bei Ermittlung der Bemakelungsquote zu berücksichtigen.
7. Mit der Aufhebung und Zurückverweisung des Urteils in den Rechtsfolgenaussprüchen sind die von der Staatsanwaltschaft eingelegten sofortigen Beschwerden gegen die Kostenentscheidungen des angefochtenen Urteils gegenstandslos geworden (vgl. Senat, Beschluss vom 28. April 2020 - 2 StR 494/19, juris Rn. 16 mwN).
Zentrale Fragestellungen des Urteils
- Bemakelungsquote und Tatzeitpunkt: Der BGH stellte klar, dass die Bemakelungsquote anhand des Verkehrswerts des Tatobjekts zum Tatzeitpunkt und nicht zum Zeitpunkt der Einziehungsentscheidung zu bestimmen ist.
- Verhältnismäßigkeitsprüfung: Neben der Höhe der Bemakelungsquote und dem Verkehrswert kann auch der wirtschaftliche Eigentümerstatus des Tatobjekts in die Verhältnismäßigkeitsprüfung einbezogen werden.
- Herrühren und Surrogation: Der BGH bestätigte, dass Vermögensgegenstände, die mittelbar aus inkriminierten Geldern stammen (z. B. durch Surrogation), als Tatobjekte gelten können.
Ist die Entscheidung richtig?
Die Entscheidung ist juristisch überzeugend und folgt einer stringenten Logik.
-
Bemakelungsquote zum Tatzeitpunkt: Die Heranziehung des Verkehrswerts zum Tatzeitpunkt ist systematisch schlüssig, da sie sicherstellt, dass der Täter nicht von Wertsteigerungen profitiert oder durch Wertverluste unbillig belastet wird. Dieser Ansatz steht im Einklang mit früherer Rechtsprechung des BGH (z. B. BGH, 1 StR 33/15), der die wirtschaftliche Betrachtung betont.
-
Einbeziehung des wirtschaftlichen Eigentümers: Die Berücksichtigung des wirtschaftlichen Eigentümers bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist nachvollziehbar. Der BGH schafft hier eine Abwägung zwischen den Interessen des Täters und den Zielen der Vermögensabschöpfung.
-
Surrogation und "Herrühren": Die Entscheidung bekräftigt, dass auch mittelbar aus Vortaten stammende Gegenstände bemakelt sein können, wenn ein wirtschaftlicher Zusammenhang besteht. Dies ist eine wesentliche Stütze der Geldwäschebekämpfung und korrespondiert mit der Rechtsprechung zu § 261 StGB (z. B. BGH, 5 StR 234/18).
Was lernen wir daraus?
Das Urteil verdeutlicht:
-
Differenzierte Berechnung der Bemakelungsquote: Die Berechnung der Bemakelungsquote bleibt eine zentrale Herausforderung. Entscheidend ist die klare Trennung zwischen Tatzeit und Entscheidungszeitpunkt, um Verzerrungen zu vermeiden.
-
Verhältnismäßigkeitsprüfung als Korrektiv: Die Verhältnismäßigkeitsprüfung bleibt ein wichtiger Mechanismus, um übermäßige Eingriffe zu vermeiden. Sie erlaubt eine individuelle Betrachtung des Einzelfalls, insbesondere bei Mischfinanzierungen.
-
Präzisierung der Surrogationslehre: Der BGH stärkt die Verankerung der Surrogationslehre und unterstreicht, dass auch indirekte Zusammenhänge zwischen Vortat und Tatobjekt erfasst werden können.
Abweichende Meinungen und Problemkreise
-
Bemakelung und Verhältnismäßigkeit: Kritiker könnten argumentieren, dass die Bemakelungsquote allein nicht ausreicht, um eine Verhältnismäßigkeitsprüfung sachgerecht zu gestalten. Die fehlende Berücksichtigung von späteren Wertveränderungen könnte in Einzelfällen zu Ungerechtigkeiten führen.
-
"Herrühren" als weites Konzept: Die Ausdehnung des Begriffs des Herrührens könnte in der Praxis zu Beweisproblemen führen. Insbesondere bei Surrogaten ist es oft schwierig, den wirtschaftlichen Zusammenhang zur Vortat nachzuweisen.
-
Abgrenzung zwischen Einziehung und Schadensersatz: In der Literatur wird diskutiert, ob die Einziehung von Tatobjekten in Mischfinanzierungen nicht den Charakter eines "quasi-strukturellen Schadensersatzes" annehmen könnte, was vom Gesetzgeber nicht intendiert war.
Fazit
Das Urteil des BGH ist ein wichtiger Meilenstein für die Fortentwicklung des Einziehungsrechts und der Geldwäschebekämpfung. Es bringt Klarheit in die Berechnung der Bemakelungsquote und stärkt die Einziehung als Instrument der Vermögensabschöpfung. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung bleibt jedoch ein umstrittenes Feld, das weitere Konkretisierung in der Rechtsprechung erfordert.
moreResultsText



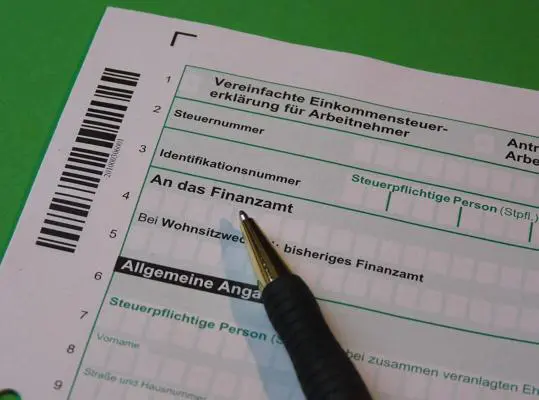
Annotations
BUNDESGERICHTSHOF
Gründe:
- 1
- Das Landgericht hat den Angeklagten wegen Untreue in Tateinheit mit Betrug in 128 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe sowie die Angeklagte wegen Beihilfe zur Untreue und wegen vorsätzlicher Geldwäsche in 21 Fällen zu einer Gesamtgeldstrafe von 200 Tagessätzen zu je 200 Euro verurteilt. Ein Teil der Strafen ist jeweils wegen der Verfahrensdauer für vollstreckt erklärt worden. Außerdem hat das Landgericht Verfallsentscheidungen getroffen.
- 2
- Die auf die Sachrüge gestützten Revisionen der Beschwerdeführer sind unbegründet im Sinne von § 349 Abs. 2 StPO. Der Erörterung bedarf bezüglich der Revision der Angeklagten lediglich das Folgende:
- 3
- 1. Die auf fehlerfreien Feststellungen beruhende Verurteilung der Angeklagten wegen 21 Fällen der Geldwäsche gemäß § 261 Abs. 2 Nr. 2 StGB in der Tatvariante des „Verwendens“ (Fälle C.II.2. der Urteilsgründe; Taten 129 – 149) weist keine Rechtsfehler zu ihrem Nachteil auf.
- 4
- a) Bei den jeweiligen Guthaben auf dem Konto bei der V. eG, deren Inhaber die Angeklagten gemeinschaftlich waren, handelte es sich im Tatzeitraum zwischen Juli 2007 und April 2009 insgesamt um einen „Gegenstand“ im Sinne von § 261Abs. 1 Satz 1 StGB, der aus von dem Angeklagten gewerbsmäßig begangenen Straftaten jeweils tateinheitlicher Untreue und Betruges herrührte (§ 261 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4a StGB). Gegenstand ist jeder Vermögensgegenstand, der seinem Inhalt nach bewegliche oder unbewegliche Sachen oder Rechte umfasst (vgl. Fischer, StGB, 62. Aufl., § 261 Rn. 6; Neuheuser in Münchener Kommentar zum StGB, 2. Aufl., Band 4, § 261 Rn. 29 mwN; näher Voß, Die Tatobjekte der Geldwäsche, 2007, S. 16 ff.). Dazu gehört Buchgeld ebenso wie Forderungen im Allgemeinen (Neuheuser aaO mwN; siehe auch BT-Drucks. 12/989 S. 27 li.Sp.).
- 5
- Der Tatobjektseigenschaft der gesamten Guthaben steht nicht entgegen, dass diese im genannten Tatzeitraum sowohl aus rechtmäßigen Zahlungseingängen als auch aus den Untreue- und Betrugsstraftaten des Angeklagten resultierten. Jedenfalls bei den von dem Landgericht festgestellten Anteilen des Zuflusses aus deliktischen Quellen zwischen 5,9 % bis ca. 35 % in den Jahren 2007 bis 2009 war das jeweilige Giralgeld insgesamt ein aus Straftaten nach § 261 Abs. 1 Satz 2 StGB stammender Gegenstand. Es bedarf daher vorliegend keiner Festlegung, ob es in Fällen der Vermischung von Mitteln aus rechtmäßigen und unrechtmäßigen Quellen einer Mindestquote des deliktischen Anteils bedarf (so etwa Barton NStZ 1993, 159, 163 f.; Leip/Hardtke wistra 1997, 281, 283; Leip, Der Straftatbestand der Geldwäsche, 2. Aufl., S. 108 – 110), um insgesamt von einem tauglichen Tatobjekt der Geldwäsche ausgehen zu können.
- 6
- Der Senat folgt damit einer in der Rechtsprechung (OLG Karlsruhe, Beschluss vom 20. Januar 2005 – 3 Ws 108/04, NJW 2005, 767, 769) und in der Strafrechtswissenschaft (etwa Schmidt/Krause in Leipziger Kommentar zum StGB, 12. Aufl., Band 8, § 261 Rn. 12; Altenhain in Nomos Kommentar zum StGB, 4. Aufl., Band 3; § 261 Rn. 76 f.; siehe auch Neuheuser aaO Rn. 55 f.; krit. Voß aaO S. 50 – 52) vielfach vertretenen Auffassung. Danach kommt es in Fällen der Vermischung im Grundsatz lediglich darauf an, dass der aus Vortaten herrührende Anteil bei wirtschaftlicher Betrachtung nicht völlig unerheblich ist. Dafür spricht sowohl die Auslegung des § 261 Abs. 1 StGB anhand der Entstehungsgeschichte als auch der mit der Strafvorschrift verfolgte Zweck (ebenso Altenhain aaO § 261 Rn. 76). Aus den Gesetzesmaterialien im Zuge der Einführung des § 261 StGB ist die Vorstellung der am Gesetzgebungsverfahren Beteiligten deutlich abzulesen, Vermögensgegenstände, die aus einer Vermischung von Mitteln aus legalen und illegalen Quellen entstanden sind, insgesamt als Gegenstände anzusehen, die aus einer Straftat herrühren (BT-Drucks. 12/3533 S. 12 re.Sp. mit dem dortigen Beispiel). Diese Vorstellung hat in den sprachlich weiten Begriffen „Gegenstand“ und „herrührt“ hinreichend deutlich Ausdruck gefunden (siehe zur Wortbedeutung „herrühren“ bereits Senat, Be- schluss vom 18. Februar 2009 – 1 StR 4/09, BGHSt 53, 205, 208 – 210 Rn. 12 – 15). Der Zweck des Geldwäschetatbestandes, das Einschleusen von Vermö- gensgegenständen aus bestimmten Kriminalitätsformen in den legalen Finanzund Wirtschaftskreislauf zu verhindern (BT-Drucks. 12/989 S. 26 li.Sp.), spricht ebenfalls für eine Einbeziehung von Vermischungskonstellationen in den Kreis gemäß § 261 Abs. 1 StGB tauglicher Tatobjekte (ebenso OLG Karlsruhe aaO, Altenhain aaO; insoweit auch Neuheuser aaO; Leip/Hardtke wistra 1997, 281, 284). Die notwendige Begrenzung (vgl. BT/Drucks. 12/989 S. 27 li.Sp.) erfolgt, indem der aus deliktischen Quellen stammende Anteil nicht lediglich völlig unerheblich sein darf. Das ist bei den hier festgestellten Quoten nicht der Fall.
- 7
- b) Die Feststellungen tragen die Annahme der Tathandlung des Verwendens i.S.v. § 261 Abs. 2 Nr. 2 StGB. Darunter fällt jeder bestimmungsgemäße Gebrauch des inkriminierten Gegenstandes (Neuheuser NStZ 2008, 492, 496 mwN). Das ist bei allen im Einzelnen durch das Landgericht festgestellten Verfügungen der Angeklagten über das jeweilige Guthaben auf dem Konto in Gestalt des Tätigens von Überweisungen (Taten 129, 132, 134, 136 – 139, 141 – 146,148, 149), der Barabhebung (Tat 130), der Erteilung von Ermächtigungen zum Lastschrifteneinzug (Taten 131 und 147) sowie der von Einzugsermächtigungen (Taten 133, 135 und 140) der Fall. Rechtsfehlerfrei hat der Tatrichter für das Lastschrifteinzugsverfahren und die Erteilung von Einzugsermächtigungen selbst dann nur eine Tathandlung der Angeklagten angenommen , wenn die Begünstigten mehrfach von der ihnen erteilten Ermächtigung (bei periodisch fällig werdenden Schulden; exemplarisch Tat 140) Gebrauch gemacht haben.
- 8
- c) Es bedarf keiner Entscheidung, ob die Angeklagte bezüglich der Taten 129 – 149 auch die Varianten des Verschaffens (§ 261 Abs. 2 Nr. 1 StGB) und des Verwahrens (§ 261 Abs. 2 Nr. 2 StGB; zu den Anforderungen BGH, Beschluss vom 26. Januar 2012 – 5 StR 461/11, NStZ 2012, 321, 322) der Geldwäsche verwirklicht hat und wie sich dies konkurrenzrechtlich zu den Tathandlungen des Verwendens (§ 261 Abs. 2 Nr. 2 StGB) verhalten hätte (vgl. dazu Neuheuser NStZ 2008, 492, 496). Dass das Landgericht die vorgenannten Varianten nicht angenommen hat, wirkt sich nicht zu Lasten der Angeklagten aus.
- 9
- 2. Die getroffenen Feststellungen tragen auch den Schuldspruch und die Einzelstrafe wegen Beihilfe zur Untreue im Fall 112 (C.II.1. der Urteilsgründe). Indem die Angeklagte in Kenntnis der Herkunft einen von Verantwortlichen der geschädigten M. AG begebenen Scheck auf der Rückseite unter- schrieb, um ihrem mitangeklagten Ehemann zu ermöglichen, den Scheck auf das gemeinsame Konto einzureichen, unterstützte sie diesen vorsätzlich bei dessen Untreue (§ 266 StGB) zu Lasten seines Arbeitgebers, der M. AG.
- 10
- a) Bei der Bemessung der Einzelstrafe von 120 Tagessätzen wegen dieser Tat hat das Landgericht zwar nicht erkennbar die Strafmilderung aus § 28 Abs. 1 i.V.m. § 49 Abs. 1 StGB berücksichtigt. Dies wäre neben der Milderung aus § 27 Abs. 2 i.V.m. § 49 Abs. 1 StGB aber erforderlich gewesen, weil die Angeklagte das besondere persönliche Merkmal der Vermögensbetreuungspflicht aus § 266 Abs. 1 StGB (siehe nur BGH, Beschluss vom 27. Januar 2015 – 4 StR 476/14, wistra 2015, 146 mwN) in eigener Person nicht aufwies und die Beteiligungsform der Beihilfe nicht aus dem Fehlen der Betreuungspflicht, sondern bereits aus dem geringen Gewicht ihres Tatbeitrags resultiert (UA S. 87; zur erforderlichen Berücksichtigung beider vertypter Milderungsgründe auch bei Geldstrafe KG, Beschluss vom 2. April 2012 – [4] 161 Ss 30/12 [67/12], StV 2013, 89, 91). Dass die Angeklagte bei der Tatbegehung Leiterin der Abteilung Schulung und Training der U. GmbH, einer zum M. -Konzern gehörenden Gesellschaft, war (UA S. 6 und 7), begründete keine eigene Vermögensbetreuungspflicht im Verhältnis zu der durch die Taten des Angeklagten geschädigten M. AG.
- 11
- b) Der Senat schließt aber im Hinblick auf die von dem Tatgericht seiner Strafzumessung zugrunde gelegten Erwägungen ein Beruhen der Einzelstrafe auf dem Rechtsfehler aus. Das Landgericht hat sich bei der Strafzumessung der Einzelstrafe bedenkenfrei auch an der Höhe des durch die Haupttat entstandenen Schadens für die M. AG orientiert. Die Einzelstrafen für die täterschaftliche Geldwäsche der Angeklagten hat es im Vorgehen ver- gleichbar an der Höhe der jeweils „verwendeten“ Beträge ausgerichtet (UA S. 87 f.). Angesichts des Umfangs des Untreueschadens hätte das Tatgericht bei Anlegen seiner Strafzumessungsmaßstäbe auch unter Berücksichtigung eines weiteren vertypten Strafmilderungsgrundes keine geringere Einzelstrafe verhängt.
- 12
- c) Es bedarf daher keiner Entscheidung, ob ein Beruhen auch deshalb ausgeschlossen werden könnte, weil bei der Tat 112 zudem die tatbestandlichen Voraussetzungen einer Geldwäsche gemäß § 261 Abs. 2 Nr. 1 bzw. Nr. 2 StGB in den Tatvarianten des Verschaffens und Verwahrens vorliegen könnten. Insoweit wäre zwar eine Verurteilung der Angeklagten ausgeschlossen, weil zu ihren Gunsten die als persönlicher Strafausschließungsgrund und als Konkurrenzregel zu verstehende Vorschrift des § 261 Abs. 9 Satz 2 StGB (näher Senat , Beschluss vom 18. Februar 2009 – 1 StR 4/09, BGHSt 53, 205, 207 Rn. 8) eingriff. Einer Berücksichtigung bei der Strafzumessung hätte dies aber nicht zwingend entgegengestanden (vgl. zur Berücksichtigungsfähigkeit im Fall der Gesetzeseinheit allgemein Miebach in Münchener Kommentar zum StGB, 2. Aufl., Band 2, § 46 Rn. 162).
- 13
- Ebenso kann offen bleiben, ob der Unrechts- und Schuldgehalt der Beihilfe dadurch beeinflusst war, dass die Haupttat sich gegen das Vermögen einer Gesellschaft richtete, die zu demselben Konzern gehörte, wie die Arbeitgeberin der Angeklagten.
- 14
- 3. Angesichts des rechtsfehlerfrei festgestellten Einkommens der Angeklagten geboten ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht, ihr wegen Unzumutbarkeit der vollständigen Zahlung der verhängten Geldstrafe (näher Radtke in Münchener Kommentar zum StGB, 2. Aufl., Band 2, § 42 Rn. 11; Satzger/Schmitt/Widmaier/Mosbacher, StGB, 2. Aufl., § 42 Rn. 4 aE) Zahlungserleichterungen gemäß § 42 Satz 1 StGB zu gewähren.
- 15
- 4. Im Rahmen der Entscheidung gemäß § 111i Abs. 2 StPO genügte es, dass das Landgericht hinsichtlich eines Betrages von 86.429,70 Euro eine gesamtschuldnerische Haftung beider Angeklagten in den Urteilsgründen festgestellt hat (UA S. 93); eines entsprechenden Ausspruchs im Tenor bedurfte es nicht zwingend (Senat, Beschluss vom 10. April 2013 – 1 StR 22/13, NStZ-RR 2013, 254, 255 mwN).
Mosbacher Fischer
(1) Wer einen Gegenstand, der aus einer rechtswidrigen Tat herrührt,
- 1.
verbirgt, - 2.
in der Absicht, dessen Auffinden, dessen Einziehung oder die Ermittlung von dessen Herkunft zu vereiteln, umtauscht, überträgt oder verbringt, - 3.
sich oder einem Dritten verschafft oder - 4.
verwahrt oder für sich oder einen Dritten verwendet, wenn er dessen Herkunft zu dem Zeitpunkt gekannt hat, zu dem er ihn erlangt hat,
(2) Ebenso wird bestraft, wer Tatsachen, die für das Auffinden, die Einziehung oder die Ermittlung der Herkunft eines Gegenstands nach Absatz 1 von Bedeutung sein können, verheimlicht oder verschleiert.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Wer eine Tat nach Absatz 1 oder Absatz 2 als Verpflichteter nach § 2 des Geldwäschegesetzes begeht, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
(5) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter gewerbsmäßig handelt oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Geldwäsche verbunden hat.
(6) Wer in den Fällen des Absatzes 1 oder 2 leichtfertig nicht erkennt, dass es sich um einen Gegenstand nach Absatz 1 handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Satz 1 gilt in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 nicht für einen Strafverteidiger, der ein Honorar für seine Tätigkeit annimmt.
(7) Wer wegen Beteiligung an der Vortat strafbar ist, wird nach den Absätzen 1 bis 6 nur dann bestraft, wenn er den Gegenstand in den Verkehr bringt und dabei dessen rechtswidrige Herkunft verschleiert.
(8) Nach den Absätzen 1 bis 6 wird nicht bestraft,
- 1.
wer die Tat freiwillig bei der zuständigen Behörde anzeigt oder freiwillig eine solche Anzeige veranlasst, wenn nicht die Tat zu diesem Zeitpunkt bereits ganz oder zum Teil entdeckt war und der Täter dies wusste oder bei verständiger Würdigung der Sachlage damit rechnen musste, und - 2.
in den Fällen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 unter den in Nummer 1 genannten Voraussetzungen die Sicherstellung des Gegenstandes bewirkt.
(9) Einem Gegenstand im Sinne des Absatzes 1 stehen Gegenstände, die aus einer im Ausland begangenen Tat herrühren, gleich, wenn die Tat nach deutschem Strafrecht eine rechtswidrige Tat wäre und
- 1.
am Tatort mit Strafe bedroht ist oder - 2.
nach einer der folgenden Vorschriften und Übereinkommen der Europäischen Union mit Strafe zu bedrohen ist: - a)
Artikel 2 oder Artikel 3 des Übereinkommens vom 26. Mai 1997 aufgrund von Artikel K.3 Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags über die Europäische Union über die Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte der Europäischen Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der Europäischen Union beteiligt sind (BGBl. 2002 II S. 2727, 2729), - b)
Artikel 1 des Rahmenbeschlusses 2002/946/JI des Rates vom 28. November 2002 betreffend die Verstärkung des strafrechtlichen Rahmens für die Bekämpfung der Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt (ABl. L 328 vom 5.12.2002, S. 1), - c)
Artikel 2 oder Artikel 3 des Rahmenbeschlusses 2003/568/JI des Rates vom 22. Juli 2003 zur Bekämpfung der Bestechung im privaten Sektor (ABl. L 192 vom 31.7.2003, S. 54), - d)
Artikel 2 oder Artikel 3 des Rahmenbeschlusses 2004/757/JI des Rates vom 25. Oktober 2004 zur Festlegung von Mindestvorschriften über die Tatbestandsmerkmale strafbarer Handlungen und die Strafen im Bereich des illegalen Drogenhandels (ABl. L 335 vom 11.11.2004, S. 8), der zuletzt durch die Delegierte Richtlinie (EU) 2019/369 (ABl. L 66 vom 7.3.2019, S. 3) geändert worden ist, - e)
Artikel 2 Buchstabe a des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates vom 24. Oktober 2008 zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität (ABl. L 300 vom 11.11.2008, S. 42), - f)
Artikel 2 oder Artikel 3 der Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates (ABl. L 101 vom 15.4.2011, S. 1),- g)
den Artikeln 3 bis 8 der Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates (ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1; L 18 vom 21.1.2012, S. 7) oder - h)
den Artikeln 4 bis 9 Absatz 1 und 2 Buchstabe b oder den Artikeln 10 bis 14 der Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates und zur Änderung des Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6).
(10) Gegenstände, auf die sich die Straftat bezieht, können eingezogen werden. § 74a ist anzuwenden. Die §§ 73 bis 73e bleiben unberührt und gehen einer Einziehung nach § 74 Absatz 2, auch in Verbindung mit den §§ 74a und 74c, vor.
wegen vorsätzlicher Geldwäsche
ECLI:DE:BGH:2018:271118B5STR234.18.0
Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat nach Anhörung des Beschwerdeführers und des Generalbundesanwalts am 27. November 2018 gemäß § 349 Abs. 2 und 4, analog § 354 Abs. 1 StPO beschlossen:
a) im Schuldspruch dahin geändert, dass der Angeklagte wegen vorsätzlicher Geldwäsche in 18 Fällen verurteilt ist,
b) im gesamten Strafausspruch aufgehoben,
c) im Ausspruch über die Einziehung von Wertersatz dahin geändert, dass gegen den Angeklagten die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 59.024,49 Euro angeordnet wird.
Die weitergehende Revision wird verworfen.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsmittels , an eine andere Strafkammer des Landgerichts zurückverwiesen.
Gründe:
- 1
- Das Landgericht hat den im Rahmen einer Verfahrensabsprache vollumfänglich geständigen Angeklagten wegen vorsätzlicher Geldwäsche in 75 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt und die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 74.597,40 Euro angeordnet. Die auf die Sachrüge gestützte Revision des Angeklagten ist im Umfang der Beschlussformel begründet.
- 2
- 1. Nach den Feststellungen organisierte der Angeklagte gemeinsam mit vier gesondert verfolgten Mittätern seit 2005 den banden- und gewerbsmäßigen Schmuggel von Zigaretten. Aufgrund des gemeinsamen Tatplans führten er und seine Tatgenossen von April bis Juni 2005 in drei Fällen mindestens 76.500 kg Rauchtabak („Feinschnitt“ des fertig verarbeiteten Tabaks, der ohne wesentli- che Zwischenschritte für die Zigarettenproduktion verwendet werden kann) mit unzutreffender Zollanmeldung als „Tabakabfall“ über Antwerpen in die Europäi- sche Union ein, um diesen ohne Entrichtung der für die Einfuhr von Rauchtabak fälligen Einfuhrabgaben (Zoll, Tabak- und Einfuhrumsatzsteuer) für die illegale Zigarettenproduktion zu nutzen, die in Griechenland erfolgte. Hierdurch wurden Einfuhrabgaben in Höhe von rund 424.000 Euro hinterzogen. Von Juli 2005 bis Februar 2011 führten der Angeklagte und seine Mittäter in 25 Fällen wahrheitswidrig als „Tabakabfall“ deklarierten Rauchtabak über Klaipeda (Litauen) in die Europäische Union ein. Hierdurch wurden Einfuhrabgaben in Höhe von mehr als 45 Millionen Euro hinterzogen. Den nicht verzollten und unversteuerten Rauchtabak verwendete die Gruppierung um den Angeklagten für die illegale Zigarettenproduktion in Polen und Moldawien. Ihr Gewinn aus dem Verkauf allein der in Polen in der Zeit von Anfang 2006 bis Juli 2010 produzierten Zigaretten betrug circa 54 Millionen Euro, wovon auf den Angeklagten ein Viertel entfiel. Hiermit finanzierte er seinen aufwendigen Lebensstil.
- 3
- Ein wesentlicher Teil dieser Straftaten war Gegenstand eines Urteils des Landgerichts Berlin vom 11. März 2013, durch das der Angeklagte wegen gewerbs - und bandenmäßigen Schmuggels in 21 Fällen sowie wegen Steuerhin- terziehung in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt wurde. Bereits am 22. Oktober 2013 wurde er in den offenen Vollzug verlegt und nahm als Freigänger eine Tätigkeit in einem Gastronomiebetrieb auf. Nach Verbüßung der Hälfte der gegen ihn verhängten Gesamtfreiheitsstrafe wurde die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt. Am 28. Dezember 2016 wurde er aus der Strafhaft entlassen.
- 4
- Der Angeklagte und seine Ehefrau G. G. waren auch nach seiner rechtskräftigen Verurteilung nicht bereit, auf ihren luxuriösen Lebensstil zu verzichten. Hierzu zählten neben der Anmietung einer teuren Wohnung unter anderem die Nutzung großer Geländewagen, die Inanspruchnahme der Dienste von Haushaltshilfen und eines Chauffeurs sowie der Besuch kostspieliger Privatschulen durch die drei Kinder. Tatsächlich verfügten die Eheleute jedoch über kein nennenswertes legales Einkommen oder legal erworbenes Vermögen. Vielmehr war der Angeklagte aufgrund von Steuernachforderungen im zweistelligen Millionenbereich völlig überschuldet.
- 5
- Der erhebliche Finanzbedarf des Ehepaars konnte nur mittels der rechtzeitig zur Seite geschafften Erlöse aus den beschriebenen Straftaten gedeckt werden. Deshalb entwickelten die Eheleute spätestens im Mai 2013 gemeinsam mit dem gesondert verfolgten S. einen Plan, um G. G. die Anmietung einer 260 qm großen luxuriösen Wohnung in Berlin-Wilmersdorf mit einer Bruttowarmmiete von (zuletzt) 4.870 Euro monatlich und weitere Aufwendungen für den eigenen Lebensstil mittels der bemakelten Gelder zu ermöglichen. Um dies zu verschleiern, sollte der Mietvertrag zum Schein auf eine andere Person abgeschlossen und die Miete aus dem mit bemakelten Geldern gespeisten Konto dieser Person abgebucht werden. Hierfür gewannen die Eheleute S. D. , die am 3. Mai 2013 den Mietvertrag über die Wohnung abschloss und mit der Vermieterin vereinbarte, dass G. G. die Wohnung mitnutzen konnte. Tatsächlich wurde die Wohnung niemals durch D. , sondern ausschließlich durch den Angeklagten und seine Familie genutzt.
- 6
- Entsprechend dem gemeinsamen Tatplan eröffnete D. unter ihrem Namen ein Girokonto (im Folgenden „D. -Konto“) und erteilte einen Abbuchungsauftrag für künftige Forderungen aus dem Mietverhältnis. Um Verfügungen des Angeklagten durch S. zu ermöglichen, erteilte sie diesem eine umfassende Kontovollmacht. Das Konto wurde in der Folgezeit nicht nur zur Begleichung der monatlich fällig werdenden Forderungen aus dem Mietverhältnis verwendet, sondern auch zur Deckung zahlreicher weiterer Aufwendungen der Familie. Die wirtschaftliche Zugehörigkeit des Kontos wurde tatplangemäß dadurch verdeckt, dass alle Transaktionen von diesem Konto nach außen zu Lasten der D. erfolgten und dabei jeweils von ihr oder dem Kontobevollmächtigten S. , keinesfalls aber vom Angeklagten und seiner Ehefrau, angewiesen wurden. Tatsächlich hatte der Angeklagte zu jeder Zeit Verfügungsgewalt über das Konto, indem er S. anwies, nach seiner Maßgabe Überweisungen zu tätigen und Lastschriften zuzulassen. Der Angeklagte sorgte selbst für die Speisung des Kontos, die weit überwiegend durch Erträge aus den beschriebenen Straftaten aufgrund von durch den Angeklagten veranlasste Bareinzahlungen (ohne Nennung eines Einzahlers oder Verwendungszweckes), legendierte Überweisungen und Rückzahlungen von zuvor aus den Erträgen der Straftaten gewährten Darlehen oder daraus gezogenen Nutzungen erfolgte. Die Anweisungen wiesen dabei stets D. als Zahlungsempfängerin aus.
- 7
- Im Tatzeitraum vom 1. Dezember 2015 bis zum 16. August 2016 verfügte der Angeklagte dem mit S. und G. G. gemeinsam gefassten Tatplan entsprechend in 75 Fällen über das Guthaben. Die Zahlungen betrafen unter anderem die Kosten der Wohnung (Miete, Nebenkosten, Strom, Kabelanschluss), Schulgelder für die drei Kinder, Beiträge der privaten Krankenversicherung sowie Zahlungen an die Charité für zugunsten des Angeklagten oder seiner Familie erbrachte medizinische Leistungen und beliefen sich insgesamt auf die Höhe des Einziehungsbetrages.
- 8
- Das Landgericht hat diese Verfügungen als gemäß § 261 Abs. 9 Satz 3 StGB strafbares Inverkehrbringen von aus den Vortaten des Angeklagten herrührenden Geldern gewertet. Dagegen hat es die durch ihn veranlassten Einspeisungen auf das „D. -Konto“ nach § 261 Abs. 9 Satz 2 StGB als strafloses Verhalten angesehen.
- 9
- 2. Der Schuldspruch hält sachlich-rechtlicher Überprüfung deshalb nicht stand, weil das Landgericht § 261 Abs. 9 Satz 3 StGB nicht rechtsfehlerfrei angewendet hat.
- 10
- a) Die Vorschrift des § 261 Abs. 9 Satz 3 StGB ist verfassungsgemäß (aA SSW/Jahn, 3. Aufl., § 261 Rn. 97; vgl. auch Teixeira, NStZ 2018, 634, 637 ff.). Sie verstößt insbesondere nicht gegen das Doppelbestrafungsverbot (Art. 103 Abs. 3 GG).
- 11
- aa) Durch das Gesetz zur Bekämpfung der Korruption vom 20. November 2015 (BGBl. I 2025) hat der Gesetzgeber die Regelung über die Straflosigkeit der Selbstgeldwäsche in § 261 Abs. 9 StGB geändert und den persönlichen Strafausschließungsgrund in Satz 2 durch eine tatbestandsbezogene Rückausnahme eingeschränkt. So sollte die Straflosigkeit ausschließlich auf Selbst- geldwäschehandlungen ohne Unrechtssteigerung begrenzt werden (vgl. Neuheuser , NZWiSt 2016, 265). Seit dem Inkrafttreten der Neuregelung am 26. November 2015 gilt der Strafausschließungsgrund nicht mehr für Fälle, in denen der Vortatbeteiligte einen aus seiner Straftat herrührenden Gegenstand in den Verkehr bringt und dabei dessen rechtswidrige Herkunft verschleiert. Der Gesetzgeber ging davon aus, dass solche Handlungen die Integrität des Wirtschafts - und Finanzkreislaufs und damit ein gegenüber der Vortat zusätzliches Rechtsgut gefährden; sie weisen deshalb einen besonderen Unrechtsgehalt auf, so dass sie nicht als mitbestrafte Nachtat hinter die Vortat zurücktreten (BT-Drucks. 18/6389, S. 13). Die Gesetzesänderung steht im Einklang damit, dass die EU-Mitgliedstaaten nach der am 2. Dezember 2018 in Kraft tretenden Richtlinie (EU) 2018/1673 sicherzustellen haben, dass eine Geldwäschehand- lung unter Strafe gestellt wird, „wenn sie von Personen verübt wird, die an der kriminellen Tätigkeit, aus der die Vermögensgegenstände stammen, als Täter oder in anderer Weise beteiligt waren“ (Art. 3 Abs. 5 der Richtlinie, vgl. auch Nr. 11 der Erwägungsgründe).
- 12
- bb) Ziel der ursprünglich uneingeschränkten Regelung des § 261 Abs. 9 Satz 2 StGB ist zwar die Vermeidung von Doppelbestrafungen in den Fällen, in denen der Vortäter Geldwäschehandlungen vornimmt (vgl. BT-Drucks. 13/8651, S. 11; 13/6620, S. 7; BGH, Beschluss vom 18. Februar 2009 – 1 StR 4/09, BGHSt 53, 205, 207). Unter diesem Gesichtspunkt ist aber nicht die uneingeschränkte Straflosigkeit der Selbstgeldwäsche geboten.
- 13
- (1) Nach Art. 103 Abs. 3 GG darf niemand wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Der Begriff der Tat im Sinne des Art. 103 Abs. 3 GG ist in seinem verfassungsrechtlichen Gehalt zu bestimmen als der geschichtliche – und damit zeitlich und sachverhalt- lich begrenzte – Vorgang, auf den Anklage und Eröffnungsbeschluss hinweisen und innerhalb dessen der Angeklagte als Täter oder Teilnehmer einen Straftatbestand verwirklicht haben soll (BVerfGE 23, 191, 202; 56, 22, 28). Angeknüpft wird damit an den prozessualen Tatbegriff (Maunz/Dürig/Schmidt-Aßmann, GG, 84. EL August 2018, Art. 103 Abs. 3 Rn. 281 f.). Bei der Selbstgeldwäsche, wie sie in § 261 Abs. 9 Satz 3 StGB beschrieben ist, handelt es sich um eine gegenüber der vom Katalog des § 261 Abs. 1 StGB umfassten Vortat neue Tat. Dies zeigt sich auch im vorliegenden Fall: Die Verurteilung des Angeklagten durch das Landgericht Berlin vom 11. März 2013 und die hiesige Verurteilung betreffen zeitlich verschiedene geschichtliche Vorgänge, die auch sachverhaltlich nach natürlicher Betrachtungsweise keine Einheit bilden und somit verschiedene Taten im Sinne des Art. 103 Abs. 3 GG darstellen.
- 14
- (2) Auch in ihrem Unrechtsgehalt unterscheidet sich die Selbstgeldwäsche unter den Voraussetzungen des § 261 Abs. 9 Satz 3 StGB von der Vortat (krit. Bergmann, NZWiSt 2014, 448, 450; Teixeira aaO, 637 ff.). Das Inverkehr- bringen von „Schwarzgeld“ ist – jedenfalls abstrakt – geeignet, die Solidität, In- tegrität und Stabilität der Kredit- und Finanzinstitute sowie das Vertrauen in das Finanzsystem zu gefährden (vgl. BT-Drucks. 18/6389, S. 13 unter Verweis auf Erwägungsgründe 1 und 2 der Richtlinie 2005/60/EG … zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ). Die von § 261 Abs. 9 Satz 3 StGB zudem geforderte Verschleierungshandlung ist mit zusätzlichem Unwert behaftet (vgl. BT-Drucks. aaO, S. 14). Auch dies wird im vorliegenden Fall deutlich: Der Angeklagte hat gezielt Mechanismen zum Schutz der Integrität des Wirtschafts- und Finanzkreislaufs , nämlich die geldwäscherechtliche Pflicht der Banken (§ 2 GwG), ihre Kunden (wirtschaftlich Berechtigte, § 3 Abs. 1 GwG) zu identifizieren und sich über deren Geschäftstätigkeit zu vergewissern (§§ 10 ff. GwG), durch falsche Angaben über seine Identität und den Hintergrund seiner geschäftlichen Tätigkeit umgangen.
- 15
- cc) Soweit der Vortäter trotz Verwirklichung des objektiven Tatbestands durch eine nachfolgende Selbstgeldwäschehandlung im Ausnahmefall kein über die Vortat hinausgehendes Unrecht verwirklicht hat, wird § 261 StPO nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs durch die Katalogtat verdrängt (vgl. BGH, Urteile vom 24. Januar 2006 – 1 StR 357/05, BGHSt 50, 347, 353; vom 20. September 2000 – 5 StR 252/00, NJW 2000, 3725; Schönke /Schröder/Stree/Hecker, StGB, 29. Aufl., § 261 Rn. 36; siehe auch BT-Drucks. 18/6389, S. 14). Eine solche Konstellation liegt hier aber nicht vor.
- 16
- b) Bei der Anwendung des § 261 Abs. 9 Satz 3 StGB auf den vorliegenden Fall ist das Landgericht zunächst zutreffend davon ausgegangen, dass der vom Angeklagten gewerbs- und bandenmäßig geschmuggelte Tabak (§ 373 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 3 AO i.V.m. § 373 Abs. 4, § 370 Abs. 6 Satz 1 und Abs. 7 AO) taugliches Tatobjekt im Sinne von § 261 Abs. 1 Satz 1 StGB war. Gemäß § 261 Abs. 1 Satz 3 StGB gilt in den Fällen des § 261 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 StGB auch der Gegenstand, hinsichtlich dessen Abgaben hinterzogen wurden, als aus der Vortat herrührendes taugliches Tatobjekt der Geldwäsche (BGH, Urteil vom 20. September 2000 – 5 StR 252/00, NStZ 2000, 653 f.).
- 17
- Die unter Verwendung dieses Tabaks illegal produzierten Zigaretten rühren ebenfalls aus den Vortaten her. Das Tatbestandsmerkmal „Herrühren“ soll nach dem Willen des Gesetzgebers auch eine Kette von Verwertungshandlungen erfassen, bei denen der ursprüngliche Gegenstand durch einen anderen ersetzt wird, selbst wenn dessen Wert höher ist (BT-Drucks. 12/989, S. 27; 12/3533, S. 12; vgl. auch BGH, Urteil vom 15. August 2018 – 5 StR 100/18). Eine Grenze liegt erst dort, wo aufgrund von Weiterverarbeitung der Wert eines neuen Gegenstandes trotz dessen Teilidentität mit dem Ursprungsgegenstand im Wesentlichen auf eine selbstständige spätere Leistung Dritter zurückzuführen ist (BT-Drucks. aaO; vgl. MüKo-StGB/Neuheuser, 3. Aufl., § 261 Rn. 54). Letzteres ist – wie vom Landgericht zu Recht angenommen – hier nicht gegeben. Der Angeklagte und seine Tatgenossen haben vielmehr den für die von ihnen selbst produzierten Zigaretten genutzten Tabak als das werthaltigste Produktionsmittel eingesetzt.
- 18
- Die Bemakelung setzte sich schließlich an den Erlösen aus dem Verkauf der Zigaretten fort, da ein im wirtschaftlichen Austausch erlangter Gegenstand ebenfalls aus der Vortat herrührt (BGH, Urteil vom 27. Juli 2016 – 2 StR 451/15, NStZ 2017, 28; MüKo-StGB/Neuheuser, aaO, Rn. 52). Auch die vielfache den verfahrensgegenständlichen Taten vorausgehende Verschiebung der Erlöse (UA S. 8 f.) durch den Angeklagten hat nicht zu einer Unterbrechung ihres nach wirtschaftlicher Betrachtungsweise zu bestimmenden kausalen Zusammenhangs zur Vortat geführt (vgl. BGH, Urteil vom 15. August 2018 – 5 StR 100/18; Beschluss vom 18. Februar 2009 – 1 StR 4/09, BGHSt 53, 205, 209).
- 19
- c) Entgegen der Auffassung des Landgerichts erfüllen allerdings bereits die vom Angeklagten veranlassten Einzahlungen und Überweisungen auf das „D. -Konto“, die der Verschleierung der rechtswidrigen Herkunft der jeweiligen Gelder dienten, das Tatbestandsmerkmal des Inverkehrbringens.
- 20
- aa) Das Tatbestandsmerkmal des Inverkehrbringens lehnt sich – was das Landgericht im Ansatz nicht verkennt – an die § 146 StGB (Geldfälschung) zugrunde liegende Definition an. Erfasst werden sollen nach dem Willen des Gesetzgebers sämtliche Handlungen, die dazu führen, dass der Täter den inkriminierten Gegenstand aus seiner tatsächlichen Verfügungsgewalt entlässt und ein Dritter die tatsächliche Verfügungsgewalt über den Gegenstand erlangt.
- 21
- bb) Ungeachtet der Tatsache, dass der Angeklagte ohnehin nicht formell Berechtigter des „D. -Konto“ war, hat er demnach das bemakelte Geld mit der Einspeisung auf das Konto in Verkehr gebracht. Aus dem Urteil sind innerhalb des mit Inkrafttreten der gesetzlichen Änderung der Straflosigkeit der Selbstgeldwäsche beginnenden Tatzeitraums 18 auf Veranlassung des Angeklagten zurückgehende (vgl. UA S. 34) Einspeisungen ersichtlich (UA S. 37 bis 50). Es handelt sich um folgende nach Datum, Betrag und (angeblichem) Auftraggeber bezeichnete Eingänge: (1) 26. November 2015, 5.000 Euro, O. R. , (2) 22. Dezember 2015, 7.000 Euro, unbekannt, (3) 28. Dezember 2015, 2.000 Euro, S. I. GmbH, (4) 25. Januar 2016, 2.000 Euro, S. I. GmbH, (5) 28. Januar 2016, 5.000 Euro, unbekannt, (6) 9. Februar 2016, 5.000 Euro, M. R. , (7) 25. Februar 2016, 2.000 Euro, S. I. GmbH, (8) 11. März 2016, 5.000 Euro, M. R. , (9) 29. März 2016, 2.000 Euro, S. I. GmbH, (10) 11. April 2016, 1.524,49 Euro, S. I. GmbH, (11) 25. April 2016, 2.000 Euro, S. I. GmbH, (12) 4. Mai 2016, 2.000 Euro, S. I. GmbH, (13) 18. Mai 2016, 5.000 Euro, M. R. , (14) 25. Mai 2016, 2.000 Euro, S. I. GmbH, (15) 22. Juni 2016, 5.000 Euro, unbekannt, (16) 27. Juni 2016, 2.000 Euro, S. I. GmbH, (17) 25. Juli 2016, 2.000 Euro, S. I. GmbH, (18) 26. Juli 2016, 2.500 Euro, unbekannt.
- 22
- d) Entgegen der Auffassung der Revision, die ebenfalls bereits die Einspeisung der Gelder als Inverkehrbringen ansieht, hat der Angeklagte dabei deren rechtswidrige Herkunft auch verschleiert.
- 23
- Das Verschleiern der Herkunft eines Gegenstands umfasst alle zielgerichteten , irreführenden Machenschaften mit dem Zweck, einem Tatobjekt den Anschein einer anderen (legalen) Herkunft zu verleihen oder zumindest seine wahre Herkunft zu verbergen (vgl. BGH, Urteil vom 27. Juli 2016 – 2StR 451/15, NStZ 2017, 28). Die Eingänge beruhten auf vom Angeklagten veranlassten Bareinzahlungen ohne Nennung eines Einzahlers oder Verwendungszwecks , legendierten Überweisungen und Rückzahlungen von zuvor aus den Erträgen der Vortaten gewährten Darlehen und daraus gezogenen Nutzungen (UA S. 34). Stets wiesen die Anweisungen D. als Zahlungsempfängerin aus und erfolgten auf das von ihr im Auftrag des Angeklagten eröffnete Konto. Dieses zur Gefährdung der Ermittlung des rechtswidrigen Ursprungs der Gelder geeignete Vorgehen (vgl. NK-StGB/Altenhain, 5. Aufl., § 261 Rn. 103) diente auch nach insoweit zutreffender Auffassung des Landgerichts (UA S. 70) der Verschleierung ihrer Herkunft.
- 24
- e) Da sich die Bemakelung an dem Giralgeld des „D. -Kontos“ fortsetzte , stellten zwar auch die verschiedenen Abverfügungen ein (erneutes) Inverkehrbringen geldwäschegeeigneter Vermögenswerte dar. Dass dem Konto auch „legale“ Zahlungen zuflossen, ändert daran nichts, weil der aus den Vorta- ten stammende Anteil nicht nur nicht völlig unerheblich war (vgl. BGH, Urteil vom 15. August 2018 – 5 StR 100/18; Beschluss vom 20. Mai 2015 – 1 StR 33/15, NJW2015, 3254), sondern sogar bei weitem überwog. Indes sind die Speisungen des Kontos mit aus den Vortaten stammenden Geldbeträgen und die auf Veranlassung des Angeklagten hiervon jeweils vorgenommenen Überweisungen und Lastschriften rechtlich als natürliche Handlungseinheit zu werten (vgl. BGH, Urteile vom 15. August 2018 – 5 StR 100/18 und vom 12. Juli 2016 – 1 StR 595/15, NStZ 2017, 167; Neuheuser, NStZ 2008, 492, 496). Dies gilt jedenfalls dann, wenn Einzahlungen zu den Abflüssen – wie hier – jeweils in einem zeitlichen und Zweckzusammenhang stehen. Auf das Konto wurden sukzessiv Teile des Profits des Angeklagten aus dem Tabakschmuggel transferiert, um sodann im Rahmen von Überweisungen oder zuvor erteilten Lastschriften und Daueraufträgen Ausgaben des Angeklagten und seiner Ehefrau im Rahmen deren Lebensführung bestreiten zu können (UA S. 57).
- 25
- f) Der Senat ändert den Schuldspruch in entsprechender Anwendung von § 354 Abs. 1 StPO ab. Dem steht § 265 StPO nicht entgegen, da nicht anzunehmen ist, dass sich der geständige Angeklagte wirksamer als geschehen verteidigt hätte.
- 26
- 3. Der Ausspruch über die Wertersatzeinziehung bedarf ebenfalls einer Änderung.
- 27
- a) Es beschwert den Angeklagten zwar nicht, dass die Strafkammer auf die seit dem 1. Juli 2017 gültigen Vorschriften der § 74 Abs. 2, § 74c Abs. 1, § 74f Satz 1 StGB abgestellt hat (vgl. UA S. 77). Denn auch nach der bis zum 30. Juni 2017 geltenden Rechtslage – die maßgeblich gewesen wäre (vgl. § 2 Abs. 1, 3 und 5 StGB) – hätte sie die Einziehung des Wertes der Tatobjekte vornehmen dürfen (§ 74 Abs. 4, § 74b Abs. 1, § 74c Abs. 1 StGB a.F. i.V.m. § 261 Abs. 7 Satz 1 StGB).
- 28
- b) Unabhängig von der durch den Senat vorgenommenen Schuldspruchkorrektur bedarf es aber einer Änderung der Höhe des eingezogenen Betrages.
- 29
- Nach § 261 Abs. 7 Satz 1 StGB kann der durch die Geldwäsche erlangte Vermögensgegenstand (nur) als Tatobjekt (§ 74 Abs. 4 StGB a.F.) eingezogen werden. Tatobjekt, das im Wege der Wertersatzeinziehung nach § 74c Abs. 1 StGB a.F. abgeschöpft werden kann, ist ausschließlich der dem „D. - Konto“ durch den Angeklagten zugeführte Gesamtbetrag. Denn nur dieser stand ihm zur Zeit der Tat zu. Nach den durch das Landgericht in den Blick genommenen 75 Geldwäschetaten lag ein tauglicher Einziehungsgegenstand gemäß § 261 Abs. 7 Satz 1, § 74 ff. StGB a.F. beim Angeklagten demgegenüber nicht vor. Die nach Vermischung mit „legalen“ Geldern geringeren Umfangs ausgezahlten (insgesamt höheren) Beträge wurden erst mit ihrem Eingang bei den Überweisungsempfängern zu „Tatobjekten“ der Geldwäsche, da sie erst in diesem Augenblick in Verkehr gebracht wurden; zu diesem Zeitpunkt standen sie jedoch nicht mehr dem Angeklagten zu (§ 74c Abs. 1 StGB a.F.). Ihre Einziehung wäre daher lediglich unter den Voraussetzungen des § 74a StGB bei den Zahlungsempfängern möglich gewesen. Eine ersatzweise Anordnung des Wertersatzverfalls nach § 73a StGB ist nicht zulässig (vgl. BGH, Beschluss vom 17. März 2010 – 2 StR 67/10, NStZ 2011, 100; vom 13. Januar 2010 – 2 StR 519/09, NStZ-RR 2010, 141, 142; vom 14. Dezember 2001 – 3 StR 442/01, NStZ-RR 2002, 118; Köhler/Burkhard, NStZ 2017, 665, 681).
- 30
- c) Der Senat kann auch die Einziehungsentscheidung in entsprechender Anwendung von § 354 Abs. 1 StPO ändern. Angesichts der besonderen Sachlage , bei der die tatgerichtliche Einziehungsanordnung in rechtsfehlerhafter Weise innerhalb derselben Tat an eine der die Einziehung begründenden nachgelagerten Handlung anknüpft, ist ausgeschlossen, dass das Tatgericht bei rechtsfehlerfreier Anwendung der § 261 Abs. 7 Satz 1, § 74 ff. StGB a.F. auf die Einziehung des – geringeren – dem „D. -Konto“ zugeführten Betrages verzichtet hätte (vgl. KK-StPO/Gericke, StPO, § 354 Rn. 19). Der nunmehr eingezogene Betrag war auch noch nicht Gegenstand früherer Einziehungsentscheidungen. Der Abänderung der Einziehungsentscheidung steht § 265 StPO nicht entgegen.
- 31
- 4. Die Schuldspruchänderung bedingt die Aufhebung sämtlicher Einzelstrafen sowie der Gesamtstrafe.
- 32
- 5. Die Feststellungen sind von den den Änderungen des Schuldspruchs und der Einziehungsentscheidung zugrunde liegenden Wertungsfehlern unberührt und können deshalb bestehen bleiben; sie dürfen durch ihnen nicht widersprechende ergänzt werden.
Berger Köhler


