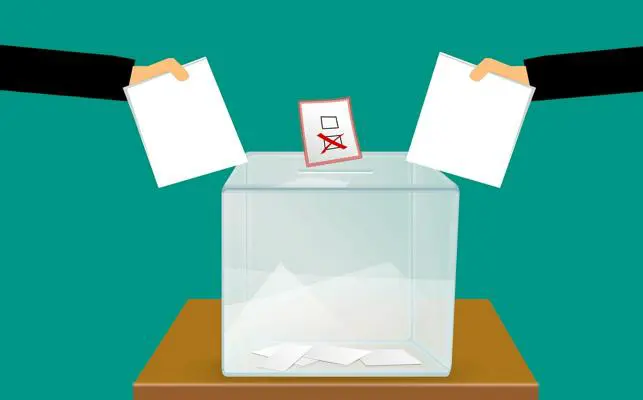Urteilskommentar: Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 30. Juli 2024 – 2 BvF 1/23
Bundesverfassungsgericht Urteil, 30. Juli 2024 - 2 BvF 1/23
Bundesverfassungsgericht
Urteil vom 30. Juli 2024
Az.: 2 BvF 1/23
Tenor
1. Die Verfahren werden zur gemeinsamen Entscheidung verbunden.
2. § 1 Absatz 3 , § 6 Absatz 1 und Absatz 4 Sätze 1 und 2 des Bundeswahlgesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und des Fünfundzwanzigsten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 8. Juni 2023 (Bundesgesetzblatt I Nummer 147, berichtigt durch Nummer 198) sind mit dem Grundgesetz vereinbar.
3. § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 des Bundeswahlgesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und des Fünfundzwanzigsten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzesvom 8. Juni 2023 (Bundesgesetzblatt I Nummer 147, berichtigt durch Nummer 198) ist nach Maßgabe der Gründe mit Artikel 21 Absatz 1 und Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes unvereinbar.
4. Bis zu einer Neuregelung gilt § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 des Bundeswahlgesetzes mit der Maßgabe fort, dass bei der Sitzverteilung Parteien, die weniger als 5 Prozent der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben, nur dann nicht berücksichtigt werden, wenn ihre Bewerber in weniger als drei Wahlkreisen die meisten Erststimmen auf sich vereinigt haben.
5. Die Verfassungsbeschwerden werden mit Ausnahme der Verfassungsbeschwerden der Beschwerdeführenden zu VI.1. bis 3. und zu VII.1. bis 25., 27. und 28. verworfen.
6. § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 des Bundeswahlgesetzes verletzt die Beschwerdeführenden zu VI.1. bis 3. und zu VII.1. bis 25., 27. und 28. nach Maßgabe der Gründe in ihrem grundrechtsgleichen Recht aus Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes .
7. Der Organklageantrag der Antragstellerin zu V. wird verworfen.
8. Der Deutsche Bundestag hat durch den Beschluss des Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und des Fünfundzwanzigsten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes am 17. März 2023 den Antragsteller zu III. nach Maßgabe der Gründe in seinem Recht aus Artikel 21 Absatz 1 des Grundgesetzes verletzt.
9. Der Organklageantrag der Antragstellerin zu IV. wird zurückgewiesen.
10. Die Bundesrepublik Deutschland hat den Beschwerdeführenden zu VI.1. bis 3. und zu VII.1. bis 25., 27. und 28. ihre notwendigen Auslagen zu erstatten.
11. Die Anträge der Antragstellerinnen zu IV. und zu V. auf Erstattung ihrer notwendigen Auslagen werden abgelehnt.
Gründe
A
Gegenstand der Verfahren sind die Regelungen des Bundeswahlrechts über die Sitzverteilung im Deutschen Bundestag. Die Antragstellenden und Beschwerdeführenden begehren - in unterschiedlichem Umfang - insbesondere die Prüfung, ob die Sitzverteilung im Verfahren der Zweitstimmendeckung und die Sperrklausel als Zugangshürde zu diesem Verfahren mit dem Grundgesetz vereinbar sind.
I.
Das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag weist in seinen Grundstrukturen ein hohes Maß an Kontinuität auf. Sie wurden vom Parlamentarischen Rat im Entwurf für das Wahlgesetz zum ersten Bundestag und zur ersten Bundesversammlung der Bundesrepublik Deutschland vom 15. Juni 1949 (BGBl I S. 21
a) Seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland erfolgt eine Wahl zum Deutschen Bundestag sowohl von Einzelpersonen in Wahlkreisen als auch von Listen in den Ländern. Es gelten zwei unterschiedliche Wahlverfahren. Die Einzelpersonen in den Wahlkreisen werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen gewählt (§ 9 WahlG 1949; § 8 WahlG 1953; § 5 BWahlG 1956). In den Ländern wird eine Verhältniswahl durchgeführt; jede Liste erhält so viele Sitze, wie es ihrem Stimmenanteil entspricht (§ 10 Abs. 1 WahlG 1949; § 9 Abs. 1 Sätze 1 und 4 WahlG 1953; § 6 Abs. 1 Sätze 1 und 4 BWahlG 1956).
Bei der Wahl zum ersten Deutschen Bundestag 1949 hatten alle Wählerinnen und Wähler je eine Stimme (§ 13 Satz 1 WahlG 1949). Seit 1953 verfügen sie über zwei Stimmen, eine Erststimme für die Wahl im Wahlkreis und eine Zweitstimme für die Wahl nach Landeslisten (§ 7 WahlG 1953; § 4 BWahlG 1956).
Die Aufteilung in zwei Stimmen wirkt sich bei denjenigen Wählerinnen und Wählern aus, die ihre Erststimme einem parteilosen Bewerber geben. Ist er im Wahlkreis erfolgreich, werden die Zweitstimmen seiner Wählerinnen und Wähler nicht berücksichtigt. Diese Regelung in § 9 Abs. 1 Satz 2 WahlG 1953 dehnte § 6 Abs. 1 Satz 2 BWahlG 1956 auf erfolgreiche Bewerber einer Partei aus, für die in dem betreffenden Land keine Landesliste zugelassen wurde. Mit dem Neunzehnten Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 25. November 2011 (BGBl I S. 2313 ) ergänzte der Gesetzgeber als dritte Konstellation den Fall von Bewerbern, deren Partei zwar gewählt werden kann, aber nicht in den Bundestag einzieht (§ 6 Abs. 1 Satz 4 BWahlG i.d.F. vom 25. November 2011
b) Die Regelungen zur Gesamtsitzzahl des Bundestages und die strukturellen Unterscheidungen dieser Sitze - zwischen Wahlkreis- und Listenmandaten sowie nach Ländersitzkontingenten - haben sich mehrfach geändert.
Stets war und ist die Gesamtzahl der Abgeordneten des Deutschen Bundestages als Regelgröße gesetzlich bestimmt (§ 8 Abs. 1 Satz 1 WahlG 1949; § 6 Abs. 1 WahlG 1953, § 1 Abs. 1 Satz 1 BWahlG 1956). Sie wird unterteilt in Wahlkreisabgeordnete und Listenabgeordnete (§ 8 Abs. 2 WahlG 1949, § 6 Abs. 1 WahlG 1953, § 1 Abs. 2 BWahlG 1956). Während 1949 die Landesregierungen die ihren Ländern zugeteilten Sitze zwischen Wahlkreisen und Listensitzen im ungefähren Verhältnis von 60 zu 40 zu verteilen hatten (§ 8 Abs. 2 WahlG 1949), ist seit 1953 gesetzlich vorgegeben, dass die Hälfte der durch die Regelgröße vorgesehenen Abgeordneten in Wahlkreisen und die andere Hälfte nach Landeslisten gewählt wird (§ 6 Abs. 1 WahlG 1953, § 1 Abs. 2 BWahlG 1956). Nachdem 1949 zunächst 242 Wahlkreise gebildet worden waren, erhöhte das Wahlgesetz 1953 die ursprüngliche Mindestgröße des Deutschen Bundestages (ohne Berliner Abgeordnete) von 400 auf 484. Durch die Wiedervereinigung wuchs die Zahl der Wahlkreise auf 328 und die Regelsitzzahl entsprechend von 518 auf 656 Abgeordnete an (§ 1 Abs. 1 Satz 1 BWahlG i.d.F. des Gesetzes vom 29. August 1990 zu dem Vertrag vom 3. August 1990 zur Vorbereitung und Durchführung der ersten gesamtdeutschen Wahl des Deutschen Bundestages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik sowie dem Änderungsvertrag vom 20. August 1990, BGBl II S. 813
Die Wahlgesetze 1949 und 1953 sahen für jedes Land eine bestimmte Anzahl an Sitzen vor (§ 8 Abs. 1 Satz 2 WahlG 1949; § 6 Abs. 2 WahlG 1953). Mit dem Bundeswahlgesetz 1956 entschied sich der Gesetzgeber gegen Ländersitzkontingente. Das Bundeswahlgesetz 2011 führte solche wieder ein. Der Gesetzgeber reagierte damit auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 3. Juli 2008, das ihm aufgegeben hatte, ein Auftreten von negativen Stimmgewichten zu verhindern (BVerfGE 121, 266 ; dazu sogleich Rn. 13). Das Zweiundzwanzigste Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 3. Mai 2013 (BGBl I S. 1082 ) bestimmte die Größe der Ländersitzkontingente nach dem jeweiligen Bevölkerungsanteil (§ 6 Abs. 2 Satz 1 BWahlG 2013).
c) Seit 1949 wird die Gesamtsitzzahl des Bundestages grundsätzlich auf die Parteien entsprechend ihrem Stimmenanteil, also nach den Grundsätzen der Verhältniswahl verteilt (vgl. oben Rn. 3).
1949 und 1953, als Landessitzkontingente bestanden, ergaben sich die Verhältnisanteile der Partei für jedes Land einzeln (§ 10 Abs. 1 WahlG 1949; § 9 Abs. 1 Sätze 1 und 4 WahlG 1953). Seit dem Bundeswahlgesetz 1956 wird grundsätzlich die Gesamtzahl der Bundestagssitze in einem ersten Schritt auf die Parteien verteilt (§ 6 Abs. 1 Sätze 1 und 4 BWahlG 1956). Hierfür wurde die Verbindung der Landeslisten derselben Partei erlaubt (§ 7 Abs. 1 und 2 BWahlG 1956) und praktiziert. In einem zweiten Schritt werden die Sitze innerhalb dieser Parteikontingente auf die Landeslisten der jeweiligen Partei weiterverteilt (§ 7 Abs. 3 BWahlG 1956).
d) Da ein Teil - seit 1953 die Hälfte - der Regelmandate durch die Personenwahl in den Wahlkreisen bestimmt wird, ist eine Verrechnung der Wahlkreismandate mit der Mandatszahl, die sich für die Parteien aus der Verhältniswahl ergibt, notwendig.
Das seit 1949 geltende Ausgleichsverfahren sah eine Anrechnung der Wahlkreismandate auf die Sitzkontingente der Parteien vor. Die sich nach den beiden Wahlverfahren für eine Partei ergebenden Sitze wurden dadurch in einen Ausgleich gebracht, dass von der für jede Partei ermittelten Abgeordnetenzahl die Zahl der von ihr errungenen Wahlkreismandate abgezogen wurde (§ 10 Abs. 2 Satz 1 WahlG 1949, § 9 Abs. 2 Satz 1 WahlG 1953, § 6 Abs. 2 Satz 1 BWahlG 1956). Standen einer Partei nach dem Parteiproporz weniger Sitze zu, als sie Mandate in den Wahlkreisen errungen hatte, blieben alle Wahlkreismandate erhalten. Die damit einer Partei über den Proporz hinaus zustehenden Mandate erhöhten damit die Gesamtzahl der jeweils vorgesehenen Sitze (§ 10 Abs. 3 WahlG 1949; § 9 Abs. 3 WahlG 1953, § 6 Abs. 3 BWahlG 1956) und werden als Überhangmandate bezeichnet. Dieser Ausgleich erfolgte auf der Ebene der Länder. 1949 und 1953 ergab sich dies schon daraus, dass jedem Land feste Landessitzkontingente zugewiesen waren (vgl. oben Rn. 8). Ab dem Jahr 1956 sah § 6 Abs. 2 und 3 BWahlG 1956 dies ausdrücklich so vor (vgl. hierzu auch BVerfGE 95, 335 <339>).
Seit den 1990er Jahren kam es regelmäßig und in zunehmendem Umfang zu Überhangmandaten (vgl. BVerfGE 95, 335 <340>). Von 1965 bis 1976 waren keine und bei den Wahlen von 1980 bis 1987 lediglich ein oder zwei Überhangmandate angefallen. Von 1990 bis 2005 vergrößerte sich jeder Bundestag um mindestens fünf, zweimal auch um 16 Überhangmandate (vgl. Bundeswahlleiter, Ergebnisse früherer Bundestagswahlen, 2022, S. 112). Dies führte zudem zum Auftreten von negativen Stimmgewichten (vgl. BVerfGE 121, 266 <274 ff.>; 131, 316 <322 f.>). Mit Urteil vom 3. Juli 2008 erklärte das Bundesverfassungsgericht deshalb die Bestimmungen, die den Effekt des negativen Stimmgewichts verursachten - § 7 Abs. 3 in Verbindung mit § 6 Abs. 4 und 5 BWahlG in der Fassung des Siebzehnten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 11. März 2005 (BGBl I S. 674 ), die inhaltlich unverändert § 6 Abs. 2 und 3 BWahlG 1956 entsprachen - für unvereinbar mit den Grundsätzen der Gleichheit und Unmittelbarkeit der Wahl (BVerfGE 121, 266<314>). Weil die daraufhin mit dem Bundeswahlgesetz 2011 vorgenommene Einführung von Landessitzkontingenten (vgl. oben Rn. 8) den Effekt des negativen Stimmgewichts nicht beseitigte, erklärte das Bundesverfassungsgericht die Neuregelung mit Urteil vom 25. Juli 2012 für nichtig (vgl. BVerfGE 131, 316 <339 ff., 375 f.>). Zugleich stellte es fest, dass Überhangmandate wegen des vom Gesetzgeber vorgegebenen Grundcharakters der Bundestagswahl als Verhältniswahl die Wahlgleichheit aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG und die Chancengleichheit der Parteien aus Art. 21 Abs. 1 GG nicht mehr wahren, wenn ihre Zahl etwa die Hälfte der für die Bildung einer Fraktion erforderlichen Zahl von Abgeordneten überschreitet, und dass das Wahlrecht angesichts der tatsächlichen Verhältnisse Vorkehrungen hiergegen treffen muss (vgl. BVerfGE 131, 316 <357 ff., 368 ff.>).
Mit dem Bundeswahlgesetz 2013 ergänzte der Gesetzgeber deshalb das Ausgleichsverfahren um das Element der Ausgleichsmandate. Rechnerisch anfallende Überhangmandate - weiterhin auf der Ebene der Landeslistensitze - wurden durch Ausgleichsmandate - auf der Ebene der Gesamtsitze des Bundestages - für die anderen Parteien kompensiert (§ 6 Abs. 5 und 6 BWahlG 2013). Die Gesamtzahl der Sitze im Deutschen Bundestag wich dadurch zunehmend von der Regelgröße von 598 Abgeordneten ab. Sie erhöhte sich 2013 durch vier Überhang- und 29 Ausgleichsmandate auf 631 Abgeordnete. Die Bundestagswahl 2017 führte durch 46 Überhang- und 65 Ausgleichsmandate zu 709 Abgeordneten (Bundeswahlleiter, Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013, Heft 3, S. 324; Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017, Heft 3, S. 394).
Zur Vermeidung eines weiteren Anstiegs der Gesamtsitzzahl rückte der Gesetzgeber mit dem Fünfundzwanzigsten Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 14. November 2020 (BGBl I S. 2395 ) von der Vollkompensation der Überhangmandate ab und ließ bis zu drei unausgeglichene Überhangmandate zu (§ 6 Abs. 5 Satz 4 BWahlG i.d.F. vom 14. November 2020
e) Schließlich mussten Parteien für die Berücksichtigung bei der Sitzverteilung auf die Landeslisten seit 1949 eine von zwei Voraussetzungen erfüllen. Sie mussten entweder 5 Prozent der Stimmen in der Verhältniswahl erreichen (sog. Sperrklausel) oder bei der Wahlkreiswahl erfolgreich sein (sog. Grundmandatsklausel). Für die erste Bundestagswahl 1949 galt die Sperrklausel ebenso wie die Grundmandatsklausel jeweils für ein Land (§ 10 Abs. 4 und 5 WahlG 1949). Im Wahlgesetz 1953 wurden beide Klauseln auf das Bundesgebiet bezogen (§ 9 Abs. 4 WahlG 1953). Eine Partei musste also bundesweit mindestens 5 Prozent der gültigen Zweitstimmen erreichen, allerdings wurden auch sämtliche Landeslisten berücksichtigt, wenn im Bundesgebiet ein Wahlkreismandat errungen wurde. § 6 Abs. 4 Satz 1 BWahlG 1956 behielt beide Regelungen bei, erhöhte jedoch die erforderliche Anzahl von Grundmandaten auf drei.
Lediglich für die erste gesamtdeutsche Wahl 1990 sollte eine Übergangsregelung die Sperrklausel modifizieren, um den besonderen Umständen des politischen Wettbewerbs unmittelbar nach der Wiedervereinigung Rechnung zu tragen. § 53 Abs. 2 BWahlG in der Fassung des Gesetzes zum Wahlvertrag sah vor, dass Landeslisten verschiedener Parteien, die in keinem Land nebeneinander Listenwahlvorschläge einreichten, verbunden werden konnten. Nachdem das Bundesverfassungsgericht diese Regelung verworfen und stattdessen eine regionalisierte - jeweils auf die alten Länder und Westberlin beziehungsweise die neuen Länder und Ostberlin bezogene - Sperrklausel sowie die Zulassung von Listenvereinigungen entsprechend dem Wahlrecht zur Volkskammerwahl am 18. März 1990 als sachgerecht angesehen hatte (BVerfGE 82, 322 <348 ff.>), änderte das Zehnte Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes sowie zur Änderung des Parteiengesetzes vom 8. Oktober 1990 (BGBl I S. 2141 ) die Übergangsregelung entsprechend ab (§ 53 BWahlG i.d.F. vom 8. Oktober 1990
2. Die angegriffenen Neuregelungen des Bundeswahlgesetzes beruhen auf Vorarbeiten einer Reformkommission und einem daran anknüpfenden Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP. In der parlamentarischen Beratung hat der Entwurf weitere Änderungen erfahren.
a) Der Deutsche Bundestag sah im Bundeswahlgesetz 2020 trotz der vorgenommenen Modifikationen des Ausgleichssystems (vgl. oben Rn. 15) weiteren Reformbedarf und gab sich selbst in § 55 BWahlG 2020 die Einsetzung einer Reformkommission auf (vgl. BTDrucks 19/22504, S. 7). Mit den Einsetzungsbeschlüssen vom 22. April 2021 (vgl. BTDrucks 19/28787; BTPlenProt 19/224, S. 28556
Hierzu legte die Reformkommission am 1. September 2022 einen Zwischenbericht vor (vgl. BTDrucks 20/3250); der Abschlussbericht zu weiteren Themen folgte am 12. Mai 2023 (vgl. BTDrucks 20/6400). Im Zwischenbericht empfahl die Reformkommission mehrheitlich, dass die Regelgröße des Bundestages von 598 Sitzen sicher eingehalten, das Grundprinzip der personalisierten Verhältniswahl beibehalten und die Sitzverteilung weiterhin zunächst auf Bundesebene an die Parteien nach deren Zweitstimmenverhältnis (Oberverteilung) und sodann auf der Ebene der Parteien entsprechend den Ergebnissen ihrer Landeslisten (Unterverteilung) erfolgen solle. Zur Vermeidung von Überhangmandaten sollten einer Partei in einem Land nur so viele Wahlkreismandate zugeteilt werden, wie ihrer Landesliste Mandate zur Verfügung stünden (Zweitstimmendeckung). Im Fall der Nichtzuteilung eines Wahlkreismandats an den Erstplatzierten solle der Wahlkreis jedoch nicht unbesetzt bleiben; hierfür skizzierte der Zwischenbericht mehrere Modelle. An der Sperrklausel in Höhe von 5 Prozent solle festgehalten und über die Fortgeltung und verfassungskonforme Ausgestaltung der Grundmandatsklausel politisch entschieden werden (vgl. BTDrucks 20/3250, S. 21 f.).
Diese Empfehlungen begründete die Reformkommission damit, dass aufgrund struktureller Veränderungen in der Parteienlandschaft und des Wahlverhaltens, die sich im Mehrheits- und Verhältniswahlsystem unterschiedlich auswirkten, die Verteilung der Direktmandate dauerhaft nicht mehr im Zweitstimmenproporz aufgehen könne. Damit sei die Vergrößerung des Bundestages strukturell im System angelegt, stelle jedoch ab einer gewissen Größe seine Funktionsfähigkeit infrage (vgl. BTDrucks 20/3250, S. 10 f.). Ungeachtet unterschiedlicher Verständnisse zum Begriff der personalisierten Verhältniswahl sowie zur Rolle und Funktion der in den Wahlkreisen gewählten Abgeordneten bestand Konsens, die einzelnen Wahlkreise nach Möglichkeit nicht weiter zu vergrößern (vgl. BTDrucks 20/3250, S. 11 f.). Bei Einigkeit darüber, dass es ein perfektes Wahlsystem nicht gebe, erörterte die Kommission im Wesentlichen zwei konträre Modelle, von denen sie mehrheitlich das Modell der "verbundenen Mehrheitsregel" empfahl (vgl. BTDrucks 20/3250, S. 13). Ferner sah die Kommission überwiegend die Sperrklausel in Höhe von 5 Prozent als weiterhin gerechtfertigt an. Zur Grundmandatsklausel erörterte sie verschiedene Anpassungsmöglichkeiten und auch ihre Streichung (vgl. BTDrucks 20/3250, S. 16).
Der Zwischenbericht enthielt mehrere Sondervoten. Die Abgeordneten der CDU und CSU trugen zum Teil die Feststellungen sowie insgesamt die Empfehlungen nicht mit, sondern befürworteten eine Reform im Sinne des anderen vorgeschlagenen Modells eines Zwei-Stimmen-Wahlrechts (vgl. BTDrucks 20/3250, S. 22 f.). Die Sachverständigen Grzeszick, Mellinghoff und Schmahl empfahlen dies ebenfalls und wiesen darauf hin, dass sie das Wahlsystem einer verbundenen Mehrheitsregel für verfassungswidrig hielten (vgl. BTDrucks 20/3250, S. 17 f., 23). Der Abgeordnete Glaser empfahl, über den Mehrheitsvorschlag hinauszugehen und den Wahlkreis, aus dem kein Direktmandat errungen werde, vakant zu lassen (vgl. BTDrucks 20/3250, S. 17, 23 ff.). Die Sachverständige Wawzyniak folgte der Mehrheit im Wesentlichen, empfahl der Kommission jedoch, eine Vorfestlegung auf ein Modell zu vermeiden (vgl. BTDrucks 20/3250, S. 26 f.).
b) In dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und des Fünfundzwanzigsten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 24. Januar 2023 griffen die Regierungsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP den Vorschlag der Reformkommission zur Einführung eines Verfahrens der Zweitstimmendeckung - im Entwurf als Hauptstimmendeckung bezeichnet - auf. Wahlkreisbewerber einer Partei, die in ihrem Wahlkreis eine Mehrheit der abgegebenen Erststimmen - im Entwurf als Wahlkreisstimmen bezeichnet - erhielten, sollten nach ihren jeweiligen Stimmenanteilen gereiht werden und nur dann ein Mandat erhalten, wenn dieses ihrer Partei nach deren Zweitstimmenanteil im entsprechenden Land zur Verfügung stehe (vgl. BTDrucks 20/5370 S. 2 f., 5 ff.). Ein Verfahren zur Besetzung eines Wahlkreises, dessen erfolgreicher Bewerber hiernach kein Mandat erhält, durch einen anderen Abgeordneten sah der Entwurf nicht vor. Voraussetzung für die Berücksichtigung einer Partei bei der Sitzverteilung sollte sein, dass sie mindestens 5 Prozent der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Hauptstimmen erhalten oder in nicht weniger als drei Wahlkreisen die meisten Wahlkreisstimmen errungen haben ("angepasste Grundmandatsklausel" oder im Folgenden Wahlkreisklausel).
c) Der Entwurf der Regierungsfraktionen sowie ein konkurrierender Gesetzentwurf und Beschlussanträge anderer Fraktionen wurden in der 83. Sitzung des 20. Deutschen Bundestages am 27. Januar 2023 in erster Lesung beraten und sodann federführend an den Ausschuss für Inneres und Heimat überwiesen (vgl. BTPlenProt 20/83, S. 9887 ff.).
Am 6. Februar 2023 fand eine Sachverständigenanhörung statt, bei der die Frage der Verfassungskonformität des Gesetzentwurfs der Regierungsfraktionen kontrovers beurteilt wurde. Kritik wurde auch mit Blick auf die "angepasste Grundmandatsklausel", die zur (verfassungswidrigen) Systemausnahme würde, geäußert (vgl. Austermann, Stellungnahme Ausschussdrucksache 20<4>171 C; Grzeszick, Stellungnahme Ausschussdrucksache 20<4>171 F; Schmahl, Stellungnahme Ausschussdrucksache 20<4>171 G). Für ihre Beibehaltung wurde vorgebracht, sie sichere die politische Ergebnisneutralität. Dies habe bei einer Wahlreform, die nicht im Konsens beschlossen werde, Gewicht (vgl. v. Achenbach/Meinel/Möllers, Stellungnahme Ausschussdrucksache 20<4>171 H).
Mit Beschlussempfehlung und Bericht vom 15. März 2023 empfahl der Ausschuss für Inneres und Heimat die Annahme des Gesetzentwurfs der Regierungsfraktionen in einer geänderten Fassung (BTDrucks 20/6015). Unter anderem war die "angepasste Grundmandatsklausel" nicht mehr enthalten. In der Sachverständigenanhörung sei deutlich geworden, dass ihre Fortgeltung im System der Zweitstimmendeckung einen stärkeren Systembruch als bislang darstelle und deshalb entfallen solle (vgl. BTDrucks 20/6015, S. 12). Weiter sprach der Ausschuss die Empfehlung aus, die Regelgröße des Deutschen Bundestags von 598 Sitzen auf 630 Sitze bei Beibehaltung der Zahl der Wahlkreise von 299 anzuheben, um hierdurch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Wahlkreisbewerber, auf die die meisten Erststimmen entfielen, einen Sitz erhielten (BTDrucks 20/6015, S. 11).
d) Am 17. März 2023 wurde das Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und des Fünfundzwanzigsten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes in der geänderten Fassung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat in der 92. Sitzung des 20. Deutschen Bundestages in zweiter und dritter Lesung beraten und beschlossen (vgl. BTPlenProt 20/92
Das Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes 2023 hebt in seinem Artikel 1 die im Bundeswahlgesetz 2020 vorgesehene Reduktion der Wahlkreise von 299 auf 280 auf und ändert mit seinem Artikel 2 das Bundeswahlgesetz ( Bundeswahlgesetz 2023). Insbesondere fasst es die §§ 1 und 4 bis 6 BWahlG vollständig neu. §§ 1, 4 und 6 BWahlG lauten nunmehr:
§ 1 Zusammensetzung des Deutschen Bundestages und Wahlrechtsgrundsätze
(1) Der Deutsche Bundestag besteht aus 630 Abgeordneten. Sie werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl von den wahlberechtigten Deutschen gewählt.
(2) Für die Wahl zum Deutschen Bundestag gelten die Grundsätze der Verhältniswahl. Jeder Wähler hat zwei Stimmen, eine Erststimme für die Wahl nach Kreiswahlvorschlägen und eine Zweitstimme für die Wahl nach Landeswahlvorschlägen, auf denen die zur Wahl zugelassenen Parteien ihre Bewerber benennen (Landeslisten).
(3) Für die Vergabe der auf die Landeslisten entfallenden Sitze werden, vorbehaltlich der Regelungen des § 6, vorrangig Bewerber berücksichtigt, die in einer Wahl nach Kreiswahlvorschlägen in 299 Wahlkreisen ermittelt werden. Jede Partei erhält in jedem Land für diejenigen ihrer Bewerber, die in den Wahlkreisen in diesem Land die meisten Erststimmen erhalten haben, die Sitzzahl, die von den auf die Partei entfallenden Zweitstimmen gedeckt ist (Zweitstimmendeckung).
(4) Die Wahl in den Wahlkreisen steht Bewerbern, die nicht von einer Partei vorgeschlagen werden, nach den sich aus diesem Gesetz ergebenden Anforderungen offen.
§ 4 Grundsätze der Verteilung der Sitze auf Parteien
(1) Die Gesamtzahl der Sitze (§ 1 Absatz 1) wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl zunächst auf die Parteien in Bezug auf das ganze Wahlgebiet und dann auf die Landeslisten jeder Partei verteilt. Von der Gesamtzahl der Sitze wird die Zahl der nach § 6 Absatz 2 erfolgreichen Wahlkreisbewerber abgezogen.
(2) Zwischen den Parteien werden die Sitze im Verhältnis der Zahl der Zweitstimmen, die im Wahlgebiet für die Landeslisten der Partei abgegeben wurden, nach § 5 verteilt (Oberverteilung). Nicht berücksichtigt werden dabei
1. die Zweitstimmen derjenigen Wähler, die ihre Erststimme für einen Bewerber abgegeben haben, der gemäß § 6 Absatz 2 erfolgreich ist, und
2. Parteien, die weniger als 5 Prozent der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben.
Satz 2 Nummer 2 findet keine Anwendung auf Listen, die von Parteien nationaler Minderheiten eingereicht wurden.
(3) Für jede Partei werden die auf sie nach Absatz 2 entfallenden Sitze auf ihre Landeslisten im Verhältnis der Zahl der Zweitstimmen der Landeslisten nach § 5 verteilt (Unterverteilung).
(4) Erhält bei der Verteilung der Sitze eine Partei, auf die mehr als die Hälfte der Gesamtzahl der Zweitstimmen aller zu berücksichtigenden Parteien entfallen ist, nicht mehr als die Hälfte der Sitze, werden ihr weitere Sitze zugeteilt, bis auf sie ein Sitz mehr als die Hälfte der Sitze entfällt. In einem solchen Fall erhöht sich die Gesamtzahl der Sitze (§ 1 Absatz 1) um die Unterschiedszahl.
§ 6 Vergabe der Sitze an Bewerber
(1) Ein Wahlkreisbewerber einer Partei (§ 20 Absatz 2) ist dann als Abgeordneter gewählt, wenn er die meisten Erststimmen auf sich vereinigt und im Verfahren der Zweitstimmendeckung (Satz 4) einen Sitz erhält. In jedem Land werden die Bewerber einer Partei, die in den Wahlkreisen die meisten Erststimmen erhalten haben, nach fallendem Erststimmenanteil gereiht. Der Erststimmenanteil ergibt sich aus der Teilung der Zahl der Erststimmen des Bewerbers durch die Gesamtzahl der gültigen Erststimmen in diesem Wahlkreis. Die nach § 4 Absatz 3 für die Landesliste einer Partei ermittelten Sitze werden in der nach Satz 2 gebildeten Reihenfolge an die Wahlkreisbewerber vergeben (Verfahren der Zweitstimmendeckung).
(2) Ein Bewerber, der nach § 20 Absatz 3 vorgeschlagen ist, ist als Abgeordneter eines Wahlkreises dann gewählt, wenn er die meisten Erststimmen auf sich vereinigt.
(3) Bei Stimmengleichheit und bei gleichen Erststimmenanteilen entscheidet das Los. Es ist zwischen Bewerbern in einem Wahlkreis (Absatz 1 Satz 1, Absatz 2) vom Kreiswahlleiter, zwischen Bewerbern im Verfahren der Zweitstimmendeckung (Absatz 1 Satz 4) vom Bundeswahlleiter zu ziehen.
(4) Ein Listenbewerber ist dann als Abgeordneter gewählt, wenn er bei der Vergabe der Sitze der Landesliste (§ 4 Absatz 3), die nach dem Verfahren der Zweitstimmendeckung verbleiben, einen Sitz erhält; die Vergabe erfolgt in der Reihenfolge der Landesliste. Bewerber, die nach Absatz 1 Satz 1 gewählt sind, bleiben auf der Landesliste unberücksichtigt. Entfallen auf eine Landesliste mehr Sitze als Bewerber benannt sind, so bleiben diese Sitze unbesetzt.
Außerdem wurde § 48 BWahlG angepasst. Dieser lautet nunmehr auszugsweise:
§ 48 Berufung von Nachfolgern
(1) Wenn ein nach § 6 Absatz 1 oder 4 gewählter Bewerber stirbt oder dem Landeswahlleiter schriftlich die Ablehnung des Erwerbs der Mitgliedschaft erklärt oder wenn ein nach § 6 Absatz 1 oder 4 gewählter Abgeordneter stirbt oder sonst nachträglich aus dem Deutschen Bundestag ausscheidet, so wird der Sitz mit dem nach den Grundsätzen des § 6 Absatz 1, 3 und 4 nachfolgenden Bewerber der Partei besetzt, für die der gewählte Bewerber oder ausgeschiedene Abgeordnete bei der Wahl aufgetreten ist. [...]
(2) Ist der Ausgeschiedene nach § 6 Absatz 2 gewählt, bleibt der Sitz unbesetzt.
II.
Gegen das insbesondere in § 1 Abs. 3 und § 6 Abs. 1 und Abs. 4 Sätze 1 und 2 BWahlG geregelte Zweitstimmendeckungsverfahren sowie gegen § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG, der die Sperrklausel von 5 Prozent ohne eine Berücksichtigung von Parteien aufgrund erfolgreicher Wahlkreisbewerber vorsieht, haben die Bayerische Staatsregierung (Antragstellerin zu I.) und 195 Abgeordnete des Deutschen Bundestages, zugleich Mitglieder der Fraktion der CDU/CSU im Bundestag (Antragstellende zu II.) Normenkontrolle beantragt. Der CSU e.V. (Antragsteller zu III.) hat als Partei Organklage gegen den Deutschen Bundestag wegen des Erlasses des Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes 2023 erhoben und greift ebenfalls diese Regelungen an. Zwei weitere Organklagen gegen den Deutschen Bundestag wegen dieses Gesetzes wenden sich inhaltlich lediglich gegen die nicht mehr mit einer Grundmandatsklausel versehene Sperrklausel in § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG. Sie sind von der Partei DIE LINKE (Antragstellerin zu IV.) sowie von der Fraktion DIE LINKE im Bundestag (Antragstellerin zu V.) erhoben worden. Gegen die Sperrklausel haben auch 4.242 Personen (Beschwerdeführende zu VI.) sowie 202 "Wähler/Sympathisanten" der Antragstellerin zu IV. (Beschwerdeführende zu VII.) Verfassungsbeschwerde eingelegt.
1. Zur Zulässigkeit der Organklagen beziehungsweise der Verfassungsbeschwerden tragen insbesondere die Antragstellerin zu V. sowie die Beschwerdeführenden zu VI. und VII. vor.
a) Die Antragstellerin zu V. macht in Bezug auf ihre Antragsbefugnis geltend, die Streichung der Grundmandatsklausel begründe die absehbare und realistische Gefahr, dass sie nach der nächsten Bundestagswahl nicht mehr im Deutschen Bundestag vertreten sein werde und dann keine Möglichkeit mehr habe, Rechtsschutz vor dem Bundesverfassungsgericht zu erlangen. Mit dem Wegfall ihres Status als Fraktion zum 6. Dezember 2023 müsse zwar ihr Verfahren grundsätzlich als erledigt angesehen werden. Es bestehe jedoch ein objektives Klarstellungsinteresse fort, dass das übereilte Gesetzgebungsverfahren ihre Fraktionsrechte verletzt habe. Einer solchen Vorgehensweise müsse insbesondere im sensiblen Bereich der Wahlgesetzgebung im Interesse jeder (Oppositions-)Fraktion durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts entgegengewirkt werden.
Die sechsmonatige Antragsfrist des § 64 Abs. 3 BVerfGG habe mit der Gesetzesverkündung am 13. Juni 2023 begonnen und werde durch den Eingang ihrer Antragsbegründung beim Bundesverfassungsgericht am 6. Oktober 2023 gewahrt. Ungeachtet dessen, dass sie an dem Beschluss des Gesetzes beteiligt gewesen sei, habe sie vor der Prüfung und Ausfertigung des Gesetzes durch den Bundespräsidenten keinen Anlass zur Klageerhebung gehabt.
b) Die Beschwerdeführenden zu VI.1. bis 3. legen für ihre Beschwerdebefugnis die Voraussetzungen ihrer Wahlberechtigung gemäß § 12 BWahlG dar. Für die weiteren 4.239 Beschwerdeführenden erklärt der Prozessbevollmächtigte, er habe auf diese Anforderungen hingewiesen, und verweist auf die Anlagen.
Mit Blick auf die Beschwerdefrist machen die Beschwerdeführenden zu VI. geltend, die bereits seit 1953 im Bundeswahlgesetz enthaltene Fünf-Prozent-Sperrklausel entfalte im neuen normativen Kontext des Bundeswahlgesetzes 2023 verschärfte Eingriffswirkungen und setze damit die für Rechtssatzverfassungsbeschwerden geltende Jahresfrist des § 93 Abs. 3 BVerfGG neu in Gang.
c) Die Beschwerdeführenden zu VII. tragen vor, dass einige von ihnen, die Beschwerdeführenden zu VII.1. bis 25. sowie 27. und 28., Abgeordnete des Deutschen Bundestages seien. Die weiteren Beschwerdeführenden seien Wähler und/oder Sympathisanten.
2. Die Antragstellenden zu II., III. und V. halten das Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes 2023 bereits für formell verfassungswidrig. Die Streichung der zuvor in § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BWahlG 2020 enthaltenen Grundmandatsklausel sei überraschend gewesen. Sie verletze das Recht der Abgeordneten aus Art. 38 Abs. 1 GG. Die Antragstellerin zu V. sieht in der Verletzung von Abgeordnetenrechten erst recht auch eine Verletzung ihrer Fraktionsrechte.
Zwar seien im Gesetzgebungsverfahren die Anforderungen der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages (§ 81 Abs. 1 Satz 2 GO-BT ) beachtet worden. Aber das Recht der Abgeordneten auf eine gleichberechtigte Teilhabe an der parlamentarischen Willensbildung und die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur zeitlichen Gestaltung von Gesetzgebungsverfahren seien verletzt. Die Regierungsfraktionen hätten im Entwurf zu § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG zunächst die Beibehaltung der bisher in § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BWahlG 2020 enthaltenen Grundmandatsklausel vorgesehen. Erst mit der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat sei ihre Streichung in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht worden. Dies sei eine im konkreten Zeitpunkt überraschende Änderung des Gesetzentwurfs in einem zentralen Punkt gewesen. Danach hätten nur noch zwei Tage bis zur abschließenden Beratung und Beschlussfassung im Deutschen Bundestag zur Verfügung gestanden, was keine angemessene Vorbereitung ermöglicht habe. Mit dieser Vorgehensweise sei die zentrale Bedeutung der Gesetzesberatung missachtet worden. Die von der Neugestaltung des Wahlrechts und vor allem der Streichung der Grundmandatsklausel besonders betroffene Opposition habe keine Möglichkeit gehabt, auf einen optimalen Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens hinzuwirken. So sei die während der Aussprache zur zweiten Lesung geäußerte Bitte des Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion, die abschließende Beratung und Beschlussfassung über das Gesetz um zwei Wochen zu vertagen, nicht aufgegriffen worden.
3. Die Antragstellenden und Beschwerdeführenden halten das Bundeswahlgesetz 2023 - in unterschiedlichem Umfang - außerdem für materiell verfassungswidrig.
a) Die Antragstellenden zu I., II. und III. halten das Verfahren der Zweitstimmendeckung gemäß § 1 Abs. 3Satz 2, § 6 Abs. 1 BWahlG für mit dem Grundgesetz unvereinbar. Es stelle einen Systemwechsel dar (aa) und verletze insbesondere die Grundsätze der gleichen (bb) und unmittelbaren (cc) Wahl aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG. Ebenso seien die Chancengleichheit der Parteien aus Art. 21 Abs. 1 GG (dd) sowie das Demokratieprinzip (ee) und das Bundesstaatsprinzip (ff) aus Art. 20 Abs. 1 GG verletzt.
aa) Der Gesetzgeber vollziehe einen Systemwechsel. Dies müsse an besonderen Maßstäben wie dem Gebot der Folgerichtigkeit gemessen werden. Andernfalls sei die Verfassungskonformität des Wechsels nicht überprüfbar, weil der Gleichheitsmaßstab lediglich innerhalb des neuen Systems gelte. Der Gesetzgeber verschleiere durch Kontinuitäten den Systemwechsel und verletze das Gebot der Folgerichtigkeit.
Bei dem Wahlsystem des Bundeswahlgesetzes 2023 handele es sich weiterhin um ein gemischtes System aus Elementen der Mehrheits- und der Verhältniswahl. Das ergebe sich aus dem "Empfängerhorizont" der Wählerinnen und Wähler und einer Gesamtbetrachtung der Bestimmungen des Bundeswahlgesetzes 2023. Dieses benenne weiterhin zwei Teile des Wahlsystems (§ 1 Abs. 2 Satz 2 BWahlG) und knüpfe die Sitzzuteilung in mehrfacher Hinsicht an die Ergebnisse der Wahlkreiswahl (§ 6 Abs. 1 und 2 BWahlG). Es gewähre nur solchen Wahlkreisbewerbern Vorrang vor Listenkandidaten ihrer jeweiligen Parteien, die die meisten Erststimmen ihres Wahlkreises errungen hätten, und nicht etwa solchen, die einen im Vergleich höheren, aber nicht den höchsten Erststimmenanteil ihres Wahlkreises erlangt hätten. Unter anderem diese - typisch mehrheitswahlrechtliche - Begünstigung des "Wahlkreisbesten" zeige, dass der Wahlkreiswahl weiterhin ein legitimatorischer Eigenwert zukomme und auch vom Gesetzgeber zugemessen werde.
bb) Das Zweitstimmendeckungsverfahren greife in den Grundsatz der Wahlgleichheit ein (1), ohne dass dies gerechtfertigt werden könne (2).
(1) Dem Eigenwert der Wahlkreiswahl entsprechend finde der Grundsatz der gleichen Wahl dahingehend Anwendung, dass grundsätzlich allen Wahlkreisbewerbern, die die meisten Erststimmen ihres Wahlkreises errungen hätten, ein Sitz im Deutschen Bundestag zugeteilt werden müsse. Dies sei das zentrale mehrheitswahlrechtliche Gleichheitsgebot. Danach müssten - so die Antragstellerin zu I. - in etwa gleich große Wahlkreise in gleichmäßiger Weise durch je einen unmittelbaren Repräsentanten im Deutschen Bundestag vertreten sein. Denn der spezifische Mehrwert der Mehrheitswahl bestehe in ihrer Personalisierung und Regionalisierung sowie konkret für die Wählerinnen und Wähler darin, einen unmittelbaren Einfluss auf die Bestimmung der aus ihrem Wahlkreis in den Deutschen Bundestag zu entsendenden Person nehmen zu können. Hiergegen verstoße das Verfahren der Zweitstimmendeckung, weil es zulasse, dass Wahlkreisbewerber, die die meisten Erststimmen ihres Wahlkreises errungen hätten, keinen Sitz im Deutschen Bundestag erhielten. Ein Widerspruch liege bereits darin, dass die Unterscheidung zwischen den erfolgreichen Wahlkreisbewerbern an die Ergebnisse der verhältniswahlrechtlichen Listenwahl anknüpfe. Außerdem nehme das Verfahren der Zweitstimmendeckung systematisch in Kauf, dass Wahlkreise ohne Repräsentanz durch den gewählten Wahlkreisbewerber verblieben. Wende man es auf die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 an, hätte dieser Repräsentanzverlust 9 bis 12 Prozent und in einzelnen Ländern noch deutlich höhere Anteile der Bevölkerung betroffen. Eine etwaige Vertretung der betroffenen Wahlkreise durch Listenkandidaten, die aus den jeweiligen Wahlkreisen stammten, aber über die Landeslisten ihrer Partei einen Sitz im Deutschen Bundestag erlangt hätten, stelle keinen adäquaten Ersatz dar.
In den Grundsatz der gleichen Wahl werde auch dann eingegriffen, wenn er lediglich als allgemeines Gebot der Erfolgschancengleichheit Anwendung finde. Insbesondere seien die Erststimmenanteile in verschiedenen Wahlkreisen angesichts deren unterschiedlicher sozio-ökonomischer Zusammensetzung strukturell nicht miteinander vergleichbar. Jedenfalls seien die Erfolgschancen zwischen parteigebundenen Bewerbern und unabhängigen Bewerbern, die nicht dem Verfahren der Zweitstimmendeckung unterlägen, unterschiedlich verteilt.
Außerdem werde in die Wahlgleichheit selbst dann eingegriffen, wenn man das System des Bundeswahlgesetzes 2023 als reine Verhältniswahl bewerten wolle. Denn dann gelte das Gebot der Erfolgswertgleichheit, das durch die unterschiedlichen Erfolgswerte der Wählerstimmen für "Wahlkreisbeste", die im Verfahren der Zweitstimmendeckung ein oder eben kein Mandat erhielten, offensichtlich nicht erfüllt werde. Insgesamt seien die Bestimmungen des Bundeswahlgesetzes 2023 durch mehrfache Systembrüche und entsprechende Verstöße gegen das (wahlrechtliche) Gebot der Folgerichtigkeit geprägt.
(2) Der Eingriff in den Grundsatz der gleichen Wahl sei auch nicht gerechtfertigt. Das gesetzgeberische Ziel, die Größe des Deutschen Bundestages zu begrenzen, habe allenfalls eingeschränktes Gewicht. Es sei weder ersichtlich noch vom Gesetzgeber dargelegt worden, dass die Funktionsfähigkeit des Parlaments gefährdet sei. Zwar sei es legitim, auch unterhalb dieser Schwelle eine Optimierung der Größe und Funktionsfähigkeit des Bundestages anzustreben. Allerdings stelle das Anliegen dann nur einen (einfachen) Belang innerhalb der Abwägung verschiedener öffentlicher Interessen bei der Neugestaltung des Wahlsystems dar. Hinzu komme, dass sich die gesetzgeberische Verfolgung dieses Anliegens widersprüchlich gestalte, da die Regelgröße des Deutschen Bundestages - anders als im Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen vorgesehen (vgl. oben Rn. 26) - auf 630 Sitze erhöht worden sei.
Das Ziel einer vollständigen Durchsetzung des sich aus dem Zweitstimmenergebnis ergebenden Parteiproporzes, das der Gesetzgeber verfolge, sei ebenfalls legitim. Es erfordere aber nicht die Nichtzuteilung von Bundestagsmandaten an "Wahlkreisbeste". Denn dieses Ziel könne auf ebenso effektive, aber weniger eingriffsintensive Art durch einen vollständigen Ausgleich aller Überhangmandate oder durch eine Verrechnung der in einem Land angefallenen Überhangmandate mit anderen Landeslisten der betreffenden Partei erreicht werden. Nach alledem sei jedenfalls das Gebot eines schonenden Ausgleichs zwischen den mehrheits- und verhältniswahlrechtlichen Elementen des Wahlsystems und etwaigen weiteren damit verfolgten Belangen durch den einseitigen Eingriff in die Systematik und Zielsetzung der mehrheitswahlrechtlichen Wahlkreiswahl auf drastische Weise missachtet worden.
cc) Die Antragstellenden zu II. und III. sehen auch einen Verstoß gegen die Unmittelbarkeit der Wahl. Die Wählerinnen und Wähler könnten aufgrund der Wechselwirkungen zwischen der Mehrheitswahl im eigenen Wahlkreis, den Mehrheitswahlen in den anderen Wahlkreisen und der bundesweiten Verhältniswahl nach Landeslisten ex ante nicht einschätzen, ob ihre Stimme überhaupt Wirkung entfalten werde. Die Bestimmungen des Bundeswahlgesetzes 2023 ließen den widersinnigen Effekt zu, dass ein "Wahlkreisbester" nicht in den Bundestag einziehe, während ein im direkten Vergleich schwächerer Wahlkreisbewerber einer anderen Partei über deren Liste ein Mandat erhalte und dann sogar - nach den Annahmen des Gesetzgebers - den jeweiligen Wahlkreis im Deutschen Bundestag repräsentieren solle.
dd) Darüber hinaus werde der Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien aus Art. 21 Abs. 1 GGverletzt. Parteien, die im Einklang mit Art. 21 Abs. 1 GG föderale Schwerpunkte herausgebildet oder sich organisatorisch auf ein Land beschränkt hätten und daher strukturell Überhangmandate erzielten, würden spezifisch benachteiligt. Dies sei besonders deswegen problematisch, weil hiervon vor allem die im Zeitpunkt des Gesetzesbeschlusses oppositionellen Unionsparteien betroffen seien. Die aktuelle Regierungsmehrheit dürfe aber die demokratische Chance auf einen politischen Wechsel nicht dadurch abschneiden, dass sie diesen durch Regeländerungen zielgerichtet erschwere. Dies geschehe aber, indem das Bundeswahlgesetz 2023 in die gewachsene Wettbewerbssituation einseitig zulasten einzelner Parteien eingreife.
Der Antragsteller zu III. sieht sich als Partei durch den Beschluss des Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes 2023 in seinem Recht auf Chancengleichheit aus Art. 21 Abs. 1 und Art. 38 Abs. 1GG unter anderem deswegen verletzt, weil das Verfahren der Zweitstimmendeckung einen Eingriff in weiterhin geltende mehrheitswahlrechtliche Grundsätze bedeute. Dieser könne weder durch eine bloße Gefahrenprognose zur angeblich drohenden Funktionsunfähigkeit des Deutschen Bundestages noch durch das "Kostenargument" gerechtfertigt werden. Vielmehr müsse der Gesetzgeber, dem für solch grundlegende Strukturänderungen des Wahlrechts nur ein eng bemessener Spielraum bleibe, die Notwendigkeit einer Reduktion der Bundestagsgröße substantiiert darlegen.
ee) Weiterhin werde gegen das Demokratieprinzip aus Art. 20 Abs. 1 GG verstoßen. Im Verfahren der Zweitstimmendeckung werde gegebenenfalls die Mehrheit im Wahlkreis für irrelevant erklärt. Darüber hinaus sei die aus dem Demokratieprinzip folgende Repräsentations- und Integrationsfunktion der Wahl durch die zu befürchtenden Repräsentationslücken und die Missachtung der legitimatorischen Wirkung der Wahlkreiswahl gefährdet. Lokale Anliegen drohten aus dem parlamentarischen Betrieb ausgeschlossen zu werden - zumal, wenn Wahlkreise strukturell und daher langfristig nicht durch den gewählten Wahlkreisbewerber im Deutschen Bundestag vertreten würden. Es bestehe die Gefahr, dass die Wählerinnen und Wähler das Vertrauen in den Wert der Erststimme und damit letztlich in die demokratische Integrität des Wahlsystems verlören.
ff) Schließlich sehen die Antragstellenden zu I. und II. auch das Bundesstaatsprinzip aus Art. 20 Abs. 1GG verletzt. Wenn der Gesetzgeber das Wahlrecht dahingehend föderal ausgestalte, dass er die Länderebene in einer mandatsrelevanten Weise zwischen dem Gesamtwahlgebiet und den einzelnen Wahlkreisen einbeziehe, sei das Bundesstaatsprinzip zu beachten. Eine Pflicht zur Berücksichtigung föderaler Belange könne auch dann bestehen, wenn keine überwiegenden verfassungsrechtlichen Aspekte entgegenstünden. Sie würden dadurch beeinträchtigt, dass sich der Anteil der nicht durch den erststimmenstärksten Wahlkreisbewerber repräsentierten Wahlkreise zwischen den Ländern deutlich unterscheiden werde. Im Ergebnis sei die Zahl der gewählten Wahlkreisabgeordneten nicht mehr bevölkerungsproportional auf die Länder verteilt, obwohl die Zahl der Wahlkreise nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWahIG im Ausgangspunkt exakt bevölkerungsproportional auf die Länder verteilt werde.
b) Alle Antragstellenden und Beschwerdeführenden wenden sich gegen die Zugangshürde zur Sitzverteilung im Deutschen Bundestag gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG. Die Beschwerdeführenden zu VI. halten die dort geregelte Sperrklausel in Höhe von 5 Prozent für unvereinbar mit dem Grundgesetz (aa). Die anderen Antragstellenden und Beschwerdeführenden greifen das Fehlen einer der Grundmandatsklausel entsprechenden Alternative zur bundesweiten Fünf-Prozent-Hürde an (bb).
aa) Nach Auffassung der Beschwerdeführenden zu VI. wird die Sperrklausel in Höhe von 5 Prozent den verschärften Maßstäben, die das Bundesverfassungsgericht für die Rechtfertigung eines solchen Eingriffs in die Erfolgswertgleichheit der Zweitstimmen aufstelle (1), nicht gerecht (2).
(1) Das Bundesverfassungsgericht wende den früher angeführten Rechtfertigungsgrund der "Bekämpfung von Splitterparteien" beziehungsweise der legitimen Bevorzugung großer Parteien aufgrund ihrer angeblich höheren Gemeinwohlorientierung und damit besseren Eignung für die Aufgaben der Volksvertretung nicht mehr an. Vielmehr werde anerkannt, dass es nicht Aufgabe der Wahlgesetzgebung sei, die Bandbreite des politischen Meinungsspektrums zu reduzieren. Die Integrationsfunktion der Wahl werde nicht mehr (nur) in der Schaffung einer funktionsfähigen Volksvertretung gesehen. Die Funktionsfähigkeit werde zunehmend im Kontext des konkreten Aufgabenkreises des jeweils zu wählenden Vertretungsorgans beurteilt. Die allgemeine und abstrakte Behauptung, ohne (Fünf-Prozent-)Sperrklausel werde durch den Einzug kleinerer Parteien in das betreffende Vertretungsorgan dessen Willensbildung erschwert, genüge nicht mehr.
Vor diesem Hintergrund treffe den Gesetzgeber eine ständige Beobachtungs- und Evaluierungspflicht. Diese habe sich aktualisiert, nachdem sich das normative Umfeld der Sperrklausel durch ihre erstmalige Auswirkung auf Wahlkreisbewerber und den Wegfall der Grundmandatsklausel grundlegend geändert habe. Da der Gesetzgeber dieser Pflicht nicht nachgekommen sei, bleibe die verfassungsrechtliche Neubewertung der Sperrklausel nunmehr dem Bundesverfassungsgericht überlassen.
Zwar sei die Zielsetzung legitim, die Funktionsfähigkeit des Deutschen Bundestages zu sichern. Allerdings stehe dies in einem Spannungsverhältnis zu der Notwendigkeit, die Wahl als Integrationsvorgang bei der politischen Willensbildung des Volkes auszugestalten. Denn die Sperrklausel wirke desintegrierend, indem sie bestimme, dass Wählerstimmen im demokratischen Willensbildungsprozess des Parlaments nicht abgebildet würden. Vor diesem Hintergrund sei sie nur zulässig, wenn und soweit sie in verhältnismäßiger Weise dessen Funktionsfähigkeit diene.
(2) Hiernach sei die Sperrklausel jedenfalls in Höhe von 5 Prozent nicht gerechtfertigt. Ihre Eignung zu diesem Zweck sei seit jeher fragwürdig gewesen. Entgegen seiner ständigen Beobachtungs- und Evaluierungspflicht habe sich der Gesetzgeber weitgehend unausgesprochen auf die allgemeine und abstrakte Behauptung gestützt, dass sie die Funktionsfähigkeit des Bundestages sichere. Auch in dem Gesetzgebungsverfahren zum Erlass des Bundeswahlgesetzes 2023 habe er es versäumt, insofern einen nachvollziehbaren Zusammenhang herzustellen.
Erst recht habe der Gesetzgeber nicht begründet, warum nicht auch eine abgesenkte oder regionalisierte Sperrklausel ausreiche. Beispiele aus den vergangenen Legislaturperioden zeigten auf, dass dies der Fall sei. So habe die regionalisierte Sperrklausel bei der ersten Bundestagswahl eine Koalitionsbildung (eines "Parteiblocks") ermöglicht und damit stabilisierend gewirkt. Bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl habe sie die Integration der ostdeutschen Parteien in den bundesdeutschen Parlamentarismus erleichtert. Eine auf beispielsweise 3 Prozent abgesenkte Sperrklausel hätte bei den Bundestagswahlen im 21. Jahrhundert entweder keine Änderung der Mehrheitsverhältnisse bewirkt oder die Regierungsbildung jedenfalls nicht erschwert. Die Sperrklausel leiste damit keinen ersichtlichen Beitrag zur Erreichung ihres Ziels.
Sie wirke vielmehr politisch-legitimatorisch kontraproduktiv. Die Integrationsfunktion der Wahl werde durch den wachsenden sperrklauselbedingten Ausfall an Stimmen zunehmend gefährdet. Die den betroffenen Parteien eigentlich zustehenden Mandate würden auf andere, von ihren Wählerinnen und Wählern aber gerade nicht bevorzugte Parteien verteilt. Dies wirke insbesondere an den politischen Rändern desintegrierend. Dabei hätten sich in der Vergangenheit bestimmte Minderheitsanliegen als wichtige Zukunftsthemen herausgestellt, aber wegen der Sperrklausel erst mit unnötiger Verzögerung den parlamentarischen Prozess erreicht. Die Sperrklausel führe zu künstlichen parlamentarischen Mehrheiten und verenge das parlamentarische Spektrum in einer Weise, die die tatsächliche parteipolitische und gesellschaftliche Vielfalt nicht mehr adäquat zum Ausdruck bringe.
bb) Die weiteren Antragstellenden und Beschwerdeführenden beanstanden, dass die Sperrklausel des § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG nicht mehr durch eine "angepasste Grundmandatsklausel" entsprechend § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BWahlG 2020 abgemildert werde. Dies widerspreche prozeduralen (1) und materiellen (2) Anforderungen. Insbesondere die Antragstellerin zu I. macht geltend, dass eine Abmilderung auch durch eine anderweitige "Regionalkomponente" erfolgen könne.
(1) Durch die Streichung der Grundmandatsklausel habe sich die Pflicht des Gesetzgebers zur fortlaufenden Überprüfung und gegebenenfalls Nachbesserung der Sperrklausel aktualisiert. Diese habe er verletzt, da die Streichung erst zwei Tage vor der abschließenden Beratung und Beschlussfassung im Deutschen Bundestag in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht worden sei. Damit habe - trotz entsprechender Hinweise aus den Oppositionsfraktionen - nicht ausreichend Zeit zur Auseinandersetzung mit den weitreichenden Auswirkungen dieser Maßnahme zur Verfügung gestanden.
(2) Außerdem sei die Streichung der Grundmandatsklausel auch materiell unzulässig, da sie die Rechtsbeeinträchtigungen weiter verschärfe, die im Ansatz bereits durch die Sperrklausel wie auch das Verfahren der Zweitstimmendeckung bewirkt würden (a). Zudem seien das Bundesstaatsprinzip (b), die Chancengleichheit der Parteien (c) und der Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl (d) verletzt.
(a) Der massive Eingriff in die Wahlgleichheit durch die nunmehr ohne alternativen Zugang verschärfte Sperrklausel komme zu den Eingriffen durch das Zweitstimmendeckungsverfahren hinzu. Dies verstärke die desintegrativen Wirkungen des Wahlrechts in einem nicht mehr hinnehmbaren Maß.
Der Gesetzgeber missachte die Integrations- und Repräsentationsfunktion der Wahl, die eine gesetzliche Sicherstellung dahin verlange, dass alle bedeutsamen politischen Parteien im Parlament vertreten seien. Die Bestimmung der Bedeutsamkeit müsse Parteien mit einem örtlichen Schwerpunkt besonders berücksichtigen und sich insbesondere an der politischen Realität orientieren. Im Gegensatz hierzu werde vollständig außer Acht gelassen, dass die Streichung der Grundmandatsklausel das plötzliche Ende der Vertretung der bayerischen Wählerinnen und Wähler durch eine dezidiert bayerische Partei bedeuten könnte, die es seit über 150 Jahren und seit über 75 Jahren durch den Antragsteller zu III. gegeben habe.
Die Streichung der Grundmandatsklausel sei auch nicht zur Vermeidung eines "Systembruchs" erforderlich. Die Grundmandatsklausel stelle schon keinen solchen dar, weil sie nur vordergründig dem mehrheitswahlrechtlichen Segment der personalisierten Verhältniswahl zuzuordnen sei. Ihr Fortbestand sei vielmehr zwingend, weil das personenwahlrechtliche Element des Wahlsystems erhalten bleibe und die Wahlkreisabgeordneten sogar einen relativen Bedeutungsgewinn erfahren würden. Auch wenn man eine Systemdurchbrechung annehme, könne der allenfalls geringfügige Gewinn an Folgerichtigkeit die unerträglichen Verluste an Wahlgleichheit nicht rechtfertigen.
(b) Diese Bedenken gälten auch für weitere Belange von Verfassungsrang, insbesondere das Bundesstaatsprinzip. Wäre durch das Zusammenwirken der Sperrklausel mit dem Zweitstimmendeckungsverfahren ein ganzes Land nicht mehr durch diejenige Landespartei, deren Kandidaten nahezu alle Wahlkreise in diesem Land gewonnen hätten, im Deutschen Bundestag vertreten, führte dies zu erheblichen föderalen Proporzverzerrungen. Denn aufgrund des landesweit hohen Zweitstimmenanteils dieser Landespartei stünden weniger berücksichtigungsfähige Zweitstimmen für die Landeslisten anderer Parteien zur Verfügung. Die Wählerinnen und Wähler dieses Landes wären im Deutschen Bundestag insgesamt unterrepräsentiert.
(c) Außerdem werde der Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien verletzt. Der Gesetzgeber dürfe die vorgefundene Wettbewerbslage zwischen Parteien nicht durch das Wahlrecht verfälschen. Die Entscheidung namentlich des Antragstellers zu III., nur in Bayern antreten zu wollen, sei von Art. 21 Abs. 1 GG geschützt. Die Streichung der Grundmandatsklausel wirke sich einseitig zulasten von Oppositionsparteien aus. Da es keinen sachlichen Grund für die Neuregelungen gebe, handele es sich um eine evidente Gegnerbenachteiligung.
Die Beschwerdeführenden zu VII. machen geltend, dass ihr Anspruch auf formal gleichmäßige Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts missachtet werde. Ihre Stimmen würden im Vergleich mit den für unabhängige Wahlkreisbewerber abgegebenen Stimmen, auf welche die Sperrklausel keine Anwendung finde, ungerechtfertigt ungleich behandelt.
(d) Die Antragstellenden zu II. rügen außerdem eine Verletzung des Grundsatzes der Unmittelbarkeit der Wahl, weil die Streichung der Grundmandatsklausel weitere Fallkonstellationen des (Nicht-)Erfolgs in der Wahlkreiswahl eröffne und damit diesen Teil des Sitzzuteilungsverfahrens vollends nicht mehr nachvollziehbar mache.
III.
1. Der Bundespräsident, der Deutsche Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung, in den Normenkontrollverfahren und zu den Verfassungsbeschwerden darüber hinaus alle Landesregierungen haben Gelegenheit zur Äußerung erhalten. Hiervon haben der Bundestag, die Bundesregierung und im Normenkontrollverfahren zu I. die Regierung des Landes Sachsen-Anhalt Gebrauch gemacht.
a) Der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung halten die Anträge und die Verfassungsbeschwerden teils für unzulässig und insgesamt für unbegründet. Die beanstandeten Regelungen des Bundeswahlgesetzes 2023 seien formell verfassungsmäßig (aa) und sowohl das Zweitstimmendeckungsverfahren (bb) als auch die Sperrklausel (cc) materiell verfassungskonform.
aa) Das Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes 2023 sei formell verfassungsgemäß zustande gekommen. Ein - wie hier - geschäftsordnungskonformes Gesetzgebungsverfahren könne nur in evidenten Ausnahmefällen das aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG folgende Recht der Abgeordneten auf gleichberechtigte Teilhabe an der parlamentarischen Willensbildung und damit auch die Möglichkeit, sich über den Beratungsgegenstand auf der Grundlage ausreichender Informationen eine eigene Meinung zu bilden, verletzen.
Ein solche Ausnahme liege hier nicht vor. Abgesehen davon, dass dem Gesetzgebungsverfahren eine langjährige Reformdebatte vorausgegangen und das Bundeswahlgesetz 2023 weder umfangreich noch technisch übermäßig komplex sei, sei auch die Streichung der Grundmandatsklausel kein "Überraschungsakt", sondern im zuständigen Ausschuss im Rahmen der Sachverständigenanhörung diskutiert worden. Ein daraus folgender Änderungsvorschlag entspreche gerade dem Sinn und Zweck der Ausschussberatungen, die integrales Element der Willensbildung des Bundestages und Ausdruck des Teilhaberechts der Abgeordneten hieran seien.
bb) Das in § 1 Abs. 3, § 6 Abs. 1 BWahlG geregelte Verfahren der Zweitstimmendeckung sei auch materiell verfassungsgemäß. Der Gesetzgeber dürfe diese Systementscheidung treffen (1) und verletze weder die Gleichheit (2) noch die Unmittelbarkeit (3) der Wahl. Auch die Chancengleichheit der Parteien (4) sowie die Vorgaben des Demokratieprinzips (5) und des Bundesstaatsprinzips (6) seien gewahrt.
(1) Eine Reform des Wahlrechts unterliege keinem Rechtfertigungszwang. Mit dem Bundeswahlgesetz2023 habe der Gesetzgeber eine explizite Systementscheidung zugunsten der Grundsätze der Verhältniswahl getroffen. Die Beibehaltung der Wahlkreiswahl sei ein Systemelement, das weder systemwidrig sei noch die Geltung mehrheitswahlrechtlicher Maßstäbe für die Wahlkreiswahl auslöse. Vielmehr sei das "personale Restelement" der Wahlkreiswahl der Verhältniswahl systematisch untergeordnet, was sich im Kollisionsfall gerade an der Verhinderung von Überhangmandaten zeige. Es diene nur noch einer lokal radizierten, demokratisch legitimierten Vorauswahl der Kandidierenden.
(2) Ein Verstoß gegen den Grundsatz der gleichen Wahl aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG liege nicht vor (a). Auch wenn man dies anders sehen wollte, sei ein Eingriff in die Wahlgleichheit gerechtfertigt (b).
(a) Entscheidend für die Frage der Wahlgleichheit seien lediglich die Kategorien der Zählwert- und Erfolgschancengleichheit. Es sei nicht notwendig, das Wahlsystem insgesamt oder seine Elemente dem Mehrheits- oder Verhältniswahlrecht zuzuordnen. Aus der Einteilung des Wahlgebiets in mehrere selbständige, nach regionalen Kriterien gebildete Wahlkörper ergebe sich zwar das Gebot einer möglichst gleichen Größe der Wahlkreise. Daraus folge aber weder, dass im Mehrheitswahlsystem zwingend eine Wahl nach territorialen Wahlkreisen stattfinden müsse, noch, dass das Mehrheitswahlsystem eine gleichmäßige territoriale Repräsentation erfordere. Es bestehe kein Gebot eines "möglichst strikten Gebietsproporzes der Repräsentation". Es gebe auch kein subjektives Recht auf Vertretung des eigenen Wahlkreises.
Die Erfolgschancengleichheit der Wählerstimmen sei gewahrt, da alle Erststimmen den gleichen Bedingungen unterlägen. Es sei keine Ungleichbehandlung, dass manche erfolgreichen Wahlkreisbewerber sich im Verfahren der Zweitstimmendeckung nicht durchsetzen könnten, weil mit den meisten Erststimmen im Wahlkreis eben kein Direktmandat verbunden sei. Die verglichenen Gruppen von Wahlkreisbewerbern konstituierten sich erst durch das Wahlergebnis. Maßgeblich sei nicht die Anzahl der Wählerstimmen, sondern der im Stimmenanteil ausgedrückte unterschiedliche relative Erfolg.
Auch darin, dass unabhängige Wahlkreisbewerber ohne Zweitstimmendeckung in den Bundestag einziehen könnten, liege keine Ungleichbehandlung. Nur auf diesem Wege könne die Anforderung des Bundesverfassungsgerichts, wonach auch unabhängigen Bewerbern die Möglichkeit einer Bundestagskandidatur zu eröffnen sei (BVerfGE 41, 399 <416 f.>), erfüllt werden. Der Verzicht auf eine Zweitstimmendeckung kompensiere kaum den fehlenden Rückhalt einer Partei. Die Sonderregelung sei überdies nicht missbrauchsanfällig. Träten erfolgversprechende Wahlkreisbewerber einer Partei vorgeblich als Unabhängige an, riskierten ihre Parteien wegen § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 BWahlG einen Verlust an Zweitstimmen, der insbesondere für das Überschreiten der Fünf-Prozent-Hürde von Bedeutung sein könne.
Ziehe man außerdem den Maßstab der Erfolgswertgleichheit heran, weil der Gesetzgeber sich für die Grundsätze der Verhältniswahl entschieden habe, ergäben sich daraus für die Berücksichtigung der Wahlkreise bei der Sitzzuteilung keine weiteren Vorgaben. Dies zeige sich auch daran, dass die Einführung von offenen Listen mit der Möglichkeit des Kumulierens und Panaschierens nicht gegen den Grundsatz der gleichen Wahl verstoße. Dabei wie auch bei der nunmehrigen Wahlkreiswahl handele es sich um ein Personenersetzungsrecht gegenüber der von der Partei gewählten Reihung ihrer Kandidierenden. Es sei nicht erkennbar, warum (nur) die dezentralisierte Personenersetzungsvariante mit Wahlkreisbezug unzulässig sein solle.
(b) Hiervon unabhängig sei ein Eingriff in die Wahlgleichheit durch das Regelungsziel einer Verkleinerung des Deutschen Bundestages gerechtfertigt. Dadurch werde dessen Funktionsfähigkeit gesichert. Dies sei auch im Vorfeld echter Dysfunktionalitäten von Bedeutung. Seien diese erst einmal eingetreten, könne der Bundestag nicht mehr über ein neues Wahlsystem entscheiden.
Im Allgemeinen lasse sich festhalten, dass die Schwerfälligkeit einer Organisation mit ihrer Größe zunehme. Dies gelte in besonderem Maße für den Bundestag, der in Fraktionen fragmentiert und zur Entscheidungs- und Mehrheitsfindung auf eine Koalitionsbildung angewiesen sei. Die Arbeitsfähigkeit der Ausschüsse mache oberhalb einer Größe von 20 Mitgliedern eine Arbeitsteilung auch innerhalb der Ausschüsse erforderlich, was ihrem Zweck eigentlich zuwiderlaufe. Zugleich müsse das Abgeordnetenrecht auf mindestens eine Ausschussmitgliedschaft sichergestellt werden. Der Bundestag dürfe im Rahmen seines Selbstorganisationsrechts Strategien eines arbeitsteiligen Zusammenwirkens entwickeln. Eine stetig wachsende Größe des Bundestages stelle funktionierende Formen irgendwann infrage.
Das Verfahren der Zweitstimmendeckung sei geeignet und erforderlich, um eine zuverlässige Verkleinerung des Bundestages zu erreichen. Ebenso sei es verhältnismäßig im engeren Sinne, da es das bestehende System lediglich im Sinne einer konsequenteren proportionalen Repräsentation modifiziere. Die Wahlkreisabgeordneten würden nicht marginalisiert, sondern vielmehr ihr Anteil an den Bundestagsabgeordneten insgesamt potentiell erhöht.
(3) Der Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG sei nicht berührt. Es sei ohne Weiteres erkennbar, wie sich die eigene Stimmabgabe auf die spätere Mandatsverteilung potentiell auswirken könne. Jede Einzelstimme zugunsten eines Wahlkreisbewerbers erhöhe dessen Erfolgschance bei der Sitzzuteilung nach dem Zweitstimmendeckungsverfahren.
(4) In die Chancengleichheit der politischen Parteien aus Art. 21 Abs. 1 GG werde nicht eingegriffen, weil das Zweitstimmendeckungsverfahren Parteien formell und faktisch gleichbehandle. Eine "breite Verankerung in der Fläche" werde nicht bestraft. Vielmehr werde eine Partei von dem Verfahren der Zweitstimmendeckung unberührt bleiben, wenn sie tatsächlich so breit in der Fläche verankert sei, dass sie auch entsprechend hohe Zweitstimmenanteile erziele.
(5) Ein aus dem Demokratieprinzip folgendes Mehrheitsprinzip werde ebenfalls nicht verletzt. Es umfasse in aller Regel nur den Grundsatz der absoluten Mehrheit. Die stetige Vergrößerung des Deutschen Bundestages beruhe aber gerade darauf, dass Parteien inzwischen nur noch relative Mehrheiten erreichten. Mit einem relativ geringen Anteil an Erst- und Zweitstimmen könne eine Partei immer noch viele Wahlkreise gewinnen. In diesen Fällen sei die Legitimation der Wahlkreisabgeordneten schwach und erst die Verknüpfung von Erst- und Zweitstimmenergebnis führe zu einem die Mehrheitsverhältnisse angemessen berücksichtigenden Ergebnis.
Auch eine unzulässige Verzerrung der demokratischen Repräsentation finde nicht statt. Im Gegenteil werde die Legitimation der (zweitstimmengedeckten) Wahlkreisabgeordneten gestärkt. Schließlich sei es die Wahl nach Parteilisten, die maßgeblich zur Integration beitrage, wohingegen die Wahlkreiswahl geeignet sei, diese durch eine Verzerrung ihrer Ergebnisse zu gefährden. Vor diesem Hintergrund sei nicht erkennbar, dass die lokale Parzellierung von Wahlgebieten sozial oder politisch integrierend wirken könnte.
(6) Schließlich werde auch das Bundesstaatsprinzip nicht verletzt. In der vom Grundgesetz verfassten Mehrebenendemokratie würden lokale und föderale Interessen grundsätzlich nicht auf Bundesebene parlamentarisch repräsentiert. Es stehe nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts fest, dass der unitarische Charakter der Bundestagswahl keine Berücksichtigung föderaler Belange im Wahlrecht erfordere.
cc) Die in § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG vorgesehene Sperrklausel sei ebenfalls materiell verfassungskonform. Sie sei durch ihr Ziel, stabile parlamentarische Mehrheiten zu sichern, gerechtfertigt (1). Daran ändere auch die Streichung der Grundmandatsklausel nichts (2), selbst wenn der Antragsteller zu III. einen bundesweiten Zweitstimmenanteil von 5 Prozent verfehlen sollte (3).
(1) Die mit der Sperrklausel bewirkte Beeinträchtigung der Erfolgswertgleichheit der Wählerstimmen sei zur Sicherung stabiler parlamentarischer Mehrheiten gerechtfertigt. Eine Regierung solle nicht zu viele politische Partner vereinen müssen. Zum einen könnten deren unterschiedliche inhaltliche Ausrichtungen die Entscheidungs- und Kompromissfähigkeit beeinträchtigen, zum anderen könnte ein Zusammenschluss besonders großer Partner die parlamentarische Opposition weitgehend verdrängen. Es gehe dabei vor allem um die Konzentrationswirkung, die die Sperrklausel auf das Parteiensystem habe. Sie wirke strukturell zugunsten von Parteien, die sich durch ein Mindestmaß an innerer Koordinierungs- und Kompromissfähigkeit auszeichneten, was wiederum für den Bundestag als gesetzgebendes Arbeitsparlament förderlich sei. Der in Art. 38 Abs. 1 GG verankerte Grundsatz der Spiegelbildlichkeit könne bei einer Vielzahl von politischen Gruppen mit jeweils nur einem Mitglied nicht verwirklicht werden.
Außerdem beruhe die Sperrklausel auf dem historischen Wahlrechtskompromiss zwischen den politischen Lagern und sei für dessen Akzeptanz entscheidend gewesen, da sie extreme Konsequenzen des Mehrheits- wie auch des Verhältniswahlrechts vermieden und auch Parteineugründungen nicht übermäßig erschwert habe. Heute sei ihre Bedeutung angesichts der gestiegenen Anzahl an Parteien im Parlament und der dadurch erschwerten Mehrheits- und Regierungsbildung eher noch gestiegen.
(2) An der Verfassungsmäßigkeit der Sperrklausel ändere die nunmehrige Streichung der Grundmandatsklausel nichts.
Die Systemwahlfreiheit des Gesetzgebers aus Art. 38 Abs. 3 GG umfasse die Frage, inwieweit regionale oder föderative Elemente im Bundestagswahlrecht abgebildet würden. Etwas anderes folge auch nicht aus dem Bundesstaatsprinzip oder dem Grundsatz der Betätigungsfreiheit der Parteien aus Art. 21 Abs. 1GG. Letzterer garantiere den Parteien zwar auch die Freiheit einer geographischen Konzentration, nicht aber, dass das Wahlrecht einer solchen Rechnung tragen müsse. Umgekehrt würde eine Neutralitätspflicht des Gesetzgebers, wonach sich Änderungen des Wahlrechts nicht auf derzeit miteinander im Wettbewerb stehende Parteien (potentiell) ungleich auswirken dürften, dessen Gestaltungsfreiheit weitgehend leerlaufen lassen.
Nach diesen Maßstäben stelle sich gerade die Streichung der Grundmandatsklausel als systemgerecht dar. Sie bleibe innerhalb der Entscheidung für das Verhältniswahlrecht, die die Funktion der Wahlkreise konsequent auf die Idee der Proportionalwahl mit Landeslisten hin neu orientiere. Mit dieser Systementscheidung hätte die Beibehaltung eines Wahlrechtselements, das an die Personenwahl in den Wahlkreisen anknüpfe, in einem gewissen Spannungsverhältnis gestanden.
Darüber hinaus fördere die Streichung der Grundmandatsklausel gerade die Gleichheitsgerechtigkeit des Wahlrechts. Sie sei eine gleichheitsverzerrende Ausnahme von der Sperrklausel gewesen. Es sei stets zweifelhaft gewesen, warum drei - unter Umständen geographisch weit verstreute - relative Wahlkreismehrheiten die politische Bedeutsamkeit einer Partei begründen sollten. Die Wahlkreisgewinne hätten keinen Parteierfolg, sondern gerade eine höhere Zustimmung zu den jeweiligen Einzelbewerbern abgebildet.
(3) Die Integrationsfunktion der Wahl werde schließlich selbst dann nicht infrage gestellt, wenn tatsächlich Wahlkreisbewerber des Antragstellers zu III. in einer Vielzahl bayerischer Wahlkreise die Stimmenmehrheit erlangten, die Partei aber einen bundesweiten Zweitstimmenanteil von 5 Prozent verfehlen sollte. Bereits im bisherigen Wahlrecht habe es föderale Repräsentationsverzerrungen gegeben. Wählerinnen und Wähler solcher Landeslisten, bei denen Überhangmandate angefallen seien, seien gegenüber Wählerinnen und Wählern anderer Landeslisten derselben Partei überrepräsentiert gewesen. Der Gesetzgeber gebe weiterhin einer politisch proportionalen Repräsentation den Vorzug vor einer regional proportionalen Repräsentation der Wählerinnen und Wähler. Vor diesem Hintergrund sei eine mögliche "Unterrepräsentation" der bayerischen nicht anders zu bewerten als die Nichtrepräsentation aller anderen Wählerinnen und Wähler einer an der Fünf-Prozent-Hürde gescheiterten Partei.
b) Die Regierung des Landes Sachsen-Anhalt sieht mit dem Bundeswahlgesetz 2023 die Gefahr eines Repräsentationsdefizits für Sachsen-Anhalt und die anderen ostdeutschen Länder im Verhältnis zu den übrigen Ländern. Zum einen drohe die Partei DIE LINKE an der bundesweiten Fünf-Prozent-Hürde - ohne Grundmandatsklausel - zu scheitern und habe dabei in den ostdeutschen Ländern einen traditionell hohen Stimmanteil. Damit würden sich die Anteile der ostdeutschen Länder an der bundesweiten Anzahl mandatsrelevanter Zweitstimmen und dadurch ihre Landessitzkontingente überproportional verringern. Zum anderen drohe in den ostdeutschen Ländern eine Häufung von Wahlkreisen, die nicht durch den Wahlkreisbewerber mit den meisten Erststimmen vertreten würden.
Der Gesetzgeber habe die gebotene Gesetzesfolgenabschätzung versäumt. Dabei hätte sich ergeben, dass eine Absenkung der Sperrklausel verfassungsrechtlich zwingend sei.
2. Die CDU ist dem Organstreitverfahren zu III. auf Seiten des Antragstellers beigetreten (§ 65 Abs. 1BVerfGG ) und hat sich dessen Antrag angeschlossen.
IV.
In der mündlichen Verhandlung am 23. und 24. April 2024 haben die Beteiligten ihr Vorbringen vertieft und ergänzt. Als sachkundige Auskunftspersonen sind zu den Integrationsanforderungen, die aus politikwissenschaftlicher Sicht an ein Wahlsystem zu stellen sind, Prof. Dr. Frank Decker, Prof. Dr. Thorsten Faas und Prof. (em.) Dr. Hans Vorländer angehört worden.
B.
Die Normenkontrollverfahren sind zulässig. Die Organklagen und Verfassungsbeschwerden sind nur teilweise zulässig.
I.
Die Anträge in den Normenkontrollverfahren der Antragstellerin zu I. und der Antragstellenden zu II. sind zulässig.
II.
Die Verfassungsbeschwerden der Beschwerdeführenden zu VI. und VII. sind unzulässig, soweit diese ihre Beschwerdebefugnis nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG in Verbindung mit § 90 Abs. 1 BVerfGG nicht den Begründungsanforderungen der § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG entsprechend dargelegt haben (1.). Im Übrigen sind die Verfassungsbeschwerden zulässig (2.).
1. Den Begründungsanforderungen nach § 23 Abs. 1 Satz 2, § 92 BVerfGG (a) werden nur einige Verfassungsbeschwerden gerecht (b).
a) Die Begründung der Verfassungsbeschwerde soll dem Bundesverfassungsgericht eine zuverlässige Grundlage für die weitere Behandlung des Verfahrens verschaffen (vgl. BVerfGE 15, 288 <292>). Hiernach sind Beschwerdeführende gehalten, den Sachverhalt, aus dem sich die Grundrechtsverletzung ergeben soll, substantiiert und schlüssig darzulegen. Es ist alles darzutun, was dem Gericht eine Entscheidung der verfassungsrechtlichen Fragen ermöglicht (vgl. BVerfGE 131, 66 <82>). Pauschale Bezugnahmen auf Anlagen genügen dabei nicht. Es ist nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, aufgrund undifferenzierter Hinweise oder pauschaler Inbezugnahmen die Anhaltspunkte zu verfassungsrechtlich relevanten Sachverhalten herauszufinden (vgl. BVerfGE 80, 257 <263>; 83, 216 <228>; ferner BVerfGE 131, 66 <82>).
Auch Rechtssatzverfassungsbeschwerden müssen konkret darlegen, inwiefern die Beschwerdeführenden durch den angegriffenen Rechtssatz in einem ihrer beschwerdefähigen Rechte selbst, gegenwärtig und unmittelbar verletzt sein sollen (vgl. BVerfGE 89, 155 <171>; 129, 124 <167>). Orientieren sich Beschwerdeführende an "Vorlagen" oder schließen sie sich ausgearbeiteten Entwürfen einer Beschwerdeschrift an, gelten keine anderen Anforderungen (vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 4. Oktober 2016 - 1 BvR 1704/16 -, Rn. 2).
Die für die Beschwerdebefugnis erforderliche Betroffenheit in dem hier geltend gemachten Recht aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG setzt voraus, dass die Beschwerdeführenden selbst wahlberechtigt sind (vgl. BVerfGE 1, 208 <237 f.>; 7, 63 <66>). Wahlberechtigt sind nach § 12 Abs. 1 BWahlG alle Deutschen im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG , die am Wahltage das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innehaben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und nicht nach § 13 BWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Dies ist in der Begründung der Verfassungsbeschwerde darzulegen.
b) Diesen Anforderungen werden in dem Verfahren zu VI. nur die Beschwerdeführenden zu 1. bis 3. (aa) und in dem Verfahren zu VII. nur die Beschwerdeführenden zu 1. bis 25. sowie 27. und 28. (bb) gerecht.
aa) In dem Verfahren zu VI. haben nur die Beschwerdeführenden zu 1. bis 3. ihre Beschwerdebefugnis hinreichend dargelegt. Die Beschwerdeschrift führt für diese drei Beschwerdeführenden aus, dass sie die Voraussetzungen der Wahlberechtigung erfüllen. Bezüglich der weiteren Beschwerdeführenden gibt die Beschwerdeschrift lediglich an, dass sie auf die Voraussetzungen hingewiesen worden seien. Sie lässt damit erkennbar Raum dafür, dass unter den weiteren 4.239 Beschwerdeführenden auch solche sind, die die Voraussetzungen für die Wahlberechtigung nicht erfüllen. Deren Verfassungsbeschwerden sind daher insgesamt unzulässig.
bb) Auch im Verfahren zu VII. genügen die Darlegungen zur Betroffenheit lediglich im Hinblick auf die Beschwerdeführenden zu 1. bis 25. sowie 27. und 28. Zwar haben auch sie, wie die anderen Beschwerdeführenden zu VII., nicht ausdrücklich ausgeführt, dass sie wahlberechtigt sind. Sie haben jedoch auf ihre Eigenschaft als Mitglieder des Deutschen Bundestages verwiesen. Damit sind sie offensichtlich wählbar im Sinne von § 15 BWahlG. An ihrer Wahlberechtigung gemäß § 12 Abs. 1 BWahlG bestehen daher keine vernünftigen Zweifel, so dass weitere Ausführungen entbehrlich sind. Aus dem Vortrag der weiteren 174 Beschwerdeführenden ergibt sich hingegen nichts Substantielles zu ihrer etwaigen Wahlberechtigung.
2. Im Übrigen sind die Verfassungsbeschwerden zulässig. Insbesondere sind sie nicht verfristet. Zwar wenden sie sich lediglich gegen die Sperrklausel, die bereits seit 1949 besteht. Deren Neuregelung in § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG hat die Beschwerdefrist des § 93 Abs. 3 BVerfGG für eine hiergegen gerichtete Verfassungsbeschwerde jedoch neu in Gang gesetzt. Ihr neues normatives Umfeld (vgl. BVerfGE 12, 10 <24>; 100, 313 <356>; 120, 274 <298>; 137, 108 <139 Rn. 70>) ruft in zweifacher Hinsicht neue Wirkungen hervor.
§ 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG, der Parteien vom Sitzverteilungsverfahren ausschließt, die bundesweit weniger als 5 Prozent der gültigen Zweitstimmen erreichen, betrifft nicht nur - wie bisher - die Zweitstimmen. Durch das Zweitstimmendeckungsverfahren entfaltet die Nichtberücksichtigung solcher Parteien auch Wirkungen für die Erststimmen, die für erfolgreiche Wahlkreisbewerber dieser Partei abgegeben werden. Während nach dem bisherigen Regelungsumfeld erfolgreiche Bewerber stets in den Bundestag einzogen, erhält in Zukunft ein erfolgreicher Bewerber kein Mandat, wenn seine Partei bei der Sitzverteilung unberücksichtigt bleibt.
Außerdem verändert sich die Wirkung der Sperrklausel dadurch, dass drei Wahlkreise mit den meisten Erststimmen für die Bewerber einer Partei nicht mehr zur Berücksichtigung dieser Partei führen. Nach dem bisherigen Wahlrecht spielte für solche Parteien die Sperrklausel keine Rolle, weil sie durch drei sogenannte Grundmandate so viele Sitze im Bundestag erhielten, wie dies ihrem Zweitstimmenergebnis entsprach.
III.
Zulässig sind auch die Organklagen des Antragstellers zu III., der die CDU entsprechend § 65 Abs. 1BVerfGG (vgl. BVerfGE 120, 82 <100>) wirksam beigetreten ist, sowie der Antragstellerin zu IV., die beide eine Verletzung ihrer Chancengleichheit aus Art. 21 Abs. 1 GG geltend machen (1.). Die Organklage der Antragstellerin zu V. ist hingegen unzulässig (2.).
1. Im Organstreitverfahren können politische Parteien gegen Gesetzesbeschlüsse des Bundestages, die das Bundeswahlgesetz ändern, vorgehen. Auf diesem Weg können sie die Verletzung ihres verfassungsrechtlichen Status aus Art. 21 Abs. 1 GG geltend machen (vgl. BVerfGE 4, 27 <30 f.>; 131, 316 <333 f.>; stRspr). Der Beschluss des Deutschen Bundestages vom 17. März 2023 über das Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes 2023 berührt die von Art. 21 Abs. 1 GG geschützte Chancengleichheit der Parteien unmittelbar. Es bestimmt die Regeln des "Wahlwettbewerbs" um die Sitze im Bundestag. An ihm nehmen Parteien in Erfüllung ihres verfassungsrechtlichen Auftrags, an der Willensbildung des Volkes mitzuwirken, teil. Insoweit können Parteien gegen Gesetzesbeschlüsse des Bundestages, die die rechtliche Gestaltung des Wahlverfahrens betreffen, Organklage erheben (vgl. BVerfGE 4, 27 <30 f.>; 4, 31 <35 f.>; 6, 84 <88>; 6, 99 <102 f.>; 13, 1 <9 f.>; 82, 322 <335>; 131, 316 <333 f.>; stRspr).
Andere Verfassungsverstöße, etwa im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens, können Parteien - entgegen dem Vorbringen des Antragstellers zu III. - nicht geltend machen. Das organklagefähige Recht des Art. 21 Abs. 1 GG verlangt nicht, dass das Verhalten des Bundestages in jeder Hinsicht, auch soweit es den verfassungsrechtlichen Status der politischen Parteien nicht berührt, mit dem Grundgesetz in Einklang steht (vgl. BVerfGE 73, 1 <29 f.>). Für eine allgemeine oder umfassende, von eigenen Rechten des Antragstellers losgelöste abstrakte Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit einer angegriffenen Maßnahme ist im Organstreitverfahren kein Raum (vgl. BVerfGE 118, 277 <318 f.>; 150, 194 <200 Rn. 18>; 151, 191 <198 Rn. 20> - Bundesverfassungsrichterwahl II; 165, 270 <282 f. Rn. 40> - PartGuaÄndG 2018 - Organstreit; stRspr). Insbesondere lässt sich die für Grundrechte geltende Rechtsprechung, dass jede staatliche Maßnahme, die in die allgemeine Handlungsfreiheit gemäß Art. 2 Abs. 1 GG eingreift, die Schranken der verfassungsmäßigen Ordnung wahren muss, also formell und materiell der Verfassung gemäß sein muss (vgl. hierzu BVerfGE 6, 32
2. Der Organklageantrag der Antragstellerin zu V. ist unzulässig. Dabei kann offenbleiben, welche Folgen die Auflösung der Fraktion DIE LINKE zum 6. Dezember 2023 für die zuvor eingereichte Organklage hat (vgl. hierzu BVerfGE 136, 190 <192 ff. Rn. 4 ff.> m.w.N.). Ebenso bedarf es keiner abschließenden Entscheidung, ob die Frist gemäß § 64 Abs. 3 BVerfGG erst mit der Verkündung des angegriffenen Gesetzes im Bundesgesetzblatt am 13. Juni 2023 oder zu einem früheren Zeitpunkt zu laufen begann. Denn der Antragstellerin zu V. fehlt die Antragsbefugnis, die verlangt, dass Rechte des Antragstellers, die aus einem verfassungsrechtlichen Rechtsverhältnis zwischen den Beteiligten erwachsen, durch die beanstandete rechtserhebliche Maßnahme oder Unterlassung des Antragsgegners verletzt oder unmittelbar gefährdet sein können (vgl. BVerfGE 94, 351 <362 f.>; 165, 270 <287 Rn. 53>). Eine Fraktion hat weder ein Recht, auch nach der nächsten Wahl im Bundestag vertreten zu sein (a), noch kann sie sich hier als Fraktion auf das in Art. 38 Abs. 1 GG wurzelnde Abgeordnetenrecht auf Beratung und Beschlussfassung im Bundestag berufen (b).
a) In einer demokratischen Verfassungsordnung, in der Wahlen über die Zusammensetzung des Parlaments bestimmen, existiert kein Recht einer Fraktion, auch nach der nächsten Wahl im Bundestag vertreten zu sein. Denn allein die Parteien, nicht dagegen die sich erst nach der Wahl bildenden und allein im innerparlamentarischen Raum wirkenden Fraktionen, haben eine verfassungsrechtliche Stellung im Wahlverfahren (vgl. BVerfGE 1, 208 <229>). Mit der Auflösung eines Bundestages durch den Zusammentritt des nächsten Bundestages enden auch seine Untergliederungen, soweit nicht durch Gesetz anderes bestimmt ist (so etwa für das Parlamentarische Kontrollgremium in § 3 Abs. 4 des Gesetzes über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeiten des Bundes). Soweit § 62 Abs. 7 in Verbindung mit Abs. 1 Nr. 3 des Abgeordnetengesetzes ( AbgG ) nicht die Liquidation einer Fraktion, sondern die Rechtsnachfolge ihrer Nachfolgefraktion vorsieht, bezweckt dies ihre faktische Kontinuität in vermögens- und insbesondere arbeitsrechtlicher Hinsicht (vgl. Waldhoff, in: Austermann/Schmahl, Abgeordnetenrecht, 2. Aufl. 2023, § 62 AbgG Rn. 18). Eine verfassungsrechtliche Rechtsstellung ist hiermit nicht verbunden.
b) Auch können die Fraktionen das in Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG wurzelnde Recht auf Beratung und Beschlussfassung im Bundestag (vgl. BVerfGE 165, 206 <238 ff. Rn. 92 ff.> - Parteienfinanzierung - Absolute Obergrenze; 166, 304 <329 f. Rn. 88 ff.> - Gebäudeenergiegesetzänderungsgesetz - eA) hier nicht als eigenes Recht geltend machen. Eine Prozessstandschaft der Fraktionen für ihre Mitglieder kommt generell nicht in Betracht.
Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG begründet ein Recht der Abgeordneten auf Beratung und Beschlussfassung im Bundestag. Der Bundestag verhandelt gemäß Art. 42 Abs. 1 Satz 1 GG öffentlich im Plenum aller Abgeordneten. Gemäß Art. 42 Abs. 2 Satz 1 GG fasst er Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Damit Abgeordnete ihr Recht gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG als Vertreter des ganzen Volkes ausüben können, müssen sie sich eine eigene Meinung über den Beratungsgegenstand auf der Grundlage ausreichender Informationen bilden und davon ausgehend an der Beratung und Beschlussfassung des Parlaments mitwirken können (vgl. BVerfGE 70, 324 <355>; 125, 104 <123>; 150, 345 <368 f. Rn. 58>; 165, 206 <238 f. Rn. 93>; 166, 304 <329 Rn. 88>). Um dieses Recht der Abgeordneten auf Beratung und Beschlussfassung geht es hier. Betroffen ist insoweit das Statusrecht der einzelnen Abgeordneten, das diesen selbst und nicht der Fraktion zusteht.
Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG gewährt den Fraktionen auch nicht die Möglichkeit einer Durchsetzung der Rechte ihrer Mitglieder im Wege der Prozessstandschaft. Diese können nur von den Abgeordneten selbst geltend gemacht werden. Eine Prozessstandschaft widerspräche auch dem freien Mandat, wenn die Ausübung des Abgeordnetenrechts nicht von der Gewissensentscheidung des einzelnen Abgeordneten abhinge, sondern von einem Mehrheitsbeschluss der Fraktion oder gar nur der Fraktionsführung (vgl. BVerfGE 135, 317 <397 Rn. 155> m.w.N.).
C.
Das Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes 2023 ist den Art. 38 Abs. 1 Satz 2, Art. 42 Abs. 1Satz 1 GG (I.1.) entsprechend zustande gekommen (I.2.). Die Regelungen des Verfahrens der Zweitstimmendeckung in § 1 Abs. 3, § 6 Abs. 1 und Abs. 4 Sätze 1 und 2 BWahlG sind mit Art. 38 Abs. 1Satz 1 und Abs. 3 sowie Art. 21 Abs. 1 GG (II.1.) vereinbar (II.2.). Die Sperrklausel des § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG ist mit diesen Maßstäben unvereinbar (II.3.).
Dies ergibt die Prüfung in den Normenkontrollverfahren zu I. und II., die ungeachtet der umfassend auf Art. 2 des Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes 2023 bezogenen Formulierung der Anträge der Sache nach lediglich die genannten Bestimmungen zum Gegenstand haben. Diese Prüfung erfolgt ohne Bindung an die erhobenen Rügen unter allen verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten (vgl. BVerfGE 97, 198 <214>; 101, 239 <257>; 112, 226 <254>; 165, 206 <238 Rn. 90>), auch unter Berücksichtigung des Vorbringens in anderen (Parallel-)Verfahren und unabhängig vom Erfolg der Verfassungsbeschwerden in den Verfahren zu VI. und VII. (dazu unter D.) und der Organstreitverfahren in den Verfahren zu III. und V. (dazu unter E.).
I.
In formeller Hinsicht sind die angegriffenen Normen verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.
1. Für das Gesetzgebungsverfahren bestimmen Art. 76 ff. GG Kompetenzen und Abläufe zwischen den Verfassungsorganen. Welche Bindungen sich aus den Grundsätzen der gleichberechtigten Teilhabe der Abgeordneten nach Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG und der Parlamentsöffentlichkeit nach Art. 42 Abs. 1 Satz 1 GG für die Ausgestaltung von Gesetzgebungsverfahren ergeben, hat das Bundesverfassungsgericht bisher nicht entschieden (vgl. BVerfGE 165, 206 <238 Rn. 92>; 166, 304 <329 Rn. 89>).
Das Parlament gestaltet seine internen Abläufe autonom. Art. 40 Abs. 1 Satz 2 GG weist dem Parlament die Kompetenz zu, sich selbst eine Geschäftsordnung zu geben. Seine Grenzen findet der weite Gestaltungsspielraum bei der Bestimmung der parlamentarischen Abläufe in der Verfassung (vgl. BVerfGE 1, 144 <151 f.>; 80, 188 <219 f.>; 130, 318 <348 f.>).
Die gleichberechtigte Teilhabe an der parlamentarischen Willensbildung umfasst das Recht der Abgeordneten, sich über den Beratungsgegenstand eine eigene Meinung bilden und davon ausgehend an der Beratung und Beschlussfassung des Parlaments mitwirken zu können. Grundlage hierfür ist eine hinreichende Information über den Beratungsgegenstand (vgl. BVerfGE 70, 324 <355>; für Vorschläge des Vermittlungsausschusses BVerfGE 125, 104 <123>; 150, 204 <231 f. Rn. 81>; 150, 345 <368 f. Rn. 58>; für das innerparlamentarische Gesetzgebungsverfahren BVerfGE 165, 206 <238 f. Rn. 93>; 166, 304 <329 Rn. 88>). Dabei müssen die Abgeordneten die Informationen nicht nur erlangen, sondern diese auch verarbeiten können (vgl. BVerfGE 165, 206 <238 f. Rn. 93>; 166, 304 <329 Rn. 88>).
Der Grundsatz der Parlamentsöffentlichkeit nach Art. 42 Abs. 1 Satz 1 GG sichert das öffentliche Verhandeln von Argument und Gegenargument, die öffentliche Debatte und öffentliche Diskussion als wesentliche Elemente des demokratischen Parlamentarismus. Das im parlamentarischen Verfahren gewährleistete Maß an Öffentlichkeit der Auseinandersetzung und Entscheidungssuche schafft Möglichkeiten eines Ausgleichs widerstreitender Interessen und ist Voraussetzung für eine Kontrolle des Parlaments und damit seiner effektiven Verantwortlichkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern (vgl. BVerfGE 40, 237 <249>; 40, 296 <327>; 70, 324 <355>; 125, 104 <123 f.>; 130, 318 <344>; 150, 204 <232 Rn. 82>; 150, 345 <369 Rn. 59>; 165, 206 <239 Rn. 94>).
Auch wenn dem Parlament ein weiter Gestaltungsspielraum bei der Bestimmung der Verfahrensabläufe im Parlament zusteht, spricht einiges dafür, dass dieser in einer die formelle Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes tangierenden Weise überschritten wird, wenn das Abgeordnetenrecht gemäß Art. 38 Abs. 1Satz 2 GG und der Grundsatz der Öffentlichkeit der parlamentarischen Beratung gemäß Art. 42 Abs. 1Satz 1 GG ohne sachlichen Grund gänzlich oder in substantiellem Umfang missachtet werden (vgl. BVerfGE 165, 206 <240 Rn. 96>; 166, 304 <330 Rn. 91>).
2. Das Zustandekommen des Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes 2023 ist danach nicht zu beanstanden. Das Gesetzgebungsverfahren weist keine Umstände auf, die dafür sprechen, dass der Deutsche Bundestag trotz Einhaltung der Geschäftsordnung seinen Gestaltungsspielraum bei der Bestimmung der Verfahrensabläufe im Parlament gemäß Art. 40 Abs. 1 Satz 2 GG überschritten haben könnte.
Zwar ist die Wahlrechtsreform nicht im Konsens beschlossen worden, sondern lediglich mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen. Dies ist jedoch für den Ablauf eines Gesetzgebungsverfahrens nicht relevant. Auch wenn eine konsensuale Wahlrechtsreform wünschenswert sein mag, eröffnet Art. 38 Abs. 3 GG dem einfachen Gesetzgeber ausdrücklich die Möglichkeit der Mehrheitsentscheidung (Art. 42 Abs. 2 Satz 1 GG). Ebenso ist es nicht ungewöhnlich, dass einem konkreten Gesetzgebungsverfahren die Erarbeitung und Diskussion von möglichen Alternativen durch eine Reformkommission vorausgehen. Die erste Lesung und die Durchführung einer Sachverständigenanhörung im federführenden Ausschuss für Inneres und Heimat (vgl. Wortprotokoll der 29. Sitzung des Ausschusses für Inneres und Heimat vom 6. Februar 2023, Protokoll-Nr. 20/29, sowie BTDrucks 20/6015) entspricht dem üblichen parlamentarischen Verfahren. Gleiches gilt für die zweite Lesung. In der Aussprache hielten Abgeordnete der Opposition zwar eine weitere Beratung für sachgerecht. Eine Debatte zur Geschäftsordnung mit dem Ziel einer Vertagung der Beschlussfassung wurde aber nicht beantragt (BTPlenProt 20/92
Auch der Umstand, dass die zweite Alternative des § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 des Entwurfs des Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes 2023 - die "angepasste Grundmandatsklausel" beziehungsweise Wahlkreisklausel - im Zuge der abschließenden Ausschussberatungen am 15. März 2023 gestrichen wurde, führt zu keinem anderen Ergebnis. Die bloße Streichung einzelner Regelungen oder Passagen aus einem Gesetzentwurf im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens stellt allein noch keinen besonderen Umstand dar, der die Annahme der Missachtung von Abgeordnetenrecht oder Öffentlichkeitsgrundsatz begründen könnte. Denn die parlamentarische Beratung dient gerade der Möglichkeit, einen Entwurf zu verändern, insbesondere auch dazu, einzelne Teile des Entwurfs nicht Gesetz werden zu lassen. Ohnehin standen den Abgeordneten im vorliegend zu beurteilenden Gesetzgebungsverfahren offensichtlich genügend Informationen über die Bedeutung der Wahlkreisklausel und ihres Fehlens zur Verfügung: Der Gesetzentwurf vom 24. Januar 2023 sah eine umfassende Neugestaltung der §§ 1 und 4 bis 6 BWahlG vor. Dies bot die hinreichende Information darüber, dass das Wahlverfahren mit dem Sitzzuteilungsverfahren grundlegend neu geregelt werden sollte. Eine weitere Informationsquelle für die Abgeordneten war der Zwischenbericht der Reformkommission vom 1. September 2022 (BTDrucks 20/3250). Er enthielt Erörterungen zur Grundmandatsklausel und empfahl sogar ausdrücklich, über ihren Fortbestand oder ihre Modifikation politisch zu entscheiden (vgl. BTDrucks 20/3250, S. 21 f.). Hinzu kommt die auch mit Blick auf die "angepasste Grundmandatsklausel" kontroverse Sachverständigenanhörung des Ausschusses am 6. Februar 2023. Die erhebliche Tragweite ihrer Streichung, auf die die Antragstellenden verweisen, ändert daran nichts. Soweit sie geltend machen, sie seien von der Streichung überrascht worden, beschreiben sie letztlich allein die Enttäuschung ihrer Erwartungen an das Beratungsergebnis. Das Vertrauen dahingehend, ein laufendes Gesetzgebungsverfahren werde zu einem bestimmten Ergebnis führen, wird aber von Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG nicht geschützt.
II.
Die Normenkontrollanträge haben teilweise Erfolg. Zwar ist das Zweitstimmendeckungsverfahren (§ 1 Abs. 3, § 6 Abs. 1 und Abs. 4 Sätze 1 und 2 BWahlG) nach dem entscheidungserheblichen verfassungsrechtlichen Maßstab (1.) nicht zu beanstanden (2.). Die Sperrklausel in der Ausprägung durch die angegriffenen Normen verletzt jedoch den Grundsatz der Wahlgleichheit (3.).
1. Für das Wahlrecht weist Art. 38 Abs. 3 GG dem Gesetzgeber die Aufgabe der näheren Ausgestaltung zu (a). Ihre Grenzen findet die gesetzgeberische Gestaltungsbefugnis in den Wahlgrundsätzen nach Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG (b). Zudem muss der Wahlgesetzgeber die Chancengleichheit der Parteien aus Art. 21 Abs. 1 GG wahren (c). Wahlgleichheit und Chancengleichheit unterliegen jedoch keinem absoluten Differenzierungsverbot (d).
a) Die Wahl ist im demokratischen Verfassungsstaat des Grundgesetzes der zentrale Vorgang, in dem das Volk die Staatsgewalt selbst ausübt (Art. 20 Abs. 2 GG ) und die Legitimation für die weitere Ausübung durch die gewählten Organe in seinem Namen schafft. Das Recht der Bürgerinnen und Bürger, in Freiheit und Gleichheit durch Wahlen und Abstimmungen die öffentliche Gewalt personell und sachlich zu bestimmen, ist elementarer Bestandteil des Demokratieprinzips. Der Grundsatz der Gleichheit der Wahl trägt der vom Demokratieprinzip vorausgesetzten Gleichberechtigung der Staatsbürgerinnen und -bürger Rechnung (vgl. BVerfGE 95, 335 <368>; 131, 316 <334>).
In welcher Weise der in Wahlen gebündelte politische Wille der Wählerinnen und Wähler durch Zuteilung von Sitzen an Mandatsträger im Deutschen Bundestag umgesetzt wird, bedarf der Festlegung und näheren Ausgestaltung durch den Gesetzgeber. Er ist in seiner Entscheidung für ein Wahlsystem und dessen Modifikationen grundsätzlich frei (vgl. BVerfGE 1, 208 <246>; 6, 84 <90>; 95, 335 <349>; 121, 266 <296>; 131, 316 <334 f.>). Art. 38 Abs. 1 und 2 GG geben insoweit lediglich Grundzüge vor. Nach Art. 38Abs. 3 GG bestimmt das Nähere ein Bundesgesetz.
aa) Aus dem Zusammenhang dieser Absätze, aber auch aus der Entstehungsgeschichte dieser Norm wird deutlich, dass der Verfassungsgeber die Festlegung und konkrete Ausgestaltung des Wahlsystems und damit ein Stück materiellen Verfassungsrechts bewusst offen gelassen hat (vgl. BVerfGE 95, 335<350 ff.>; 121, 266 <296>; 131, 316 <335>).
Dies gilt zunächst für die frühe Phase der Bundesrepublik Deutschland. Im Parlamentarischen Rat, der keine verfassungsrechtlichen Festlegungen des Wahlsystems, sondern lediglich ein Wahlgesetz entwerfen sollte (vgl. Wortprotokoll der ersten, konstituierenden Sitzung des Ausschusses für Wahlrechtsfragen am 15. September 1948, abgedruckt in: Deutscher Bundestag/Bundesarchiv, Der Parlamentarische Rat 1948 - 1949, Akten und Protokolle, Bd. 6, Ausschuss für Wahlrechtsfragen, bearbeitet von Rosenbach, S. 1 <1 Fn. 5>; vgl. auch bereits Wortprotokoll der Plenarsitzungen des Verfassungskonvents auf Herrenchiemsee am 10. August 1948, abgedruckt in: Deutscher Bundestag/Bundesarchiv, Der Parlamentarische Rat 1948 - 1949, Akten und Protokolle, Bd. 2, Der Verfassungskonvent von Herrenchiemsee, bearbeitet von Bucher, S. 53 <126 f.>; vgl. ferner Wortprotokoll der siebenten Sitzung des Plenums am 21. Oktober 1948, abgedruckt in: Deutscher Bundestag/Bundesarchiv, Der Parlamentarische Rat 1948 - 1949, Akten und Protokolle, Bd. 9, Plenum, bearbeitet von Werner, S. 217 <278 f.>), waren die Beratungen im Ausschuss für Wahlrechtsfragen zunächst von Grundsatzdiskussionen über das Wahlsystem geprägt. Dabei standen sich trotz aller Vermittlungs- und Kompromissbestrebungen die Befürworter eines Mehrheitswahlsystems und eines Verhältniswahlsystems gegenüber. Der Vorschlag beschränkte sich daher lediglich auf die Wahl des ersten Deutschen Bundestages und überließ bewusst diesem die endgültige Entscheidung über das Wahlrecht (vgl. Wortprotokoll der siebenten Sitzung des Plenums am 21. Oktober 1948, abgedruckt in: Deutscher Bundestag/Bundesarchiv, Der Parlamentarische Rat 1948 - 1949, Akten und Protokolle, Bd. 9, Plenum, bearbeitet von Werner, S. 217 <279>).
Auch nach der Wiedervereinigung wurde auf eine weitergehende Verankerung des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag in der Verfassung verzichtet. In der Gemeinsamen Verfassungskommission, die von 1992 bis 1993 tagte, wurden zwar verschiedene Fragen zur Ausgestaltung des Wahlrechts diskutiert. Sie hatten jedoch, soweit hier von Belang, nicht die Änderung des Grundgesetzes zum Ziel (vgl. Bericht der Gemeinsamen Verfassungskommission vom 5. November 1993, BTDrucks 12/6000, S. 98).
bb) Die von Art. 38 Abs. 3 GG gewollte Entwicklungsoffenheit des Wahlrechts verdichtet sich nur unter engen Voraussetzungen zu einer Handlungspflicht des Gesetzgebers. Das Bundesverfassungsgericht hat eine solche in seinen Entscheidungen vom 3. Juli 2008 (BVerfGE 121, 266 <314 ff.>) sowie vom 25. Juli 2012 (BVerfGE 131, 316 <370 ff.>) festgestellt und den Gesetzgeber zu Änderungen des Bundeswahlrechts verpflichtet.
Die Wurzel einer solchen Verpflichtung liegt darin, dass der Gesetzgeber die Funktion der Wahl als Vorgang der Integration politischer Kräfte des gesamten Volkes sicherstellen und zu verhindern suchen muss, dass gewichtige Anliegen der Gesellschaft von der Volksvertretung ausgeschlossen bleiben (vgl. BVerfGE 6, 84 <92 f.>; 95, 408 <419>; 131, 316 <335>; 146, 327 <355 Rn. 71>). Die Wahl muss den Abgeordneten demokratische Legitimation verschaffen. Hierfür hat der Gesetzgeber zum einen in Rechnung zu stellen, wie sich die Ausgestaltung des Wahlsystems auf die Verbindung zwischen Wählerinnen und Wählern und Abgeordneten auswirkt und wie sie den durch die Wahl vermittelten Prozess der Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen beeinflusst. Zum anderen muss die zu wählende Volksvertretung - insbesondere für die Aufgaben der Gesetzgebung und Regierungsbildung - funktionsfähig sein. Der Gestaltungsspielraum, den Art. 38 Abs. 3 GG dem Gesetzgeber für die Erfüllung dieser teils gegenläufigen Ziele einräumt, verpflichtet ihn nicht auf ein bestimmtes Konzept der repräsentativen Demokratie. Er ist bei der Entscheidung für ein Wahlsystem und seine Ausgestaltung frei (vgl. BVerfGE 131, 316 <335 f.> m.w.N.).
Die eine Handlungspflicht begründende Grenze der gesetzgeberischen Gestaltungsmacht findet sich dort, wo das allen Bürgerinnen und Bürgern zustehende Recht auf freie und gleiche Teilhabe an der demokratischen Selbstbestimmung beeinträchtigt wird (vgl. BVerfGE 131, 316 <336>). Insbesondere kann das Wahlrecht durch neue Entwicklungen und eine veränderte politische Wirklichkeit infrage gestellt werden (vgl. BVerfGE 146, 327 <353 Rn. 65>). Droht die Wahl ihre Funktion zu verfehlen, die politischen Kräfte zu integrieren, darf der Wahlgesetzgeber nicht untätig bleiben. Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG bestimmt unter den jeweils aktuellen Bedingungen, welche Anforderungen das Wahlrecht zu erfüllen hat.
b) Gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG werden die Abgeordneten des Deutschen Bundestages in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Zudem gebietet Art. 38 Abs. 1 GGin Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 , 2 GG , dass alle wesentlichen Schritte der Wahl öffentlicher Überprüfbarkeit unterliegen, soweit nicht andere verfassungsrechtliche Belange eine Ausnahme rechtfertigen (BVerfGE 123, 39 ).
aa) Der Grundsatz der Gleichheit der Wahl sichert dabei die vom Demokratieprinzip vorausgesetzte Egalität der Bürgerinnen und Bürger (vgl. BVerfGE 99, 1 <13>; 121, 266 <295>; 146, 327 <349 Rn. 59>; stRspr). Als eine der wesentlichen Grundlagen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes (vgl. BVerfGE 6, 84 <91>; 11, 351 <360>; 121, 266 <295>; 146, 327 <349 Rn. 59>; stRspr) gebietet er, dass alle Wahlberechtigten das aktive und passive Wahlrecht möglichst in formal gleicher Weise ausüben können. Wegen seines Zusammenhangs mit dem Demokratieprinzip ist er im Sinne einer strengen und formalen Gleichheit zu verstehen (vgl. BVerfGE 82, 322 <337>; 95, 335 <368>; 121, 266 <295>; 146, 327 <349 Rn. 59>; BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 29. November 2023 - 2 BvF 1/21 -, Rn. 159 - Normenkontrolle Bundeswahlgesetz 2020; stRspr).
(1) Aus dem Grundsatz der Wahlgleichheit folgt, dass die Stimme eines jeden Wahlberechtigten grundsätzlich den gleichen Zählwert und die gleiche rechtliche Erfolgschance haben muss. Alle Wählerinnen und Wähler müssen mit der Stimme, die sie abgeben, den gleichen Einfluss auf das Wahlergebnis nehmen können (vgl. BVerfGE 95, 335 <353, 369 f.>; 121, 266 <295>; 124, 1 <18>; 129, 300 <317 f.>; 131, 316 <337>; 146, 327 <350 f. Rn. 59>; BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 29. November 2023 - 2 BvF 1/21 -, Rn. 160; stRspr). Das Gebot der Erfolgschancengleichheit wirkt sich je nach Ausgestaltung des Sitzzuteilungsverfahrens unterschiedlich aus (vgl. BVerfGE 131, 316 <337 f.>).
(a) Das Bundesverfassungsgericht hat die Erfolgschancengleichheit für die Verhältniswahl konkretisiert und spricht vom Gebot der Erfolgswertgleichheit (vgl. BVerfGE 16, 130 <139>; 95, 335 <353, 371 f.>; 131, 316 <338>; 146, 327 <350 Rn. 59>; stRspr). Ziel des Verhältniswahlsystems ist es, dass alle Parteien in einem möglichst den Stimmenzahlen angenäherten Verhältnis in dem zu wählenden Organ vertreten sind. Zur Zählwert- und Erfolgschancengleichheit tritt damit im Verhältniswahlrecht die Erfolgswertgleichheit hinzu (vgl. BVerfGE 120, 82 <103>; 129, 300 <318>; 135, 259 <284 Rn. 45>; 146, 327 <350 f. Rn. 59>; BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 29. November 2023 - 2 BvF 1/21 -, Rn. 160; stRspr).
Bei der Verhältniswahl entspricht der Erfolgswert einer Wahlstimme dem Quotientenwert aus der Division der Sitzzahl einer Partei durch die Zweitstimmen für diese Partei. Abweichungen dieses Wertes sind unbeachtlich, wenn sie als Rundungswerte unausweichliche Folge des Berechnungsverfahrens sind (vgl. BVerfGE 79, 169 <171>; 95, 335 <372>; 121, 266 <299 f.>; BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 29. November 2023 - 2 BvF 1/21 -, Rn. 161).
(b) Vergleichbar ermittelbare Erfolgswertunterschiede können sich auch durch unterschiedlich große Wahlkreise ergeben. Dies gilt nicht nur für die Verhältniswahl, wenn sie in getrennten Wahlkreisen erfolgt, wie es beispielsweise bei der ersten und zweiten Bundestagswahl durch feste Sitzkontingente für die Länder der Fall war (vgl. § 8 Abs. 1 WahlG 1949 bzw. § 6 Abs. 2 BWahlG 1953) oder wie es im Rahmen des Wahlrechts zum Europäischen Parlament vorgesehen ist (vgl. Art. 14 Abs. 2 Sätze 3 und 4 EUV; vgl. BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 6. Februar 2024 - 2 BvE 6/23 u.a. -, Rn. 110 - Direktwahlakt 2018 - Zwei-Prozent-Sperrklausel). Auch bei der Mehrheitswahl in Wahlkreisen bedeutet ein Erfolgswertunterschied durch unterschiedliche Wahlkreisgrößen einen Gleichheitsverstoß (vgl. BVerfGE 16, 130 <136, 139>; 130, 212 <229 ff.>), ungeachtet seiner Behandlung als Frage der Erfolgschancen (vgl. BVerfGE 130, 212 <226>; zur Begrifflichkeit vgl. BVerfGE 131, 316 <337 f.>). Die Gleichheitsanforderung bezieht sich hier dem Mehrheitswahlrecht entsprechend nur auf die für den Mehrheitskandidaten abgegebenen Stimmen (vgl. BVerfGE 95, 335 <353>; 121, 266 <295 f.>).
(2) Durch die Gestaltung des Bundestagswahlrechts als Zweistimmenwahlrecht sind weitere Erfolgswertunterschiede möglich.
(a) Ein Unterschied im Erfolgswert entsteht zunächst durch Überhangmandate. Hierfür lassen sich zwei Begründungsansätze heranziehen. Zum einen muss ausgehend von den Anforderungen der Verhältniswahl jede gültige Stimme mit gleichem Gewicht bewertet werden, ihr mithin ein anteilsmäßig gleicher Erfolg zukommen (vgl. BVerfGE 1, 208 <246>; 131, 316 <337 f.>; BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 29. November 2023 - 2 BvF 1/21 -, Rn. 160). Überhangmandate sind danach gleichheitswidrig, weil der Zweitstimmenanteil einer Partei gleichbleibt, sich aber ihre Sitzzahl durch ein Überhangmandat erhöht. Dadurch steigt der Erfolgswert der Wahlstimmen für diese Partei. Das Stimmgewicht von Wählerinnen und Wählern einer Partei mit Überhangmandaten und solchen einer Partei ohne Überhangmandate wird so differenziert (vgl. BVerfGE 7, 63 <74>; 16, 130 <139 f.>; 79, 169 <171 f.>; 95, 335 <389>; unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit der Parteien BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 29. November 2023 - 2 BvF 1/21 -, Rn. 171).
Zum anderen lässt sich die Erfolgswertungleichheit durch Überhangmandate auch damit erfassen, dass Wählerinnen und Wähler, die ihre Stimme einem erfolgreichen Wahlkreisbewerber gegeben haben, dessen Partei in dem betreffenden Land einen Überhang erzielt, anders als die übrigen Wählerinnen und Wähler nicht lediglich mit ihrer Zweitstimme Einfluss auf die parteipolitische Zusammensetzung des Bundestages nehmen können, sondern - im Falle des sogenannten Stimmensplittings - mit beiden Stimmen. Dieses "doppelte Stimmgewicht" ist zu vermeiden (vgl. BVerfGE 79, 161 <168 f.>; Ipsen, DVBl 2003, S. 1013 <1015 ff.>; Scholz/Hofmann, ZRP 2003, S. 39 <43>; Schreiber, NVwZ 2003, S. 402 <403 ff.>; Lenski, AöR 134 <2009>, S. 473 <488 ff.>; Grzeszick, in: Stern/Becker, Grundrechte-Kommentar, 2010, Art. 38 Rn. 106, 109) beziehungsweise vor dem Grundsatz der Wahlgleichheit rechtfertigungsbedürftig (vgl. BVerfGE 7, 63 <74 f.>; 131, 316 <362 f.>; BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 29. November 2023 - 2 BvF 1/21 -, Rn. 170).
(b) Ein solches doppeltes Stimmgewicht kann auch in weiteren Fällen entstehen. Denn die Anrechnung eines Wahlkreismandats auf das Sitzkontingent einer Landesliste scheidet nicht nur bei Überhangmandaten aus. Hat eine Partei weniger als 5 Prozent der gültigen Zweitstimmen erreicht und wird deshalb bei der Sitzverteilung nicht berücksichtigt, so fehlt ein Sitzkontingent, auf das das Wahlkreismandat eines erfolgreichen Bewerbers dieser Partei angerechnet werden könnte. Das Mandat eines unabhängigen Bewerbers kann von vornherein nicht im Rahmen des Sitzkontingents einer Partei berücksichtigt werden. Die Regelung, wonach die Zweitstimme der Wählerinnen und Wähler eines erfolgreichen unabhängigen Bewerbers unberücksichtigt bleibt (zunächst § 9 Abs. 1 Satz 2 WahlG 1953, seitdem § 6 Abs. 1 Satz 2 BWahlG), vermeidet ein doppeltes Stimmgewicht und ist deshalb nicht zu beanstanden (vgl. BVerfGE 5, 77 <82 f.>; 7, 63 <73 ff.>; 79, 161 <167 f.>).
(c) Darüber hinaus haben Erststimmen auch dann Einfluss auf die Zusammensetzung des Bundestages, wenn eine Partei mit weniger als 5 Prozent der gültigen Zweitstimmen an der Sitzzuteilung beteiligt wird, aber zu ihren Gunsten die Grundmandatsklausel zum Zuge kommt. In diesem Fall wirken sich die Erststimmen auf die Zusammensetzung des Bundestages aus, da ohne die Wahlkreismandate die Partei nicht berücksichtigt würde. Die Grundmandatsklausel begründet jedoch kein doppeltes Stimmgewicht, weil die Wahlkreismandate auf das Sitzkontingent der Partei angerechnet werden können. Die Wahlgleichheit ist in diesem Fall jedoch wegen der unterschiedlichen Gewichtung der Zweitstimmen für eine solche Partei im Vergleich zu den Zweitstimmen für eine unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde liegende Partei ohne drei Wahlkreismandate beeinträchtigt (vgl. BVerfGE 6, 84 <95>; 95, 408 <420 f.>).
(d) Schließlich kann das Zweistimmenwahlrecht unter bestimmten Umständen sogar zu einer Umkehrung des Stimmgewichts führen (negatives Stimmgewicht). Sie stellt eine schwere Beeinträchtigung der Wahlgleichheit dar. Denn in keinem Fall darf ein Wahlsystem darauf ausgelegt sein oder jedenfalls in typischen Konstellationen zulassen, dass ein Zuwachs an Stimmen zu Mandatsverlusten führt oder dass für den Wahlvorschlag einer Partei insgesamt mehr Mandate erzielt werden, wenn auf ihn weniger oder auf einen konkurrierenden Vorschlag mehr Stimmen entfallen. Dies führt zu willkürlichen Ergebnissen und lässt den demokratischen Wettbewerb um Zustimmung bei den Wahlberechtigten widersinnig erscheinen (vgl. BVerfGE 121, 266 <300>; 131, 316 <347>; BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 29. November 2023 - 2 BvF 1/21 -, Rn. 205).
bb) Der Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl fordert, dass die Wählerinnen und Wähler die Abgeordneten selbst auswählen. Er schließt jedes Wahlverfahren aus, bei dem zu den Wählerinnen und Wählern eine weitere Instanz hinzutritt, die nach ihrem eigenen Ermessen die Abgeordneten endgültig auswählt und damit deren direkte Wahl ausschließt (vgl. BVerfGE 7, 63 <68>; 7, 77 <84 f.>; 47, 253 <279 f.>; BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 29. November 2023 - 2 BvF 1/21 -, Rn. 162). Der Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl setzt demgemäß ein Wahlverfahren voraus, in dem die Wählerinnen und Wähler vor dem Wahlakt erkennen können, welche Personen sich um ein Abgeordnetenmandat bewerben und wie sich die eigene Stimmabgabe auf Erfolg oder Misserfolg der Wahlbewerber auswirkt (vgl. BVerfGE 47, 253 <279 ff.>; 95, 335 <350>; 121, 266 <307>; BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 29. November 2023 - 2 BvF 1/21 -, Rn. 162). Für den Grundsatz der Unmittelbarkeit ist nicht entscheidend, dass die Stimme tatsächlich die von den Wählerinnen und Wählern beabsichtigte Wirkung entfaltet. Ausreichend ist die Möglichkeit einer der Intention der jeweiligen Wählerinnen und Wähler entsprechenden positiven Beeinflussung des Wahlergebnisses (vgl. BVerfGE 121, 266 <307>; BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 29. November 2023 - 2 BvF 1/21 -, Rn. 162).
c) Um die verfassungsrechtlich gebotene Offenheit des Prozesses der politischen Willensbildung zu gewährleisten, ist es unerlässlich, dass die Parteien, soweit irgend möglich, gleichberechtigt am politischen Wettbewerb teilnehmen. Von dieser Einsicht her empfängt der aus Art. 21 Abs. 1 GGabzuleitende Verfassungsgrundsatz der gleichen Wettbewerbschancen der politischen Parteien das ihm eigene Gepräge (vgl. BVerfGE 148, 11 <24 Rn. 42>). Er beinhaltet, dass jeder Partei grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten im gesamten Wahlverfahren und damit gleiche Chancen bei der Verteilung der Sitze eingeräumt werden müssen. Das Recht der politischen Parteien auf Chancengleichheit hängt eng mit den Grundsätzen der Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl zusammen. Deshalb muss in diesem Bereich - ebenso wie bei der durch die Grundsätze der Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl verbürgten gleichen Behandlung der Wählerinnen und Wähler - Gleichheit in einem strikten und formalen Sinn verstanden werden. Wenn die öffentliche Gewalt in den Parteienwettbewerb in einer Weise eingreift, die auf die Chancen der Parteien im politischen Wettbewerb zurückwirkt, sind ihrem Ermessen besonders enge Grenzen gesetzt (vgl. BVerfGE 120, 82 <104 f.>; 129, 300 <319>; 135, 259 <285 Rn. 48>; 146, 327 <350 Rn. 60>; BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 29. November 2023 - 2 BvF 1/21 -, Rn. 163).
d) Der Grundsatz der Wahlgleichheit unterliegt ebenso wie der Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien keinem absoluten Differenzierungsverbot.
aa) Aus ihrem formalen Charakter folgt jedoch, dass dem Gesetzgeber bei der Ordnung des Wahlrechts nur ein eng bemessener Spielraum für Differenzierungen verbleibt und an die Prüfung, ob eine solche gerechtfertigt ist, ein strenger Maßstab anzulegen ist. Er darf Differenzierungen nur vornehmen, wenn sie durch einen besonderen, sachlich legitimierten Grund gerechtfertigt sind. Dieser Grund muss der Wahlgleichheit die Waage halten können (vgl. BVerfGE 120, 82 <106 f.>; 121, 266 <297>; 129, 300 <320>; 130, 212 <227 f.>; 135, 259 <286 Rn. 51>; 146, 327 <350 f. Rn. 61>; BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 29. November 2023 - 2 BvF 1/21 -, Rn. 164).
Solche Differenzierungsgründe sind insbesondere die mit der Wahl verfolgten Ziele. Dazu gehört die Sicherung des Charakters der Wahl als eines Integrationsvorgangs bei der politischen Willensbildung des Volkes, der staatlichem Handeln demokratische Legitimation vermittelt und, damit zusammenhängend, die Sicherung der Arbeits- und Funktionsfähigkeit der zu wählenden Vertretungskörperschaft (vgl. BVerfGE 1, 208 <247 f.>; 6, 84 <92>; 95, 408 <418>; 146, 327 <351 Rn. 62>; BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 29. November 2023 - 2 BvF 1/21-, Rn. 165, 184; jeweils m.w.N.).
Was hierfür geeignet und erforderlich ist, bemisst sich nach den konkreten Funktionen des zu wählenden Organs sowie nach den konkreten Bedingungen, unter denen das Parlament arbeitet und von denen die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Funktionsstörungen abhängt (BVerfGE 146, 327 <351 Rn. 62> m.w.N.).
Dabei ist es Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, die gleichheitsrechtlichen Anforderungen so zu konkretisieren, dass der Gesetzgeber das Wahlrecht auf verlässlicher verfassungsrechtlicher Grundlage gestalten kann und infolgedessen das Risiko einer Bundestagsauflösung im Wahlprüfungsverfahren wegen unzureichender Normierung minimiert wird (vgl. BVerfGE 131, 316 <370>).
bb) Regelt der Gesetzgeber besondere Zugangshürden für die Berücksichtigung bei der Sitzzuteilung nach der Verhältniswahl (Sperrklauseln), stellen auch sie eine rechtfertigungsbedürftige Differenzierung dar.
Auch insoweit gelten die streng formalen Vorgaben der Wahlgleichheit. Die Verfassung enthält keine inhaltlichen Kriterien, die der Gesetzgeber für Differenzierungen heranziehen müsste. Welches Wahlergebnis die Bedeutsamkeit einer Partei in dem Sinne ausmacht, dass sie im Parlament vertreten sein soll, legt allein der Gesetzgeber fest (vgl. BVerfGE 4, 31 <40>; 51, 222 <237 f.>; 95, 408 <420>). Das Bundesverfassungsgericht prüft strikt (vgl. BVerfGE 146, 327 <352 Rn. 63> m.w.N.), ob das Kriterium, das der Gesetzgeber gewählt hat, um Parteien als bedeutsam anzusehen, auf legitimen Gründen beruht (vgl. BVerfGE 6, 84 <94>; 95, 408 <420>). Dabei prüft es jedoch lediglich, ob die verfassungsrechtlichen Grenzen eingehalten sind, nicht aber, ob der Gesetzgeber zweckmäßige oder rechtspolitisch erwünschte Lösungen gefunden hat (vgl. BVerfGE 146, 327 <352 Rn. 63> m.w.N.).
Das Bundesverfassungsgericht kontrolliert ebenso, ob eine Zugangshürde als differenzierende Regelung zur Verfolgung ihrer Zwecke geeignet und erforderlich ist. Die verfassungsrechtliche Beurteilung richtet sich auch nach der Intensität des Eingriffs in das - gleiche - Wahlrecht (vgl. BVerfGE 146, 327 <352 Rn. 64> m.w.N.). Die Vereinbarkeit von Sperrklauseln mit dem Grundsatz der Wahlgleichheit und der Chancengleichheit der politischen Parteien lässt sich daher nicht ein für alle Mal abstrakt beurteilen, sondern richtet sich nach den rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen (vgl. BVerfGE 146, 327<353 Rn. 65> m.w.N.).
cc) Gleiches gilt für Modifikationen einer Sperrklausel, weil sie stets weitere Differenzierungen zwischen Parteien bewirken. Durch solche Modifikationen, etwa in Form einer Grundmandatsklausel, werden zwei Gruppen von Parteien mit den auf sie entfallenden Wahlstimmen, die beide den Anforderungen der Sperrklausel nicht genügen, ungleich behandelt, indem eine Gruppe gleichwohl bei der Sitzverteilung berücksichtigt wird. Diese Differenzierung bedarf daher der Rechtfertigung (vgl. BVerfGE 6, 84 <95 f.>; 95, 408 <419 f.>). Dabei lassen sich ebenso wie Sperrklauseln selbst auch Ausnahmen von ihnen nicht ein für alle Mal abstrakt beurteilen. Vielmehr sind auch hier die jeweiligen konkreten tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse zu berücksichtigen (vgl. BVerfGE 82, 322 <338> m.w.N.).
2. Nach diesen Maßstäben ist das Zweitstimmendeckungsverfahren nach § 1 Abs. 3, § 6 Abs. 1 und Abs. 4 Sätze 1 und 2 BWahlG mit dem Grundgesetz vereinbar. Der Gesetzgeber nimmt damit seinen Gestaltungsauftrag für das Wahlrecht aus Art. 38 Abs. 3 GG wahr (a). Dabei ist weder die Gleichheit (b) noch die Unmittelbarkeit (c) der Wahl nach Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG verletzt. Auch die Chancengleichheit der Parteien aus Art. 21 Abs. 1 GG ist gewahrt (d).
a) Der Gesetzgeber kann bei der Erfüllung des Verfassungsauftrags des Art. 38 Abs. 3 GG Neuerungen einführen, die dem bisherigen Wahlrecht fremd waren und Wählerinnen und Wählern ebenso wie Bewerbern und Parteien ein Umdenken abverlangen. Sein Entschluss, das Wahlrecht zu reformieren, ist nicht an besondere Voraussetzungen gebunden. Unabhängig vom Fehlen derartiger verfassungsrechtlicher Anforderungen liegt - anders als in den Normenkontrollverfahren geltend gemacht - weder ein Systembruch vor (aa) noch leidet die Neuregelung an einer Widersprüchlichkeit oder an mangelnder Folgerichtigkeit (bb). Widersinnige Effekte sind ebenfalls nicht zu erwarten (cc). Das Vorbringen, die zunehmende Größe des Bundestages begründe keinen hinreichenden Reformbedarf, vermag die gegenteilige Einschätzung des Gesetzgebers nicht infrage zu stellen (dd). Auch geltend gemachte Beeinträchtigungen des Bundesstaatsprinzips (ee) und des Demokratieprinzips (ff) liegen nicht vor.
aa) Das Zweitstimmendeckungsverfahren stellt keine - offene oder verschleierte - Abkehr von den Grundzügen des bisherigen Wahlrechts dar (1). Es schafft indes eine Neukonzeption des Ausgleichs zwischen Erst- und Zweitstimmenergebnis (2). Deshalb geht die Kritik, die auf der bisherigen Konzeption dieses Ausgleichs aufbaut, am Gehalt der Neuregelung vorbei (3). Außerdem treffen einige in den Normenkontrollverfahren vorgebrachte Annahmen bereits auf das bisherige Wahlrecht nicht zu (4).
(1) Das Bundeswahlgesetz 2023 bleibt in der Kontinuität des bisherigen Wahlrechts. Das Wahlgebiet - das Bundesgebiet - ist nach wie vor in 299 Wahlkreise aufgeteilt. Parteien schlagen weiterhin zum einen Bewerber für diese Wahlkreise und zum anderen Listen für jedes Land vor. Auch die Unterscheidung zwischen Erst- und Zweitstimmen bleibt erhalten. Unverändert bestimmt sich die Zusammensetzung des Bundestages nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Denn jede beim Sitzverteilungsverfahren berücksichtigte Partei erhält so viele Sitze, dass ihr Anteil an der Gesamtsitzzahl des Bundestages ihrem Stimmenanteil am bundesweiten Wahlergebnis entspricht.
Dies macht einen Ausgleich zwischen den Wahlkreisergebnissen und den Listenwahlergebnissen unausweichlich (vgl. oben Rn. 11 ff.; BVerfGE 131, 316 <366 f.>; BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 29. November 2023 - 2 BvF 1/21 -, Rn. 176). Wollte der Gesetzgeber darauf verzichten, müsste er entweder den Grundsatz aufgeben, dass der Bundestag insgesamt nach dem Ergebnis der Verhältniswahl zusammengesetzt ist, - in diesem Fall käme eine reine Mehrheitswahl des gesamten Bundestages oder ein sogenanntes Grabenwahlsystem in Betracht - oder er müsste von der Personenwahl in den Wahlkreisen absehen - also die Wahl allein als Verhältniswahl nach Listen durchführen. Der Gesetzgeber hat sich jedoch im Rahmen seines weiten Gestaltungsspielraums (vgl. BVerfGE 131, 316 <335>) für die Beibehaltung der Wahlkreiswahl sowie der Verhältniswahl nach Landeslisten entschieden.
(2) Den damit zwingend verbundenen Ausgleich zwischen den Ergebnissen der Wahlkreiswahl und der Verhältniswahl hat der Gesetzgeber hingegen - ebenfalls im Rahmen seines weiten Gestaltungsspielraums - neu gestaltet.
Nach dem bisher geltenden Wahlrecht wurden Bundestagsmandate sowohl nach dem Ergebnis der Wahlkreiswahl als auch nach dem Ergebnis der Listenwahl zugeteilt. Zunächst erhielten erfolgreiche Wahlkreisbewerber ein Mandat (sog. Direktmandat). Der Ausgleich erfolgte anschließend, indem beim Sitzzuteilungsverfahren an die Parteien die Wahlkreismandate auf die Sitze der Landeslisten angerechnet wurden (vgl. BVerfGE 95, 335 <355 f.; anders akzentuierend 373 f.>).
Nach dem Zweitstimmendeckungsverfahren werden vor dem Ausgleich keine Mandate vergeben. Zunächst erfolgt die Verteilung der 630 Sitze auf die Parteien und ihre Landeslisten. Sodann wird die Besetzungsreihenfolge für jedes dieser Sitzkontingente bestimmt. Hier rücken erfolgreiche Wahlkreisbewerber in der Rangfolge ihrer Stimmanteile an die Spitze der Landesliste. Erst im letzten Schritt erhalten alle Bewerberinnen und Bewerber in dieser Reihenfolge ihre Mandate.
(3) Die Kritik, dass sich der Gesetzgeber nicht entweder für ein reines Mehrheits- oder für ein reines Verhältniswahlrecht entschieden habe, übersieht, dass der Gesetzgeber nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Verhältniswahl mit Elementen der Personenwahl verbinden darf (vgl. BVerfGE 6, 84 <90>; 95, 335 <349, 354>; 121, 266 <296>; 131, 316 <335 f.>; BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 29. November 2023 - 2 BvF 1/21 -, Rn. 165).
Die Normenkontrollanträge stützen ihre Bewertung der Neuregelung maßgeblich auf Kontinuitäten zum bisherigen Wahlrecht, aus denen sie ableiten, dass die Personenwahl in den Wahlkreisen einen legitimatorischen Eigenwert habe und daher jeder mit einfacher Mehrheit gewählte Kandidat - wie bisher - zwingend ein Mandat erhalten müsse. Aus der Beibehaltung einer Kombination von Verhältniswahl und Wahlkreiswahl folgt jedoch nicht, dass auch das bisherige Ausgleichsverfahren beibehalten werden müsste und nicht neu konzipiert werden könnte. Der Gesetzgeber darf sich vielmehr für eine andere Kombination entscheiden (vgl. BVerfGE 131, 316 <336>).
Die Formulierungen, dass ein Wahlkreismandat "gekappt" werde oder ein Wahlkreis "verwaise", beschreiben die mit der Neuregelung verbundenen Effekte aus der Perspektive des bisherigen Rechts und heben damit die Veränderung hervor. Denn nach der Neuregelung entsteht ein Wahlkreismandat erst und nur dann, wenn es von den für die betroffene Partei abgegebenen Zweitstimmen gedeckt ist. Auch wenn diese Veränderung zunächst irritieren mag, bildet der Vorwurf der "Kappung eines Wahlkreismandats" beziehungsweise der "Verwaisung eines Wahlkreises" für sich genommen noch keinen Gesichtspunkt, der die Neuregelung verfassungsrechtlich unzulässig machen könnte.
(4) Soweit geltend gemacht wird, das Zweitstimmendeckungsverfahren verstoße gegen ein Gebot der Regionalisierung oder der Wahlkreisrepräsentation, finden solche Gebote nicht nur im Grundgesetz , sondern auch im bisherigen Wahlrecht keine Stütze.
Zwar erfolgt im bisherigen wie im neuen Wahlrecht die Einteilung des Wahlgebiets in Wahlkreise auch unter Berücksichtigung der Grenzen der Gemeinden, Kreise und kreisfreien Städte (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BWahlG). Ein Grund hierfür ist die Anlehnung der Wahlorganisation an die kommunalen Verwaltungsstrukturen. Namentlich den Gemeindebehörden kommt bei der Wahlvorbereitung aufgrund der bei ihnen verfügbaren Melderegisterdaten eine besondere Bedeutung zu (vgl. § 9 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2, Abs. 4, 5, § 17 BWahlG). Die Erhaltung gewachsener Kreisstrukturen kann daher auch als Rechtfertigungsgrund für die Beibehaltung von unterschiedlichen Wahlkreisgrößen und damit für Beeinträchtigungen der Wahlgleichheit angesehen werden (vgl. BVerfG, Beschluss der 4. Kammer des Zweiten Senats vom 18. Juli 2001 - 2 BvR 1252/99 u.a. -, Rn. 22). Kann ein Belang Beeinträchtigungen der Wahlgleichheit rechtfertigen, folgt daraus jedoch nicht, dass der Gesetzgeber zu seiner Beachtung verpflichtet wäre (vgl. BVerfGE 4, 31
Auch die Auffassung, das Wahlrecht folge dem Gedanken der Wahlkreisrepräsentation, geht an den Regelungen des bisherigen Wahlrechts vorbei. Nach § 5 BWahlG in der bisherigen Fassung erhielt ein Wahlkreisbewerber, der mit den meisten Stimmen gewählt war, direkt ein Mandat. Er nahm aber keinen Wahlkreissitz ein. Ein Wahlkreis hatte kein Sitzkontingent - im Unterschied zu den Ländern nach den Wahlgesetzen 1949 (§ 8 Abs. 1 BWahlG 1949) und 1953 (§ 6 Abs. 2 BWahlG 1953) sowie nach dem Bundeswahlgesetz 2013 (§ 6 Abs. 2 Satz 1 BWahlG 2013) und zu den Mitgliedstaaten im Europäischen Parlament (vgl. Art. 14 Abs. 2 Sätze 3 und 4 EUV ). Auch bisher besetzte ein Wahlkreisabgeordneter einen Sitz, der seiner Partei und innerhalb der Partei seiner Landesliste zugewiesen war. Nach § 48 BWahlG a.F. rückte daher bisher ein Abgeordneter von der Landesliste nach, auch wenn der ausscheidende Abgeordnete ein Direktmandat inne hatte. Ziel dieser Regelung war seit jeher die Aufrechterhaltung des Parteiproporzes im Bundestag und nicht die Nachbesetzung eines Wahlkreissitzes (vgl. BVerfGE 97, 317 <326 f.>). Darin unterschied sie sich von Regelungen, die für Wahlkreisbewerber lediglich die Nachfolge des im Kreiswahlvorschlag benannten Ersatzbewerbers vorsehen (vgl. z.B. § 40 Abs. 2 des Gesetzes über die Wahlen zum Landtag des Landes Hessen, GVBl I 2006, S. 110).
Es wäre ohnehin verfehlt, Wahlkreisabgeordnete als Delegierte ihres Wahlkreises anzusehen. Denn sie sind gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG Vertreter des ganzen Volkes und allein ihrem Gewissen verantwortlich.
bb) Die weiter geübte Kritik, die Neuregelung enthalte Widersprüche und dem Zweitstimmendeckungsverfahren fehle es an Folgerichtigkeit, läuft schon deshalb ins Leere, weil sie auf dem soeben dargestellten (vgl. oben Rn. 174 ff.) gedanklichen Festhalten an Grundsätzen beruht, die den bisherigen Regelungen des Ausgleichs entnommen werden.
(1) Wenn aus einigen Wahlkreisen nicht der Wahlkreisbewerber mit den meisten Stimmen in den Deutschen Bundestag einzieht, sondern der Wahlkreis durch einen anderen oder mehrere andere (Listen-)Abgeordnete im Bundestag vertreten wird, kann darin ein Widerspruch nur erkannt werden, wenn für die Wählerinnen und Wähler in einem Wahlkreis die Wahlkreiswahl als die allein maßgebliche Wahl für die Zuteilung eines Mandats angesehen würde.
Nach dem Verfahren der Zweitstimmendeckung ist jedoch die Wahlkreiswahl gerade nicht allein entscheidend für den Erhalt eines Mandats. Das Zweitstimmendeckungsverfahren sorgt vielmehr dafür, dass jeder Abgeordnete des Bundestages durch die Zweitstimmen für seine Partei legitimiert ist. Nach dieser vom Gesetzgeber gewählten Konzeption ist nicht der Listenabgeordnete ohne Wahlkreissieg, sondern der Wahlkreissieger ohne Listendeckung schwächer - und für eine Mandatszuteilung unzureichend - legitimiert (vgl. BTDrucks 20/5370, S. 10).
(2) Ebenso liegt kein Widerspruch darin, dass erfolgreiche Wahlkreisbewerber bei der Sitzvergabe Vorrang vor den Kandidierenden der Landesliste haben. Auch wenn die Wahlkreiswahl nicht mehr wie bisher direkt ein Mandat zur Folge hat, führt dies nicht zu ihrer Bedeutungslosigkeit, rücken doch erfolgreiche Wahlkreisbewerber an die Spitze der jeweiligen Landesliste ihrer Partei. Die Wahlkreiswahl vermittelt damit weiterhin demokratische Legitimation. So wie die Zweitstimmendeckung die Legitimation der Erststimmenwahl verstärkt (vgl. BTDrucks 20/5370, S. 10), erhöht der zusätzliche Erfolg bei der Erststimmenwahl die Legitimation der Abgeordneten, die die Mandate für eine Partei einnehmen. Weder nach dem Demokratieprinzip noch nach Art. 38 Abs. 1 GG ist es verfassungsrechtlich geboten, dass die Wahlkreiswahl Legitimation ausschließlich allein, nicht aber zusammen mit der Listenwahl vermittelt.
cc) Bedenken, das Zweitstimmendeckungsverfahren führe in der Praxis zu widersinnigen Effekten, vermögen ebenfalls nicht zu überzeugen. Weder erscheinen die dazu vorgebrachten Annahmen zwingend, noch wären die befürchteten Effekte widersinnig.
(1) Die Regierung des Landes Sachsen-Anhalt befürchtet eine desintegrierende Wirkung, da in bestimmten Regionen, insbesondere in Ostdeutschland, besonders häufig und über mehrere Wahlperioden hinweg erfolgreiche Wahlkreisbewerber kein Mandat erhalten könnten. Bei den vergangenen Bundestagswahlen sind in den ostdeutschen Ländern Überhangmandate jedoch in sehr unterschiedlicher Häufigkeit und für unterschiedliche Parteien angefallen (vgl. Pukelsheim, Stellungnahme Ausschussdrucksache 20<4>171 E, Anlage 2). Deshalb findet die Annahme der Regierung des Landes Sachsen-Anhalt schon empirisch keine Grundlage.
Auch eine desintegrierende Wirkung "fehlender" Wahlkreisabgeordneter ist nicht hinreichend plausibel. In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat wurde aufgrund der Schilderung der angehörten Abgeordneten unterschiedlicher Fraktionen und der Sachverständigen deutlich, dass sich die Wahlkreisarbeit von Listenabgeordneten strukturell nicht von derjenigen der Wahlkreisabgeordneten unterscheidet. Beide setzen sich nicht lediglich für die eigene Wählerschaft ein, sondern verstehen sich als Mittler zwischen der lokalen und der Bundesebene. Zudem ist - vor allem bei Abgeordneten kleinerer Parteien - bereits heute die "Mitbetreuung" benachbarter Wahlkreise üblich.
(2) Soweit (Wahlkreis-)Abgeordnete in der mündlichen Verhandlung ausgeführt haben, dass im Zweitstimmendeckungsverfahren unter Zugrundelegung der Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 absehbar keine Mandate an Bewerber bestimmter Landeslisten vergeben würden und für erfolgreiche Wahlkreisbewerber das Risiko bestehe, aufgrund des Zweitstimmenanteils kein Mandat zu erhalten, was dazu führen könne, dass potentielle Bewerber auf eine Kandidatur verzichteten, verkennen sie die mit jeder Wahl verbundene Ungewissheit des Gewähltwerdens oder Nichtgewähltwerdens. Deutlich wurde jedoch ebenso, dass Wahlkreisbewerber die Wahlwerbung intensivieren dürften, um einerseits ihre Chancen gegenüber Bewerbern der eigenen Partei in anderen Wahlkreisen (ihres Landes) zu verbessern und andererseits die Chancen ihrer Partei auf mehr Sitze zu erhöhen.
Die Erststimmenwahl wird für Wählerinnen und Wähler auch nicht bedeutungslos. Erhält der Wahlkreisbewerber mit den meisten Erststimmen kein Mandat, stellt sich die Wahl auch rückwirkend nicht als "sinnlos", sondern zunächst als erfolglos dar, wobei er als Wahlkreisgewinner weiterhin an der Spitze der für Nachrückungen fortgeltenden Landesliste stehen bleibt.
dd) Dem Vorbringen, die zunehmende Größe des Bundestages begründe keinen hinreichenden Reformbedarf, steht der breite Konsens einer langjährigen Reformdebatte entgegen (1). Es ist auch unstreitig, dass ein Wahlsystem, in dem einerseits Einzelpersonen in Wahlkreisen und andererseits Personenlisten in den Ländern gewählt werden, nicht alle an eine Wahl gestellten Erwartungen vollständig erfüllen kann (2).
(1) In der Vergangenheit haben alle im Bundestag vertretenen Parteien grundlegenden Reformbedarf gesehen. Das Bundeswahlgesetz 2020, das auf dem Gesetzentwurf der damaligen Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD beruhte, hielt die beiden eingeführten Mechanismen - drei unausgeglichene Überhangmandate und die teilweise länderübergreifende Anrechnung von Überhangmandaten - zur Begrenzung des Anwachsens des Bundestages dauerhaft nicht für ausreichend. Deshalb sah § 1 Abs. 2 BWahlG 2020 mit Wirkung zum 1. Januar 2024 (vgl. Art. 2 Abs. 2 des Fünfundzwanzigsten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlgesetzes ) eine Reduktion der Wahlkreise von 299 auf 280 vor, die nach der Gesetzesbegründung bewusst maßvoll sein sollte (vgl. BTDrucks 19/22504, S. 2, 5 f.).
Die Reformkommission nach § 55 BWahlG 2020 erhielt den vordringlichen Auftrag, sich auf der Grundlage der Prinzipien des personalisierten Verhältniswahlrechts mit Maßnahmen zur wirksamen Begrenzung der Vergrößerung des Bundestages über dessen Regelgröße hinaus zu befassen (vgl. BTDrucks 20/1023; BTDrucks 20/3250, S. 5). In der Reformkommission bestand Einigkeit darüber, dass Änderungen an den Stellgrößen des bisher geltenden Wahlrechts weitgehend ausgeschöpft seien (BTDrucks 20/3250, S. 11).
(2) Im Ausgangspunkt teilen alle Parteien im Bundestag die im Übrigen unangefochtene Einsicht, dass "ein perfektes Wahlsystem, das sämtliche Anforderungen und Wünsche erfüllt", nicht existiert (vgl. BTDrucks 20/3250, S. 13). Zu den Anforderungen zählt nicht nur die Umsetzung der Ergebnisse der Wahlkreis- und der Listenwahl, also die Vergabe von Mandaten an Wahlkreisbewerber nach dem Wahlkreisergebnis und die Zusammensetzung des Bundestages nach dem Listenwahlergebnis. Hinzu kommen weitere Zielsetzungen wie die Begrenzung der Bundestagsgröße auf ein Maß, das möglichst wenig von der gesetzlich vorgesehenen Regelgröße abweicht, oder die föderale Untergliederung der Listenwahl, die den Parteien eine Entscheidung darüber erlaubt, in welchen Ländern sie Vorschläge einreichen.
ee) Soweit geltend gemacht wird, der Wahlgesetzgeber habe Maßgaben des Bundesstaatsprinzips verletzt, wird außer Acht gelassen, dass der Gesetzgeber zwar zur Berücksichtigung föderaler Belange berechtigt, nicht jedoch verpflichtet ist (vgl. BVerfGE 6, 84 <99>; 16, 130 <143>; 95, 335 <402>; 121, 266 <305>; BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 29. November 2023 - 2 BvF 1/21 -, Rn. 200). Insbesondere besteht keine Verpflichtung, das Wahlrecht so auszugestalten, dass als Ergebnis der Wahl aus jedem Land bevölkerungsproportional Wahlkreisbewerber in den Bundestag einziehen. Die Wahlgleichheit verlangt einen möglichst gleichen Zuschnitt der Wahlkreise (vgl. BVerfGE 16, 130 <136, 139>; 95, 335 <353>; 121, 266 <295 f.>; 130, 212 <229 f.>), sie garantiert jedoch keine bestimmten Ergebnisse. Ebenso wenig führt die Möglichkeit einer föderalen Proporzverzerrung zu einer anderen Bewertung. Sie ist dem Umstand, dass eine Landespartei an Bundestagswahlen teilnimmt, immanent.
Zudem lässt sich die Forderung nach einer regionalen Repräsentanz, die die Antragstellerin zu I. erhebt, ohnehin nicht aus dem Bundesstaatsprinzip ableiten. Zwar ermöglicht ein Wahlrecht, das föderale Belange berücksichtigt, dass sich eine Partei als Landespartei auf nur ein Land beschränkt. Hiervon unabhängig ist jedoch, ob sich eine Partei auf das Erringen von Zweitstimmen oder von Wahlkreisen konzentriert. Auch wenn sie - wie lange Zeit der Antragsteller zu III. - alle oder nahezu alle Wahlkreismandate in einem Land gewinnt, wird sie damit nach der Konzeption des Grundgesetzes nicht zur Repräsentantin dieses Landes im Bundestag.
ff) Ebenso wenig ergeben sich aus dem Demokratieprinzip verfassungsrechtliche Anforderungen, gegen die das zur Prüfung gestellte Zweitstimmendeckungsverfahren verstieße. Ungeachtet der Frage, welche Folgerungen aus dem Mehrheitsprinzip gezogen werden könnten, wird es nicht dadurch berührt, dass Wahlkreisbewerber mit den meisten Stimmen kein Mandat, sondern lediglich den Vorrang vor Listenbewerbern erhalten. Das Mehrheitsprinzip trifft keine Aussage darüber, was mit einer Mehrheit erreicht wird.
b) Das in § 1 Abs. 3, § 6 Abs. 1 und Abs. 4 Sätze 1 und 2 BWahlG geregelte Zweitstimmendeckungsverfahren verletzt die Wahlgleichheit gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG nicht. § 6Abs. 1 und 2 BWahlG behandelt zwar Wahlstimmen für einen erfolgreichen unabhängigen Bewerber und Wahlstimmen für einen von einer Partei aufgestellten Bewerber ungleich; dies ist jedoch gerechtfertigt (aa). Darüber hinaus begründet das Zweitstimmendeckungsverfahren keine Ungleichbehandlung (bb).
aa) Wahlstimmen für einen unabhängigen Bewerber werden im Fall seines Erfolgs anders behandelt als Wahlstimmen für Wahlkreisbewerber einer Partei. Zum einen erhält der unabhängige Bewerber ein Bundestagsmandat gemäß § 6 Abs. 2 BWahlG unabhängig vom Sitzvergabeverfahren nach dem Zweitstimmenergebnis. Zum anderen sieht § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 BWahlG vor, dass die Zweitstimmen der Wählerinnen und Wähler, die mit ihrer Erststimme einen unabhängigen Bewerber mit Erfolg gewählt haben, nicht berücksichtigt werden.
Diese Ungleichbehandlung ist gerechtfertigt. Das Zweistimmenwahlrecht des Bundeswahlgesetzes sieht einen Ausgleich zwischen dem Erst- und dem Zweitstimmenergebnis vor. Ist ein solcher Ausgleich ausgeschlossen, weil zwischen Wahlkreisbewerber und Landesliste kein Ausgleichszusammenhang hergestellt werden kann, ist eine besondere Berücksichtigung dieser Konstellation zwingend.
(1) Soweit ein unabhängiger Wahlkreisbewerber ein Mandat außerhalb des Sitzzuteilungsverfahrens - also außerhalb der Sitzverteilung auf die Parteien nach § 4 BWahlG (vgl. § 4 Abs. 1 Satz 2 BWahlG) und unabhängig von der Sitzvergabe nach § 6 BWahlG (vgl. § 6 Abs. 2 BWahlG) - erhält, ist die darin liegende Ungleichbehandlung gegenüber Wahlkreisbewerbern einer Partei gerechtfertigt. Mit der Möglichkeit, unabhängige Bewerber für die Wahlkreiswahl vorzuschlagen, sichert der Gesetzgeber das Wahlvorschlagsrecht aller Wahlberechtigten unabhängig von politischen Parteien als Kernstück des Bürgerrechts auf aktive Teilnahme an der Wahl. Dieses Korrektiv zur hervorgehobenen Rolle der Parteien bei der politischen Willensbildung des Volkes verhindert die Monopolisierung des Wahlvorschlagsrechts bei den politischen Parteien und dadurch eine Mediatisierung der keiner Partei angehörenden Bürger (vgl. BVerfGE 41, 399 <417>). Diesem Ziel dient die konzeptionell notwendige Ausnahme vom Erfordernis der Zweitstimmendeckung für unabhängige Wahlkreisbewerber (vgl. BTDrucks 20/5370, S. 11). Soweit darin eine "Besserstellung" gegenüber parteigebundenen Bewerbern liegt, besteht hiermit ein sachlich legitimierter Grund, der der Wahlgleichheit die Waage halten kann.
Die Ausnahme vom Zweitstimmendeckungsverfahren ist zur Erreichung des mit ihr verfolgten Ziels auch geeignet und erforderlich. Eine Gleichstellung der Wahlkreisbewerber einer Partei mit unabhängigen Bewerbern wäre kein gleich geeignetes, milderes Mittel. Denn das Sitzzuteilungsverfahren nach dem Zweitstimmenergebnis käme dann erst nach der Mandatserteilung an 299 Wahlkreisbewerber für die verbleibenden 331 Bundestagssitze zum Zuge und würde entsprechend § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 BWahlG lediglich die Zweitstimmen der Wählerinnen und Wähler berücksichtigen, die nicht mit ihrer Erststimme erfolgreiche Wahlkreisbewerber gewählt haben. Damit würde das weitere Ziel des Gesetzgebers verfehlt, eine möglichst genaue Abbildung des Parteienproporzes im Bundestag gemäß dem Zweitstimmenergebnis zu erreichen.
Zudem haben unabhängige Wahlkreisbewerber gegenüber parteigebundenen Kandidaten auch Nachteile zu gewärtigen. Während Wahlkreisbewerber einer Partei gemeinsam mit anderen Bewerbern ihrer Partei Mandate erhalten und im Bundestag mit diesen aufgrund ihrer gleichgerichteten politischen Ziele eine Fraktion bilden können, besteht für einen unabhängigen Bewerber ein solcher Zusammenhang zu einer Partei grundsätzlich auch dann nicht, wenn Mitglieder einer Partei als unabhängige Bewerber kandidieren. Dadurch, dass die Zweitstimmen von Wählerinnen und Wählern erfolgreicher unabhängiger Bewerber nach § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 BWahlG unberücksichtigt bleiben, stehen unabhängige Bewerber zu Parteien, die mit ihren Listenwahlvorschlägen den Einzug in den Bundestag anstreben, in einem Konkurrenzverhältnis. Der Unterschied zu Bewerbern einer Partei wirkt sich bereits im Wahlkampf in erheblicher Weise aus. Diese profitieren in hohem Maße vom Wahlkampf ihrer Partei. Parteien besitzen Strukturen und Unterstützer, erhalten eine Parteienfinanzierung und haben aufgrund von Art. 21 Abs. 1GG Anspruch auf gleiche Behandlung etwa bei der Vergabe von Wahlwerbezeiten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Zwar ist das Stimmensplitting zwischen 1980 bis 2005 gestiegen, bewegt sich jedoch seitdem auf ungefähr gleichem Niveau. Immer noch wählen 75 Prozent der Wählerinnen und Wähler mit ihrer Erst- und Zweitstimme die Vorschläge derselben Partei (vgl. Bundeswahlleiter, Kurzbericht über die Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik zur Bundestagswahl 2021, 2022, S. 8).
(2) Soweit die Zweitstimmen der Wählerinnen und Wähler eines erfolgreichen unabhängigen Bewerbers nach § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 BWahlG unberücksichtigt bleiben, rechtfertigt sich die Ungleichbehandlung gegenüber anderen Wählerinnen und Wählern daraus, dass damit ein doppeltes Stimmgewicht (vgl. oben Rn. 153 f.) vermieden wird. Hierdurch wird die Wahlgleichheit nicht beeinträchtigt, sondern im Gegenteil verwirklicht, indem verhindert wird, dass die für politische Parteien abgegebenen Zweitstimmen diesen zu Bundestagsmandaten verhelfen, obwohl die Erststimmen der betreffenden Wählerinnen und Wähler schon zur Zuteilung eines Bundestagssitzes an einen unabhängigen Bewerber geführt haben, der eben nicht im Wege des Verhältnisausgleichs verrechnet werden kann (vgl. BVerfGE 5, 77 <82 f.>; 7, 63 <73 f.>; 79, 161 <167 f.>).
bb) Darüber hinaus führt das Zweitstimmendeckungsverfahren nicht zur Ungleichbehandlung von Wahlstimmen. Alle Wahlstimmen haben den gleichen Zählwert und die gleichen Erfolgschancen (1). Auch die von den Normenkontrollanträgen behauptete Erfolgswertgleichheit der Erststimmen ist nicht beeinträchtigt (2).
(1) Soweit Wählerinnen und Wähler mit ihrer Erststimme einen Wahlkreisbewerber einer Partei wählen, wird diese Stimme bei der Auszählung berücksichtigt. Im Wahlergebnis wird sie als eine Stimme für diesen Wahlkreisbewerber ausgewiesen.
Auch die Erfolgschancen der Erststimmen sind gleich. Jede Erststimme führt dann zu einem Mandat für den Wahlkreisbewerber, wenn zum einen der Bewerber die meisten Erststimmen im Wahlkreis und zum anderen die Landesliste seiner Partei so viele Zweitstimmen erhält, dass ihr Sitzkontingent für alle ihre erfolgreichen Wahlkreisbewerber mit dem gleichen oder besseren Erststimmenanteil ausreicht. Beide Bedingungen sind so gestaltet, dass sie ausschließlich vom Wahlergebnis abhängig sind. Die Erfolgschance ex ante ist für jede Wahlstimme gleich.
Ferner folgt aus dem Gleichheitsgebot des Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG nicht, dass alle Wahlkreisbewerber mit den meisten Stimmen in ihrem Wahlkreis ein Mandat erhalten müssen. Der Grundsatz der Wahlgleichheit gibt nicht vor, dass die Mandatszuteilung an keine weitere Bedingung geknüpft werden darf. Das weitere Erfordernis eines ausreichenden Wahlergebnisses bei den Zweitstimmen stellt auch keine willkürliche Bedingung dar, sondern findet seinen sachlichen Grund darin, dass die Wahl als Zweistimmenwahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl (§ 1 Abs. 2 BWahlG) erfolgt.
Ebenso lässt sich aus dem Mehrwert der Personenwahl, der in der Personalisierung und Regionalisierung liegt, nicht ableiten, dass die Nichtberücksichtigung eines Wahlkreissiegers für ein Bundestagsmandat bei Verfehlen der weiteren Voraussetzung der Zweitstimmendeckung eine relevante Ungleichbehandlung darstellt. Die Personenwahl ist nach dem Bundeswahlgesetz 2023 ein Personalisierungselement der Verhältniswahl, das der Gesetzgeber dieser untergeordnet hat. Zutreffend führen die Normenkontrollanträge aus, dass auch andere Möglichkeiten der Personalisierung, wie das Kumulieren und Panaschieren, existieren. Wie der Bundestag in seiner Stellungnahme zu Recht hervorhebt, bestätigt dies jedoch gerade, dass die Wahlgleichheit nicht beeinträchtigt wird, wenn einzelne Bewerber aufgrund des Wahlergebnisses vorrangig vor anderen berücksichtigt werden.
(2) Auch die Stimmen für einen erfolgreichen Wahlkreisbewerber, der ein Mandat im Zweitstimmendeckungsverfahren erhält, und die Stimmen für einen erfolgreichen Bewerber in einem anderen Wahlkreis, der kein Mandat erhält, werden nicht ungleich behandelt. Die Nichtzuteilung des Mandats an den erfolgreichen Bewerber ohne Zweitstimmendeckung ist das Ergebnis des vom Gesetzgeber gewählten Zuteilungsmechanismus, der gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 BWahlG von zwei Voraussetzungen abhängig ist, von der Erlangung der meisten Erststimmen im Wahlkreis und der Zweitstimmendeckung durch die Landesliste. Der Erfolgswert der Wahlstimmen bestimmt sich entsprechend nach diesen beiden Voraussetzungen.
c) Das Gebot der Unmittelbarkeit der Wahl gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG wird durch das Zweitstimmendeckungsverfahren ebenfalls nicht verletzt. Dieses Gebot ist formal und einheitlich sowohl auf die Erst- als auch auf die Zweitstimmenwahl anzuwenden (vgl. BVerfGE 97, 317 <326 f.>).
Das Verfahren der Zweitstimmendeckung ändert nichts daran, dass die Erststimme jeder Wählerin und jedes Wählers einem bestimmten Wahlkreisbewerber zugerechnet werden kann. Bei der Stimmabgabe ungewiss ist allein der Stimmerfolg. Dieser richtet sich ausschließlich nach dem - einheitlichen (vgl. BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 19. Dezember 2023 - 2 BvC 4/23 -, Rn. 286) - Wahlvorgang und dem daran anschließenden gesetzlich vorgesehenen Sitzzuteilungsverfahren. Die Entscheidung, in welcher Reihenfolge erfolgreiche Wahlkreisbewerber ein Mandat erhalten oder bei fehlender Zweitstimmendeckung kein Mandat erlangen, ist damit allein durch das Wahlergebnis und das Wahlgesetz festgelegt. Sie wird weder von einer "Zwischeninstanz nach ihrem Ermessen" getroffen noch durch einen von dem der Wählerinnen und Wähler "verschiedenen Willen" beeinflusst (vgl. BVerfGE 7, 63 <68 f.>).
Die Annahme, Wählerinnen und Wähler könnten ex ante nicht erkennen, ob beziehungsweise wie sich ihre Stimmabgabe tatsächlich auswirken werde, geht an den verfassungsrechtlichen Anforderungen vorbei. Für den Grundsatz der Unmittelbarkeit ist nicht entscheidend, dass die Stimme tatsächlich die von den Wählerinnen und Wählern beabsichtigte Wirkung entfaltet. Ausreichend ist die Möglichkeit einer der Intention der jeweiligen Wählerinnen und Wähler entsprechenden positiven Beeinflussung des Wahlergebnisses (vgl. BVerfGE 121, 266 <307>; BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 29. November 2023 - 2 BvF 1/21 -, Rn. 162). Dies ist beim Zweitstimmendeckungsverfahren der Fall. Jede Erststimme erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der gewählte Bewerber die meisten Stimmen im Wahlkreis erhält, und ebenso, dass sein Stimmenanteil ausreicht, um bei der Sitzvergabe ein Mandat zu erlangen.
d) Gegen die Chancengleichheit der Parteien gemäß Art. 21 Abs. 1 GG wird ebenfalls nicht verstoßen. Soweit hierfür auf Eingriffe in die Wahlgleichheit verwiesen wird, ergibt sich dies bereits daraus, dass diese - wie ausgeführt - nicht verletzt ist.
Die Einschätzung, das Zweitstimmendeckungsverfahren belaste die Oppositionsparteien in besonderer Weise, teilt der Senat nicht. Das Zweitstimmendeckungsverfahren dient der Zusammensetzung des Bundestages nach Parteienproporz ebenso wie das bislang geltende System der Ausgleichsmandate. Anders als der Begriff der "Kappung" suggeriert, wird Parteien durch das Zweitstimmendeckungsverfahren kein ihnen bereits zugeteiltes Sitzkontingent gekürzt (vgl. oben Rn. 178). Die damit erreichte Einhaltung der gesetzlichen Größe des Bundestages führt lediglich dazu, dass im kommenden Deutschen Bundestag von jeder Partei weniger Abgeordnete vertreten sein werden, als dies nach dem bisherigen Wahlrecht der Fall gewesen wäre. Auch der Umstand, dass der Antragsteller zu III. diejenige Partei ist, auf die bei der Bundestagswahl 2021 die maximal ermöglichten drei unausgeglichenen Überhangmandate entfallen sind, führt zu keiner anderen Bewertung. Überhangmandate stellen ihrerseits eine Beeinträchtigung der Chancengleichheit dar (vgl. BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 29. November 2023 - 2 BvF 1/21 -, Rn. 171). Wird die Ungleichbehandlung beseitigt, stellt dies die Chancengleichheit insoweit wieder her und verletzt sie nicht.
Auch der Verweis darauf, dass der Antragsteller zu III. sich organisatorisch auf ein Land beschränke und daher strukturell Überhangmandate erziele, führt zu keiner anderen Beurteilung. Vielmehr könnte gerade die ungleiche Wirkung der länderübergreifenden Anrechnung von Überhängen nach dem Bundeswahlgesetz 2020 auf Landesparteien im Unterschied zu bundesweit aktiven Parteien zu einer Beeinträchtigung der Chancengleichheit der letztgenannten Parteien führen.
Schließlich liegt in der Sitzvergabe an unabhängige Bewerber gemäß § 6 Abs. 2 BWahlG keine Benachteiligung von Parteien. Entschließen sich Bewerber, nicht für eine Partei zu kandidieren, nehmen sie gerade die Möglichkeit wahr, die als Korrektiv zu der hervorgehobenen Rolle der Parteien vorgesehen ist (vgl. oben Rn. 202). Da diese Regelung eine Monopolisierung des Wahlvorschlagsrechts bei den politischen Parteien verhindert, kann darin keine Verletzung von Art. 21 Abs. 1 GG liegen.
3. Die Sperrklausel des § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG ist in ihrer geltenden Form mit dem Grundgesetznicht vereinbar. Sie beeinträchtigt den Grundsatz der Wahlgleichheit gemäß Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG (a). Eine solche Beeinträchtigung kann zwar durch das Ziel gerechtfertigt sein, die Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Bundestages zu sichern (b). Eine Sperrklausel ist hierfür auch derzeit in Höhe von 5 Prozent grundsätzlich ein geeignetes Mittel (c). Die in § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG vorgesehene Sperrklausel ist jedoch unter den geltenden rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen nicht in vollem Umfang erforderlich, um die Funktionsbedingungen des Bundestages zu sichern (d). Der Gesetzgeber muss daher derzeit ein milderes Mittel wählen, um die Integrationsfunktion der Wahl zu sichern (e).
a) Durch die zur Prüfung gestellte Sperrklausel werden Parteien, die nach ihrem Zweitstimmenergebnis rechnerisch Bundestagssitze erhalten könnten, bei der Sitzverteilung nicht berücksichtigt, wenn sie im Bundesgebiet weniger als 5 Prozent der gültigen Zweitstimmen erreicht haben. Dies ist eine Ungleichbehandlung gegenüber Wahlstimmen für Parteien mit einem höheren Zweitstimmenergebnis (aa). Es liegt jedoch keine Beeinträchtigung der Wahlgleichheit darin, dass § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG keine Differenzierung danach vornimmt, ob eine solche Partei erfolgreiche Wahlkreisbewerber vorweisen kann (bb).
aa) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts führt eine Sperrklausel zu einer Ungleichgewichtung der Wahlstimmen (vgl. BVerfGE 1, 208 <247 ff.>; 5, 77 <83>; 120, 82 <105 f.>; 129, 300 <319>; 135, 259 <285>). Während sie den Zählwert aller Wahlstimmen unberührt lässt, werden diese hinsichtlich ihres Erfolgswerts ungleich behandelt. Obwohl nach den Berechnungsregeln des Sitzzuteilungsverfahrens Parteien Mandate erhalten könnten, werden solche mit weniger als 5 Prozent der gültigen Wahlstimmen bei der Sitzverteilung nicht berücksichtigt. Wahlstimmen für diese Parteien bleiben ohne Erfolg.
bb) Demgegenüber liegt keine Beeinträchtigung der Wahlgleichheit darin, dass der von § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG vorgesehene Ausschluss vom Sitzverteilungsverfahren vom (Erststimmen-)Erfolg der Wahlkreisbewerber der betroffenen Partei unabhängig stattfindet. Die Verfassung gibt nicht vor, nach welchen Kriterien der Gesetzgeber zwischen bedeutsamen und nicht bedeutsamen Parteien unterscheiden muss. Insbesondere muss er Parteien mit regionalen Schwerpunkten nicht gesondert berücksichtigen.
Zwar hat das Bundesverfassungsgericht in seiner ersten Entscheidung zu einer Sperrklausel - zum Schleswig-Holsteinischen Landeswahlgesetz vom 22. Oktober 1951 (GVBl S. 180) - darauf abgestellt, dass "unter dem Gesichtswinkel einer Bekämpfung der Splitterparteien" zur kleinen Zahl der für eine Partei abgegebenen Stimmen hinzukommen müsse, dass die Partei keinen örtlichen Schwerpunkt habe (vgl. BVerfGE 1, 208 <252>). Dies interpretierte der Südschleswigsche Wählerverband dahin, dass Parteien mit örtlichem Schwerpunkt nicht als Splitterparteien angesehen werden dürften. Er griff die Folgefassung des Landeswahlgesetzes vom 5. November 1962 (GVBl S. 175), die lediglich die Sperrklausel von 7,5 auf 5 Prozent abgesenkt hatte, erneut an, weil sie seine Beschränkung als Partei einer nationalen Minderheit auf einen Teil des Landes nicht berücksichtige. Daraufhin stellte das Bundesverfassungsgericht aber klar, dass sich die Begriffsbestimmung, was eine Splitterpartei sei, nur aus dem konkret zu überprüfenden Wahlgesetz ergeben könne und damit im Ermessen des Gesetzgebers liege (vgl. BVerfGE 4, 31 <40 f.>). Der Gleichheitssatz ist nicht schon dann verletzt, wenn der Gesetzgeber Differenzierungen, die er vornehmen darf, nicht vornimmt (vgl. BVerfGE 4, 31
b) Für Sperrklauseln im Verhältniswahlrecht kann die Sicherung der Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Parlaments einen legitimen Rechtfertigungsgrund darstellen (aa). Seine Bedeutung bemisst sich nach den konkreten Funktionen des zu wählenden Organs (bb).
aa) Die Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Parlaments ist ein Rechtfertigungsgrund für Sperrklauseln (vgl. BVerfGE 4, 31 <39 f.>; 6, 84 <92 f.>; 82, 322 <338>; 95, 408 <419>; 146, 327 <353 f. Rn. 67>; BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 6. Februar 2024 - 2 BvE 6/23 u.a. -, Rn. 118), der als verfassungsrechtlicher Belang von höchstem Rang der Wahlgleichheit und der Chancengleichheit der Parteien die Waage halten kann (vgl. BVerfGE 95, 335 <404>; 146, 327 <350 f. Rn. 61 f.> m.w.N.; Urteil des Zweiten Senats vom 29. November 2023 - 2 BvF 1/21 -, Rn. 184). Ziel der Bundestagswahl ist nicht allein, den politischen Willen der Wählerinnen und Wähler durch eine den Wahlstimmen entsprechende Repräsentation der Parteien zur Geltung zu bringen. Die Wahl vermittelt als Integrationsvorgang bei der politischen Willensbildung des Volkes staatlichem Handeln demokratische Legitimation. Hierfür muss die Wahl einen arbeits- und funktionsfähigen Bundestag hervorbringen (vgl. BVerfGE 6, 84 <92>).
bb) Maßgeblich für die Beurteilung der Zulässigkeit einer Sperrklausel bei der Wahl zum Deutschen Bundestag sind die ihm in der Verfassungsordnung des Grundgesetzes zugewiesenen zentralen Funktionen. Ihm obliegt die Wahl und fortlaufende Unterstützung einer handlungsfähigen Regierung, was die Bildung einer stabilen Mehrheit voraussetzt (vgl. BVerfGE 146, 327 <353 f. Rn. 67> m.w.N.). Dies ist nicht von der Kontrollfunktion des Bundestages zu trennen, die Informations- und Mitwirkungsrechte umfasst und in besonderem Maße von Abgeordneten der Opposition wahrgenommen wird (vgl. BVerfGE 142, 25 <56 Rn. 87> m.w.N.; Morlok, in: Dreier, GG , 3. Aufl. 2015, Art. 38 Rn. 34 ff.). Der Bundestag ist zudem Hauptorgan der Gesetzgebung, so dass ihm die wesentliche Aufgabe der Beratung und Beschlussfassung über Gesetze zugewiesen ist (vgl. BVerfGE 150, 345 <367 f. Rn. 55 f.>). Im Zuge der Weiterentwicklung der Europäischen Union hat der Bundestag außerdem die Integrationsverantwortung gemäß Art. 23 GG wahrzunehmen (vgl. BVerfGE 157, 1 <22 f. Rn. 69 ff.> m.w.N. - CETA-Organstreit I). Schließlich bildet er den verfassungsrechtlichen Ort der Debatte für alle die Gemeinschaft interessierenden Angelegenheiten (vgl. BVerfGE 10, 4 <13>; 96, 264 <284 f.>).
Im parlamentarischen Regierungssystem des Grundgesetzes hat insbesondere die kontinuierliche Unterstützung der Bundesregierung durch die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages (vgl. BVerfGE 6, 84 <93 f.>; 114, 121 <149 f.>) zentrale Bedeutung. Erst durch sie bleibt die Verantwortung des Bundestages gegenüber den Wählerinnen und Wählern für die amtierende Regierung aktuell. Dies umfasst die effektive Wahrnehmung der parlamentarischen Kontrolle, für die die Sicherung der Funktionsbedingungen einer effektiven Opposition wesentlich ist. Das schließt die Chance ein, dass entweder bereits innerhalb eines gewählten Bundestages im Rahmen der Art. 67 , 68 GG oder jedenfalls nach der nächsten Wahl neue (Regierungs-)Mehrheiten unter Beteiligung gegenwärtig oppositioneller Parteien zustande kommen (vgl. BVerfGE 5, 85 <198 f.>; 44, 125 <145>; 123, 267 <342 f., 367>). Auch die Bedeutung der weiteren Funktionen des Bundestages hat nicht abgenommen. Im Gegenteil hat etwa die Integrationsverantwortung gemäß Art. 23 GG die Bedeutung der Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Bundestages noch verstärkt.
c) Die Sperrklausel des § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG ist geeignet, die Funktionsfähigkeit des Bundestages zu sichern. Insoweit kommt es nicht darauf an, ob durch sie Parteien ausgegrenzt werden, die inhaltlich an Partikularinteressen ausgerichtet oder zur Kompromissfindung und Koalitionsbildung kaum bereit sind (aa). Die Sperrklausel stellt hiervon unabhängig Bedingungen her, die der Arbeitsfähigkeit des Bundestages dienen (bb). Hierfür ist auch die Höhe von 5 Prozent der bundesweiten gültigen Zweitstimmen sachgerecht (cc).
aa) Es bedarf keiner Entscheidung darüber, ob eine Sperrklausel dafür geeignet ist und dadurch gerechtfertigt sein kann, dass sie gerade solchen Parteien den Einzug in den Bundestag erschwert, die inhaltlich an Partikularinteressen ausgerichtet oder zur Kompromissfindung und Koalitionsbildung kaum bereit sind.
Das Bundesverfassungsgericht hat die Zulässigkeit der bundesweiten Sperrklausel im Wahlgesetz 1953 unter Einbeziehung auch dieses Gesichtspunkts begründet. Es hat ausgeführt, eine Aufspaltung der Volksvertretung in viele kleine Gruppen könne die Meinungsbildung erschweren oder verhindern, während große Parteien die Zusammenarbeit innerhalb des Parlaments erleichterten. Dies beruhe darauf, dass sich bereits in ihnen ein Ausgleich zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen und deren Anliegen vollziehe. Klare und ihrer Verantwortung für das Gesamtwohl bewusste Mehrheiten im Parlament seien für die Bildung einer nach innen und außen aktionsfähigen Regierung und zur Bewältigung der sachlichen gesetzgeberischen Arbeit erforderlich (vgl. BVerfGE 6, 84 <92>).
Es kann offen bleiben, ob eine solche Rechtfertigung der Sperrklausel überholt ist oder nicht. Der Sachverständige Decker hat in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass die Sperrklausel unter den aktuellen politischen Bedingungen nicht die ihr zugedachte Funktion erfülle, derartige Parteien von den Parlamenten fernzuhalten. Denn insbesondere in einigen ostdeutschen Ländern könnten bei anstehenden Landtagswahlen Parteien, die in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland seit Jahrzehnten auch an stabilen Regierungsbildungen beteiligt gewesen seien, an Sperrklauseln scheitern, während Parteien, deren Kompromissbereitschaft und Koalitionsfähigkeit zu bezweifeln sei, weit über 5 Prozent liegende Umfragewerte verzeichneten.
Die Sperrklausel ist jedoch gerechtfertigt, ohne dass es auf ihre Ausgrenzungswirkung gerade gegenüber einer bestimmten Art von Parteien ankommt. Vielmehr rechtfertigt der Erhalt der Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Parlaments aus sich heraus eine Mindestgröße der im Parlament vertretenen Parteien.
bb) Mit einer Sperrklausel verhindert das Wahlrecht eine Zersplitterung des Parlaments in viele kleine Gruppen (vgl. BVerfGE 1, 208 <248>; 120, 82 <111>; 129, 300 <335 f.>; 146, 327 <353 f. Rn. 67>) und sichert damit die Arbeits- und Funktionsbedingungen des Bundestages (1). Sie schafft die Voraussetzungen dafür, dass Zusammenschlüsse von Abgeordneten mit gleichgerichteten politischen Zielen im Bundestag grundsätzlich eine bestimmte Mindestgröße haben (2).
(1) Das Ziel der Sperrklausel besteht darin, eine Organisation des Deutschen Bundestages zu ermöglichen, mit der eine arbeitsteilige Befassung mit den Aufgaben - in Ausschüssen - und eine nach der Parteizugehörigkeit strukturierte Willensbildung - in Fraktionen - gewährleistet sind. Das Wahlrecht sichert hiermit Rahmenbedingungen, durch die der Bundestag seine Funktionen arbeitsteilig und damit als Arbeitsparlament wahrnehmen kann. Ebenso kann der Bundestag die Plenarsitzungen an den Fraktionen orientiert strukturieren, etwa die Tagesordnung interfraktionell abstimmen und Redezeiten unter den Fraktionen aufteilen.
Eine parteipolitische Zersplitterung des Parlaments durch deutlich kleinere Gruppen und eine Reihe von Einzelabgeordneten würde diese bewährten Rahmenbedingungen grundlegend verändern. Dies schließt nicht aus, dass auch in einem solchen Parlament funktionsgerechte Organisationsformen und Arbeitsprozesse entwickelt werden könnten (vgl. Wenner, Sperrklauseln im Wahlrecht der Bundesrepublik Deutschland, 1986, S. 286 ff.). Maßgeblich für die Rechtfertigung einer Sperrklausel sind jedoch nicht abstrakte Erwägungen, die für alle Parlamente gleichermaßen gelten. Vielmehr kommt es auf die konkreten Bedingungen an, unter denen die jeweilige Volksvertretung arbeitet (vgl. BVerfGE 146, 327<351 Rn. 62> m.w.N.).
(2) Die durch die Sperrklausel geschaffenen Voraussetzungen greift der Bundestag im Rahmen seiner Geschäftsordnungsautonomie gemäß Art. 40 Abs. 1 Satz 2 GG für die Bildung von Fraktionen auf. Für die Arbeits- und Funktionsfähigkeit grundlegend ist dabei die Fraktionsbildung der Abgeordneten entsprechend ihren gleichgerichteten politischen Zielen. Eine Sperrklausel sichert diese Voraussetzung so, dass Fraktionen grundsätzlich eine bestimmte Mindestgröße haben.
Zur Spiegelung der politischen Entscheidungen der Wählerinnen und Wähler erfolgt dies gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages ( GO-BT ) grundsätzlich entlang der Parteizugehörigkeit der Abgeordneten (vgl. BVerfGE 80, 188 <219 f.>; 84, 304 <322>). Denn nicht nur Abgeordnete, die infolge der Listenwahl ein Mandat erhalten haben, sondern auch die Abgeordneten, die ihr Mandat infolge der Wahlkreiswahl erlangt haben, werden praktisch ausnahmslos von Parteien vorgeschlagen. Zwar können gemäß § 20 Abs. 3 BWahlG auch Vorschläge für unabhängige Wahlkreisbewerber eingereicht werden; seit 1953 waren unabhängige Bewerber jedoch nicht mehr erfolgreich (vgl. Böth, in: Schreiber, BWahlG, 11. Aufl. 2021, § 18 Rn. 3).
Für Fraktionen, die von Abgeordneten mehrerer Parteien gebildet werden sollen, behält sich der Bundestag gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 GO-BT grundsätzlich die Anerkennung vor. Die Entwicklung der Antragstellerin zu V. spiegelt dabei die Bedeutung gleichgerichteter politischer Ziele in einer Fraktion wider. Von 2005 bis 2007 bildeten Abgeordnete der PDS und der Partei Arbeit und Soziale Gerechtigkeit - Die Wahlalternative (WASG) eine Fraktion, DIE LINKE. Zuvor hatten sie gemeinsam auf offenen Wahllisten der PDS kandidiert und beabsichtigten die später durchgeführte Fusion zu einer Partei - der Antragstellerin zu IV. (vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Nr. 38/07). Im Dezember 2023 führte der Austritt einiger Abgeordneter aus der Partei DIE LINKE im Zuge der Neugründung der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) dazu, dass sie auch aus der Fraktion ausschieden. Eine gemeinsame Verfolgung gleichgerichteter politischer Ziele war nicht mehr gegeben.
Gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 GO-BT können Parteien auch zustimmungsfrei eine Fraktion bilden, wenn sie aufgrund gleichgerichteter politischer Ziele in keinem Land miteinander im Wettbewerb stehen. Die Regelung der Geschäftsordnung greift auf, dass seit Bestehen des Bundestages die Abgeordneten des Antragstellers zu III. und der Beigetretenen eine gemeinsame Fraktion bilden. In der politischen Öffentlichkeit treten die beiden Parteien als "Schwesterparteien" auf.
cc) Die von § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG vorgegebene Höhe der Sperrklausel von 5 Prozent der bundesweiten gültigen Zweitstimmen ist für diesen Zweck sachgerecht. Die in ständiger Rechtsprechung bestätigte Beurteilung (1) hat auch angesichts der zwischenzeitlich eingetretenen rechtlichen und tatsächlichen Änderungen Bestand (2).
(1) Das Bundesverfassungsgericht hat die Sperrklausel des Bundeswahlgesetzes in Höhe von 5 Prozent stets für verfassungskonform erachtet (vgl. BVerfGE 1, 208 <247 ff.>; 6, 84 <92 ff.>; 82, 322 <337 ff.>; 95, 335 <366>; 95, 408 <419>; 122, 304 <314 f.>; 146, 327 <353 f. Rn. 67>).
(a) Die angemessene Höhe einer Sperrklausel lässt sich nicht eindeutig nach generalisierbaren sachlichen Kriterien bestimmen. Grundsätzlich folgt hieraus ein Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers, den das Bundesverfassungsgericht nur im Hinblick auf die Überschreitung verfassungsrechtlicher Grenzen kontrolliert (vgl. BVerfGE 1, 208 <256>; 51, 222 <237 f.>; 95, 408 <419>; 146, 327 <358 Rn. 78 f.>). Wegen der Bedeutung des Wahlrechts ist sein Ermessensspielraum für Differenzierungen im Rahmen der Wahlgleichheit jedoch eng bemessen; Beschränkungen der Wahlgleichheit unterliegen stets der strikten Kontrolle des Bundesverfassungsgerichts (vgl. BVerfGE 146, 327 <352 Rn. 63> m.w.N.).
Dabei kann es Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts sein, gleichheitsrechtliche Anforderungen so zu konkretisieren, dass der Gesetzgeber das Wahlrecht auf verlässlicher verfassungsrechtlicher Grundlage gestalten kann und infolgedessen das Risiko einer Bundestagsauflösung im Wahlprüfungsverfahren wegen unzureichender Normierung minimiert wird (vgl. BVerfGE 131, 316 <370>). Deshalb hat der Senat in ständiger Rechtsprechung auf die empirisch vorgefundene Höhe von 5 Prozent abgestellt und eine Sperrklausel in dieser Höhe grundsätzlich für gerechtfertigt gehalten. Im Falle einer Anhebung müsste der Gesetzgeber mit nachvollziehbaren Gesichtspunkten ihre Erforderlichkeit begründen (vgl. BVerfGE 1, 208<256>; 95, 408 <419>; 146, 327 <358 Rn. 78 f.>). Darüber hinaus ist der Gesetzgeber verpflichtet, eine die Wahlgleichheit und die Chancengleichheit berührende Norm des Wahlrechts zu ändern, wenn ihre verfassungsrechtliche Rechtfertigung durch neue Entwicklungen infrage gestellt wird. Sperrklauseln können daher mit Blick auf eine Repräsentativkörperschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt gerechtfertigt sein, mit Blick auf eine andere oder zu einem anderen Zeitpunkt jedoch nicht (vgl. BVerfGE 146, 327 <353 Rn. 65> m.w.N., stRspr).
(b) Die bisherige Beurteilung wird durch hypothetische Betrachtungen zu den Auswirkungen einer niedrigeren Sperrklausel bei den vergangenen Bundestagswahlen nicht durchgreifend in Zweifel gezogen. Sperrklauseln lassen sich nicht abstrakt oder hypothetisch, sondern nur unter Berücksichtigung der jeweiligen politischen Wirklichkeit bewerten (vgl. BVerfGE 146, 327 <353 Rn. 65>), einschließlich des Einflusses einer bestehenden Sperrklausel auf das Wahlverhalten.
(2) Auch unter Berücksichtigung rechtlicher (a) und tatsächlicher (b) Veränderungen erweist sich eine Sperrklausel in Höhe von 5 Prozent als zulässig.
(a) Die rechtlichen Veränderungen führen nicht dazu, dass eine Sperrklausel nur in geringerer Höhe als 5 Prozent gerechtfertigt wäre. Für die Bildung einer Fraktion im Deutschen Bundestag sind mindestens 5 Prozent der Mitglieder des Deutschen Bundestages erforderlich (§ 10 Abs. 1 Satz 1 GO-BT ), d.h. bei einer Größe des Parlaments von 630 Abgeordneten (§ 1 Abs. 1 Satz 1 BWahlG) 31 Mitglieder. Die Voraussetzung für die Bildung einer Fraktion knüpft damit an die Sperrklausel von 5 Prozent der Zweitstimmen an. Vor dem Hintergrund der bestehenden Organisationsstruktur des Bundestages mit derzeit 26 Fachausschüssen, in denen die Fraktionen entsprechend ihrer Stärke vertreten sind, stellt dies eine nachvollziehbare Größenordnung dar.
Zwar entfaltet die Sperrklausel durch die Einführung des Zweitstimmendeckungsverfahrens auch Wirkungen auf die Erststimmenwahl. Erreichen Parteien bundesweit weniger als 5 Prozent der gültigen Zweitstimmen, erhalten die von ihnen vorgeschlagenen, in ihrem Wahlkreis erfolgreichen Wahlkreisbewerber kein Bundestagsmandat. Aus diesen neuen, weitergehenden Wirkungen der Sperrklausel ergeben sich jedoch keine Gesichtspunkte für eine andere Beurteilung ihrer Höhe. Der Einzug lediglich einzelner Abgeordneter einer Partei, die als Wahlkreisbewerber erfolgreich waren, brächte noch keine der Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Bundestages genügende Gruppe von Abgeordneten einer Partei hervor. Vielmehr könnten danach sehr kleine, unter Umständen nur aus einem Abgeordneten bestehende "Parteisplitter" im Bundestag vertreten sein. Im Übrigen würde eine Absenkung der Sperrklausel diese Wirkung auf Wahlkreisbewerber nicht verhindern.
(b) Tatsächliche Veränderungen des Wahlverhaltens führen ebenfalls nicht zu einer anderen Bewertung der Sperrklausel. Die Rechtfertigung einer Sperrklausel mit dem Ziel, die Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Parlaments zu sichern, ist grundsätzlich unabhängig davon, wie viele Zweitstimmen aufgrund der Sperrklausel bei der Sitzverteilung insgesamt unberücksichtigt bleiben (vgl. BVerfGE 146, 327 <354 f. Rn. 70>). Eine andere verfassungsrechtliche Beurteilung könnte möglicherweise dann geboten sein, wenn der sperrklauselbedingte Ausfall an Stimmen einen Umfang erreichte, der die Integrationsfunktion der Wahl beeinträchtigen würde (vgl. BVerfGE 146, 327 <355 Rn. 71> m.w.N.). Derartige Veränderungen des Wahlverhaltens bei Bundestagswahlen können derzeit für die erforderliche wertende Prognoseentscheidung (vgl. BVerfGE 146, 327 <358 Rn. 78>) nicht verlässlich festgestellt werden.
d) Unter den gegenwärtigen tatsächlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ist die Ausgestaltung der Sperrklausel in § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG jedoch nicht in vollem Umfang erforderlich. Zur Sicherstellung der Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Bundestages ist es nicht notwendig, eine Partei bei der Sitzverteilung unberücksichtigt zu lassen, deren Abgeordnete im Fall ihrer Berücksichtigung eine gemeinsame Fraktion mit den Abgeordneten einer anderen Partei bilden würden, wenn beide Parteien gemeinsam das Fünf-Prozent-Quorum erreichen würden.
Eine solche Möglichkeit besteht nicht nur abstrakt, sondern tatsächlich im Fall des Antragstellers zu III. (aa). Sie lässt sich mit drei Elementen beschreiben (bb). Werden in einem solchen Fall die Zweitstimmenergebnisse dieser Parteien bei dem Erfordernis des § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG gemeinsam berücksichtigt, stellt dies ein ebenso geeignetes milderes Mittel dar (cc).
aa) Tatsächlich besteht die Möglichkeit, dass der Antragsteller zu III. bei der Wahl nach dem Bundeswahlgesetz 2023 bei der Sitzverteilung mangels Überschreitens der bundesweiten Fünf-Prozent-Sperrklausel nicht berücksichtigt wird (1). Im Fall seiner Berücksichtigung würden seine Abgeordneten jedoch hinreichend sicher eine gemeinsame Fraktion mit den Abgeordneten der Beigetretenen bilden (2).
(1) Der Antragsteller zu III. ist eine Landespartei gemäß § 6 Abs. 4 PartG. Seine Organisation beschränkt sich auf das Gebiet des Freistaats Bayern. Er nimmt jedoch an Bundestagswahlen teil. Bei der letzten Bundestagswahl 2021 erzielte er 5,2 % der Zweitstimmen im Bundesgebiet; dies entsprach einem Zweitstimmenanteil von 31,7 % in Bayern.
(2) Nachdem der Antragsteller zu III. bei der ersten Bundestagswahl im Jahr 1949 29,2 % und im Jahr 1953 47,8 % der Zweitstimmen in Bayern erreicht hatte, betrug sein Zweitstimmenanteil von 1957 bis 1994 dort jeweils über 50 Prozent. Zwischen 1998 und 2013 errang er bei Bundestagswahlen nur noch im Jahr 2002 mehr als die Hälfte der Zweitstimmen in Bayern. In den anderen Jahren lagen seine Ergebnisse zwischen 40 und 50 Prozent. Bei den letzten beiden Bundestagswahlen sank sein Stimmenanteil in Bayern auf 38,8 % im Jahr 2017 und 31,7 % im Jahr 2021 ab (vgl. Bundeswahlleiter, Ergebnisse früherer Bundestagswahlen, 2022, S. 16, 18).
Da seit 2017 weitere Parteien in den Bundestag eingezogen sind, ist die Annahme nachvollziehbar, dass sich die Ergebnisse des Antragstellers zu III. auch bei der nächsten Bundestagswahl im Rahmen dieser letzten beiden Wahlen bewegen. Dies schließt ein Ergebnis von bundesweit weniger als 5 Prozent jedenfalls nicht sicher aus.
Der Antragsteller zu III. und die Beigetretene machen seit dem Bestehen der Bundesrepublik Deutschland im Wahlkampf deutlich, dass sie eine gemeinsame Fraktion bilden wollen. Insbesondere wirbt der Antragsteller zu III. regelmäßig für den Spitzenkandidaten oder die Spitzenkandidatin der Beigetretenen, während bei bisher zwei Bundestagswahlen die Beigetretene auf einen eigenen Spitzenkandidaten verzichtete und für denjenigen des Antragstellers zu III. warb. Seit 1976 stellen beide Parteien ausdrücklich ein gemeinsames Wahlprogramm für die Bundestagswahlen auf.
Die Abgeordneten des Antragstellers zu III. bilden seit 1949 im Bundestag eine gemeinsame Fraktion mit den Abgeordneten der Beigetretenen. Sie verfolgen gleichgerichtete politische Ziele.
Grundlage hierfür ist eine auf Dauer angelegte Kooperation der beiden Parteien. Nach dem Statut der Beigetretenen bildet sie mit dem Antragsteller zu III. eine Arbeitsgemeinschaft (vgl. § 49) und verschiedene gemeinsame Vereinigungen (vgl. § 38). Der jeweilige Vorsitzende der gemeinsamen Fraktion ist, soweit er der Beigetretenen angehört, Mitglied des Präsidiums der Beigetretenen (vgl. § 29 Abs. 2 Unterabsatz 4). Die Beigetretene verzichtet seit 1949 auf Parteistrukturen und eine Kandidatur in Bayern. Nach den Aufnahmerichtlinien des Antragstellers zu III. ist für Mitglieder aus einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland die gegebenenfalls gleichzeitige Mitgliedschaft im zuständigen Verband der Beigetretenen erwünscht und führt zu besonderen Regelungen der Mitgliedschaftsrechte (§ 6 Abs. 7 der Satzung des Antragstellers zu III.).
bb) Die Kooperation des Antragstellers zu III. mit der Beigetretenen zeichnet sich letztlich durch drei Elemente aus: erstens die Absicht, aufgrund gleichgerichteter politischer Ziele eine Fraktion zu bilden, zweitens den Umstand, dass schon bisher eben eine solche gemeinsame Fraktion im Bundestag bestand, und drittens den Verzicht auf Wettbewerb untereinander, indem Landeslisten nur in unterschiedlichen Ländern eingereicht werden.
cc) Das Ziel der Sperrklausel wird in gleicher Weise erreicht, wenn bei dem Erfordernis des § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG die Zweitstimmenergebnisse von Parteien, die in dieser Form kooperieren, gemeinsam berücksichtigt werden (1). Darin liegende Ungleichbehandlungen sind gerechtfertigt (2).
(1) Eine solche Kooperation verändert die Rahmenbedingungen der parlamentarischen Arbeit, auf deren Sicherung die Sperrklausel abzielt, nicht. Ihr Ziel ist eine Fraktionsgemeinschaft. Damit geht sie über ein reines Wahlbündnis hinaus, das lediglich erreichen will, dass beide Parteien im Parlament vertreten sind. Auch bezieht sie sich im Unterschied zu einer Koalitionsaussage nicht lediglich auf eine Zusammenarbeit im Fall der Regierungsübernahme, sondern gilt auch für den Fall der Opposition. Die Kooperation betrifft also unmittelbar die Tätigkeit im Bundestag selbst und umfasst sämtliche Parlamentsfunktionen, nicht nur die Wahl und fortlaufende Unterstützung einer Bundesregierung. Durch die Bildung einer gemeinsamen Fraktion ordnen sich die Abgeordneten der beteiligten Parteien den parlamentarischen Organisationsstrukturen unter, indem sie nicht einzeln, sondern nur gemeinsam die Rechte und Pflichten einer Fraktion wahrnehmen. Dies bezweckt, gemeinsam gleichgerichtete politische Ziele zu verfolgen und eine politische Strömung im Parlament zu repräsentieren.
(2) Werden Parteien, die in dieser Form kooperieren, bei der Anwendung der Sperrklausel des § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG gemeinsam berücksichtigt, stellt dies in mehrfacher Hinsicht eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Parteien dar (a). Diese ist aber jedenfalls dann gerechtfertigt, wenn sie auf Parteien beschränkt ist, die alle drei Voraussetzungen (vgl. oben Rn. 258) erfüllen (b).
(a) Werden Parteien, die eine gemeinsame Fraktion beabsichtigen, bei der Anwendung der Sperrklausel gemeinsam berücksichtigt, bedeutet dies eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Parteien. Die kooperierenden Parteien erhalten auch dann Bundestagsmandate, wenn jede für sich die Voraussetzung des § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG nicht erfüllt. Wahlstimmen, die für eine der kooperierenden Parteien abgegeben werden, kommt ein Erfolgswert mit Blick auf beide Parteien zu, während Wahlstimmen, die für eine Partei ohne Kooperationspartner abgegeben werden, einen Erfolgswert nur im Rahmen des Erfolgs dieser Partei haben.
Ist die gemeinsame Berücksichtigung bei Anwendung der Sperrklausel zudem auf solche Parteien beschränkt, die bereits eine gemeinsame Fraktion im Bundestag bilden, liegt darin eine weitere Ungleichbehandlung gegenüber Parteien, die dies lediglich in Zukunft beabsichtigen. Insbesondere wenn Parteien noch nicht im Bundestag vertreten sind, können sie diese Voraussetzung nicht erfüllen.
Schließlich stellt die gemeinsame Berücksichtigung von Parteien, die in keinem Land zueinander in Wettbewerb stehen, eine weitere Ungleichbehandlung dar. Sie besteht gegenüber anderen Parteien, die bei der Bundestagswahl konkurrierende Wahlvorschläge einreichen.
(b) Es kann offen bleiben, inwieweit die gemeinsame Berücksichtigung von Parteien bei der Überwindung der Sperrklausel angesichts ihres Umgehungspotentials (aa) gerechtfertigt ist, wenn lediglich einzelne der drei Voraussetzungen vorliegen (bb). Jedenfalls ist sie gerechtfertigt, wenn die Kooperation in der Form erfolgt, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind (cc).
(aa) Die gemeinsame Berücksichtigung von Parteien bei der Überwindung der Sperrklausel kommt der Verbindung ihrer Listen gleich. Diese kann eine Umgehung der Sperrklausel darstellen, weshalb ihr Verbot gerechtfertigt ist (vgl. BVerfGE 5, 77 <84>). Da die Durchbrechung der gleichmäßigen Wirkung der Sperrklausel gegen die Wahlgleichheit verstoßen kann, hielt der Senat für die übergangsweise vorgesehene Möglichkeit der Listenverbindung bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl 1990 fest, dass die Listenverbindung den in der Wahlgleichheit angelegten Verfassungssatz, wonach das Hindernis einer Sperrklausel für alle Listenwahlvorschläge in gleicher Weise gelten soll, durchbricht (vgl. BVerfGE 82, 322 <347>). Dem Begriff der Listenverbindung liegt dabei die Übergangsregelung des § 53 Abs. 2 BWahlG 1990 zugrunde. Sie war konkret zur Überwindung der bundesweiten Fünf-Prozent-Hürde in der besonderen historischen Situation konzipiert und sollte ermöglichen, "dass Parteien, die in einem der beiden deutschen Staaten gebildet worden sind und sich noch nicht durch Zusammenschluss mit einer Partei im anderen Staat die organisatorische Basis für die gesamtdeutsche Wahl geschaffen haben, Listenverbindungen eingehen und damit das Gesamtgewicht der für sie abgegebenen Zweitstimmen in der Wahl zur Wirkung bringen" (BTDrucks 11/7624, S. 13). Auch ohne Konkurrenzklausel hätte diese Listenverbindung lediglich das Ziel verfolgt, die Wirkung von Sperrklauseln unterschiedlich zu gestalten. Hierfür kam kein rechtfertigender Grund in Betracht (vgl. BVerfGE 82, 322 <346>).
Dies schließt jedoch die gemeinsame Berücksichtigung von Listen in anderen Konstellationen nicht von vornherein aus. Wie die Sperrklausel selbst sind auch ihre Ausnahmen nicht anhand abstrakter Fallgestaltungen, sondern unter Berücksichtigung der politischen Wirklichkeit zu beurteilen (vgl. oben Rn. 244).
Die bundesweite Sperrklausel findet gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG ohnehin nicht auf die Wahlvorschläge der einzelnen Landeslisten Anwendung, sondern auf eine Partei und damit auf ihre Listenwahlvorschläge insgesamt. Dies entspricht der früheren Rechtslage. Denn bis 2011 galten nach § 7Abs. 1 und 2 BWahlG Listenwahlvorschläge einer Partei als verbunden. Auch das Europawahlgesetz , das bis 2014 eine Sperrklausel vorsah (vgl. BVerfGE 135, 259 <264 ff., 272>), erlaubt diese Form der Listenverbindung (vgl. § 2 Abs. 2 Sätze 2 und 3, Abs. 6 EuWG ). Ebenfalls haftete Listenvereinigungen, die das Wahlrecht der Deutschen Demokratischen Republik kannte, kein Verstoß gegen die Wahlgleichheit an, weil sie keine bloßen Zählgemeinschaften zur Überwindung der Sperrklausel bildeten, sondern eine verfestigte Form des Zusammenwirkens voraussetzten (vgl. BVerfGE 82, 322 <346>; vgl. daraufhin BTDrucks 11/8023, S. 4 zur Einführung von § 53 Abs. 2 BWahlG 1990).
(bb) Bereits die Absicht zweier Parteien, aufgrund gleichgerichteter politischer Ziele eine Fraktion zu bilden, geht über eine bloße Zählgemeinschaft hinaus. Sie ist nicht lediglich darauf gerichtet, die Wirkung der Sperrklausel zu überwinden, sondern auf die gemeinsame parlamentarische Arbeit im Bundestag. Eine gemeinsame Fraktion verändert dessen Arbeits- und Funktionsbedingungen nicht. Allerdings besteht das Risiko, dass sich eine im Wahlkampf geäußerte Absicht nicht realisiert, da die Bildung einer Fraktion den Abgeordneten im Bundestag vorbehalten bleibt.
Vor diesem Hintergrund liegt ein sachlicher Differenzierungsgrund auch in dem Abstellen darauf, dass die Abgeordneten zweier Parteien bereits eine gemeinsame Fraktion bilden. Das Zusammenwirken der Parteien hat sich dann in der parlamentarischen Praxis bereits verfestigt. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich nach der Wahl die gemeinsame Fraktionsbildung erneut realisiert und die Abgeordneten dieser Parteien nicht in kleine Gruppen zerfallen. Auch Wählerinnen und Wählern bietet diese Anforderung eine transparentere Grundlage dafür, dass ihre Stimmabgabe einer gemeinsamen Politik der kooperierenden Parteien und nicht lediglich der Überwindung der Sperrklausel dient.
Ein weiterer sachlicher Differenzierungsgrund liegt darin, die gemeinsame Berücksichtigung von Listen mehrerer Parteien davon abhängig zu machen, dass die Parteien nicht zueinander in Wettbewerb treten. Dies fördert die für einen Fraktionszusammenschluss notwendige Kooperationsbereitschaft (vgl. auch § 10 Abs. 1 Satz 1 GO-BT ). Eine solche Gestaltungsmöglichkeit bietet das Bundestagswahlrecht dadurch, dass die Zweitstimmenwahl nach Landeslisten erfolgt. Dadurch können Parteien ihre Betätigung auf einzelne Länder beschränken. Für Landesparteien sieht § 6 Abs. 4 PartG dies ausdrücklich vor. Aber auch andere Parteien können sich als Ausdruck ihrer Parteienfreiheit gemäß Art. 21 Abs. 1 GG auf einzelne Länder konzentrieren (vgl. Schwerdtfeger, NVwZ 2017, S. 841 <843>).
(cc) Es kann offenbleiben, ob diese Gründe nur tragen, wenn sie kumulativ vorliegen. Jedenfalls gemeinsam rechtfertigen sie unter den gegenwärtigen rechtlichen und tatsächlichen Bedingungen die Bevorzugung einer Kooperation, wie der Antragsteller zu III. und die Beigetretene sie praktizieren.
e) Der Gesetzgeber ist zwar verpflichtet, die Sperrklausel des § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG so auszugestalten, dass sie unter den derzeitigen rechtlichen und tatsächlichen Bedingungen nicht über das zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Bundestages Erforderliche hinausgeht. Da er innerhalb der Grenze, die ihm nach ständiger Rechtsprechung mit dem Fünf-Prozent-Quorum für das Wahlgebiet gezogen ist, grundsätzlich frei ist, auf die Sperrklausel zu verzichten, deren Höhe herabzusetzen oder andere geeignete Möglichkeit zu ergreifen (vgl. BVerfGE 146, 327 <358 Rn. 79> m.w.N.), ist er aber nicht auf die Einführung einer Möglichkeit der gemeinsamen Berücksichtigung zweier, in der dargestellten Form kooperierender Parteien beschränkt. Vielmehr kann er die Sperrklausel auch in anderer Weise modifizieren, um unter den derzeitigen rechtlichen und tatsächlichen Bedingungen sicherzustellen, dass Parteien bei der Sitzverteilung berücksichtigt werden, die - wie der Antragsteller zu III. - von dem Fehlen einer gemeinsamen Berücksichtigungsmöglichkeit betroffen sind. Zwar könnten durch andere Ausgestaltungen der Sperrklausel womöglich Parteien auch mit weniger Abgeordneten im Bundestag vertreten sein, so dass das legitime Ziel, die Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Bundestages zu sichern, nicht in gleichem Umfang erreicht würde wie mit einer ausnahmslosen bundesweiten Fünf-Prozent-Sperrklausel. Wählt der Gesetzgeber eine solche Modifikation, prüft das Bundesverfassungsgericht nur, ob die mit der Regelung hervorgerufenen Ungleichbehandlungen gerechtfertigt sind, nicht aber, ob er zweckmäßige oder rechtspolitisch erwünschte Lösungen gefunden hat (vgl. BVerfGE 146, 327 <352 Rn. 63> m.w.N.). Andere mögliche Gestaltungsvarianten des § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG sind insbesondere Veränderungen der Sperrklausel selbst (aa) oder eine Regelung, nach der die Überwindung einer alternativen Hürde ebenfalls den Zugang zum Sitzverteilungsverfahren ermöglicht (bb).
aa) Zunächst könnte der Gesetzgeber die Sperrklausel selbst verändern. Zwar könnten regionalisierte oder landesbezogene Sperrklauseln geeignet sein, der Situation, die die Unvereinbarkeit der gegenwärtigen Sperrklausel mit der Wahlgleichheit begründet, Rechnung zu tragen. Jedoch fehlen bislang belastbare Konzepte. Soweit die Beschwerdeführenden zu VI. auf die landesbezogene Sperrklausel der ersten Bundestagswahl 1949 verweisen, die unter gänzlich anderen rechtlichen und tatsächlichen Bedingungen erfolgte, führt dies mit Blick auf eine derzeit mögliche Ausgestaltung allerdings nicht weiter. Der Hinweis der Antragstellerin zu I. auf die Möglichkeit einer regionalisierten Sperrklausel bleibt ebenso unspezifisch wie die Ausführungen des Antragstellers zu III. zu seinem Hilfsantrag. Demgegenüber werden in der öffentlichen Diskussion neben einer Absenkung der Sperrklausel, die bei den gegenwärtigen Verhältnissen den dargestellten Effekt auf in der beschriebenen Weise miteinander kooperierende Parteien nicht mehr erwarten ließe, auch andere konkrete Vorschläge erörtert (vgl. Wawzyniak, Verfassungsblog vom 7. November 2023), die der Gesetzgeber zum Ausgangspunkt seiner Befassung machen könnte.
bb) Der Gesetzgeber kann die Sperrklausel auch abmildern, indem er eine alternative Hürde schafft, deren Überwindung den Zugang zum Sitzzuteilungsverfahren eröffnet (vgl. BVerfGE 95, 408 <419>). Eine solche Möglichkeit sah der Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen mit der Wahlkreisklausel - vergleichbar mit der vorher geltenden Grundmandatsklausel - vor (vgl. BTDrucks 20/5370, S. 6). Ähnlich wie bereits nach der Wiedervereinigung (vgl. BVerfGE 95, 408 <416, 425>), wurde auch eine Anhebung dieser Klausel von drei auf fünf gewonnene Wahlkreise erörtert (vgl. Beschlussantrag der Fraktion der CDU/CSU, BTDrucks 20/5353, S. 2).
Mit der Eröffnung einer solchen weiteren Zugangsmöglichkeit zum Sitzzuteilungsverfahren wird die Sicherung der Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Bundestages zwar nicht in gleicher, wohl aber in nicht wesentlich weniger wirksamer Weise erreicht wie mit einer Sperrklausel ohne Alternative (1). Wie der Senat wiederholt entschieden hat (vgl. BVerfGE 6, 84 <94 ff.>; 95, 408 <419 f.>), bedürfen die mit der Alternative verbundenen Ungleichbehandlungen ihrerseits einer eigenen Rechtfertigung (2).
(1) Da bei einer solchen Wahlkreisklausel Parteien bei der Sitzzuteilung unabhängig davon berücksichtigt werden, ob ihre Abgeordneten im Parlament mit den Abgeordneten einer anderen Partei zusammen eine Fraktion bilden, ist sie weniger geeignet, die Rahmenbedingungen für die Funktionsfähigkeit des Bundestages zu sichern, als eine bundesweite Sperrklausel. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund eines veränderten Wahlverhaltens (vgl. BTDrucks 20/5370, S. 2, 10). Dennoch bleibt nach den bisherigen Erfahrungen ein solcher Zugangsweg mit drei gewonnenen Wahlkreisen nicht wesentlich hinter den Wirkungen einer Sperrklausel von 5 Prozent zurück. Von der ersten und zweiten Bundestagswahl sowie der ersten gesamtdeutschen Wahl abgesehen, profitierte lediglich die Antragstellerin zu IV. von der Grundmandatsklausel. Dabei erreichte sie aufgrund ihres Zweitstimmenergebnisses 1994 mit 30 Abgeordneten 4,57 % der gesetzlichen Mitgliederzahl des Bundestages beziehungsweise, aufgrund von insgesamt 16 Überhangmandaten der CDU und der SPD, 4,46 % der tatsächlichen Mitgliederzahl. 2021 erreichte sie bei einem Zweitstimmenergebnis von 4,9 % mit 5 Prozent der Abgeordneten sogar Fraktionsstärke.
(2) Die Ungleichbehandlung durch eine solche Wahlkreisklausel wäre, vergleichbar zur bisherigen Grundmandatsklausel (a), unter den gegenwärtigen rechtlichen und tatsächlichen Bedingungen gerechtfertigt (b).
(a) Die bisherige Grundmandatsklausel hat das Bundesverfassungsgericht bereits 1957 sowie erneut im Jahr 1997 als gerechtfertigt angesehen (vgl. BVerfGE 6, 84 <95 f.>; 95, 408 <421 ff.>). Nicht nur die Ungleichbehandlung der Zweitstimmen, sondern auch die doppelte Einflussmöglichkeit auf die politische Zusammensetzung des Bundestages ist gerechtfertigt, weil für die Bevorzugung einer Partei mit drei erfolgreichen Wahlkreisbewerbern ein hinreichender Grund besteht.
Entgegen der Annahme der Antragstellerin zu I. beruhte die Grundmandatsklausel zwar nicht auf einer verfassungsrechtlichen Verpflichtung, regionalen Schwerpunktparteien einen Zugang zum Sitzzuteilungsverfahren zu ermöglichen (vgl. oben Rn. 222 f.). Ihr durch die gesetzgeberische Ausgestaltung gegebener Zweck (vgl. BVerfGE 4, 31 <40 f.>) bestand jedenfalls nicht allein darin, Parteien mit regionalen Schwerpunkten zu bevorzugen. Die Wahlkreise, in denen eine Partei erfolgreich war, mussten nicht regional verbunden sein (vgl. BVerfGE 95, 408 <424 f.>). Zudem bestand konzeptionell kein Zusammenhang zwischen der regionalen Stärke einer Partei und der Sitzverteilung nach dem Zweitstimmenergebnis. Denn die Bedeutung einer Partei mit regionalem Schwerpunkt war gerade durch die Anzahl ihrer Wahlkreismandate bereits konsequent repräsentiert (vgl. Meyer, Wahlsystem und Verfassungsordnung, 1973, S. 237). Der Berücksichtigung des Zweitstimmenergebnisses bedurfte es dafür nicht.
Der Senat hat daher die Grundmandatsklausel auf die Grundstruktur des Wahlrechts selbst zurückgeführt (vgl. BVerfGE 6, 84 <96>). Die Entscheidung des Gesetzgebers, Parteien mit drei Direktmandaten für parlamentswürdig zu halten, sei nicht nur darauf gestützt, dass sie sich in lokalen Schwerpunkten als politisch bedeutsam erwiesen hätten, sondern darauf, dass sie damit zugleich in besonderer Weise dem Anliegen der personalisierten Verhältniswahl entsprochen hätten. Die verfassungsrechtlich maßgebliche Rechtfertigung beruhe auf den "Grundlagen des eigenartig gestalteten Wahlsystems" (BVerfGE 6, 84<96>). Später hat der Senat weiter präzisiert, der Gesetzgeber dürfe die besondere politische Kraft einer Partei sowohl aus dem Zweitstimmenergebnis als auch aus dem Ausmaß ihres Erfolgs in der Mehrheitswahl ableiten (vgl. BVerfGE 95, 408 <422 f.>). In der Wahl eines Wahlkreiskandidaten drücke sich in aller Regel zugleich auch das Ausmaß der Billigung der politischen Anliegen der Partei aus, die ihn nominiert habe. Aus diesem Grund dürfe der Gesetzgeber in dem sich bereits in Parlamentssitzen niederschlagenden Erfolg ein Indiz dafür sehen, dass diese Partei besondere Anliegen aufgegriffen habe, die eine Repräsentanz im Parlament rechtfertigten.
(b) Diese Begründung behält unter den gegenwärtigen rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen ihre Berechtigung und fügt sich ebenso in die Konzeption des Zweitstimmendeckungsverfahrens ein. Die "eigenartige" Ausgestaltung der Wahl (vgl. BVerfGE 6, 84<96>) als Zweistimmenwahl führt dazu, dass die Parteien den Wählerinnen und Wählern zwei unterschiedliche Wahlvorschläge machen, eine Person und eine Liste. Das Zweitstimmendeckungsverfahren führt die Ergebnisse beider Wahlvorgänge zusammen. Nach der Gesetzesbegründung führt dies "der Wahlkreisrepräsentation [...] neue Legitimation zu", indem jedes Wahlkreismandat von Zweitstimmen gedeckt ist (vgl. BTDrucks 20/5370, S. 10). Dies gilt ebenso umgekehrt. Die Wahlkreiswahl verstärkt die Legitimation der Listenwahl, indem sie bei der Sitzvergabe an den Anfang der Liste die erfolgreichen Wahlkreisbewerber setzt (vgl. oben Rn. 186). Deshalb gilt weiterhin, dass der Gesetzgeber die besondere politische Kraft einer Partei sowohl aus dem Zweitstimmenergebnis als auch aus dem Ausmaß ihres Erfolgs in der Mehrheitswahl ableiten darf (vgl. BVerfGE 95, 408 <422>). In der Wahl eines Wahlkreiskandidaten drückt sich in aller Regel zugleich auch das Ausmaß der Billigung der politischen Anliegen seiner Partei aus (vgl. BVerfGE 95, 408 <422>). Den mehrfachen Erfolg der Wahlkreisbewerber einer Partei, der sich zwar wegen der Sperrklausel zusammen mit dem Zweitstimmendeckungsverfahren nicht direkt in einem Mandat niederschlägt, aber von dem Willen der Wählerinnen und Wähler getragen ist, dass der Bewerber ein Mandat erhalten soll, darf der Gesetzgeber nach wie vor als Indiz dafür sehen, dass diese Partei besondere Anliegen aufgegriffen hat, die eine Repräsentanz im Parlament rechtfertigen (vgl. BVerfGE 95, 408 <422 f.>).
D.
Nach diesen Maßgaben sind auch die Verfassungsbeschwerden zu VI. und VII. - soweit sie zulässig sind - begründet. § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG verletzt den Grundsatz der Wahlgleichheit und damit das grundrechtsgleiche Recht der Beschwerdeführenden aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG.
E.
Auch der Organklageantrag des Antragstellers zu III. ist begründet, der Organklageantrag der Antragstellerin zu IV. hingegen unbegründet.
I.
Der Beschluss des Antragsgegners am 17. März 2023, mit dem er das Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes 2023 angenommen hat, verletzt lediglich den Antragsteller zu III. in seinem Recht auf Chancengleichheit (vgl. oben Rn. 117 f.). Die Bedingungen, unter denen die Sperrklausel über das zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Parlaments Erforderliche hinausgeht, treffen auf den Antragsteller zu III. zu. Sie verletzen daher nicht nur die Wahlgleichheit aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG , sondern auch den Antragsteller zu III. in seinem Recht aus Art. 21 Abs. 1 GG.
II.
Die Antragstellerin zu IV. erfüllt diese Bedingungen hingegen nicht. Ihre Abgeordneten bilden keine gemeinsame Fraktion mit denen einer anderen Partei. Es ist auch nicht erkennbar, dass sie eine solche beabsichtigt und hierfür eine Kooperation mit einer anderen Partei eingeht, zu der sie nicht in Wettbewerb steht. Sie wird deshalb durch den festgestellten Verfassungsverstoß nicht in ihren eigenen Rechten verletzt.
F.
I.
Die Normenkontrollanträge und die Verfassungsbeschwerden führen zur Feststellung, dass § 1 Abs. 3 und § 6 Abs. 1 und Abs. 4 Sätze 1 und 2 BWahlG mit dem Grundgesetz vereinbar, § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2BWahlG mit dem Grundgesetz unvereinbar sind. Der Verstoß einer Norm gegen das Grundgesetz hat entweder ihre Nichtigerklärung (§ 78 Satz 1 und § 95 Abs. 3 Satz 1 BVerfGG ) zur Folge, oder das Bundesverfassungsgericht stellt, gleich bedeutend, die Unvereinbarkeit der Norm mit dem Grundgesetzfest (vgl. § 31 Abs. 2 , § 79 Abs. 1 BVerfGG ). Hier ist die Unvereinbarkeit auszusprechen, weil dem Gesetzgeber mehrere Möglichkeiten zur Verfügung stehen, den festgestellten Verstoß gegen Art. 38 Abs. 1 Satz 1 GG und Art. 21 Abs. 1 GG zu beseitigen.
II.
Die Unvereinbarkeitserklärung ist mit einer Anordnung der Fortgeltung des § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG zu verbinden. Zusätzlich wird angeordnet, dass bis zu einer Neuregelung § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG mit der Maßgabe anzuwenden ist, dass bei der Sitzverteilung Parteien, die weniger als 5 Prozent der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben, nur dann nicht berücksichtigt werden, wenn sie in weniger als drei Wahlkreisen die meisten Erststimmen errungen haben.
1. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Gesetzgeber eine den vorstehenden Maßgaben entsprechende Modifikation des § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG nicht rechtzeitig vor der Wahl des nächsten Deutschen Bundestages vornimmt.
Zwar dürfte er eine solche Regelung angesichts der vorausgehenden Reformdiskussionen ohne umfangreiche Vorarbeiten entwickeln und beschließen können. Da gemäß Art. 39 Abs. 1 Satz 3 GG die Neuwahl zwischen dem 27. August 2025 und dem 26. Oktober 2025 stattfinden muss, steht dem Gesetzgeber jedoch nur ein kurzer Zeitraum zur Verfügung, wenn er die nach den Leitlinien des Verhaltenskodex für Wahlen der Venedig-Kommission (Verhaltenskodex für Wahlen - Leitlinien und erläuternder Bericht -, CDL-AD (2002) 23rev2-cor) maßgebliche Jahresfrist beachtet.
2. Im Fall einer nicht rechtzeitigen gesetzlichen Neuregelung der grundsätzlich verfassungskonformen Sperrklausel in Höhe von 5 Prozent der gültigen Zweitstimmen bestünde ohne eine Anordnung der Fortgeltung des § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BWahlG die Gefahr, dass im 21. Deutschen Bundestag zahlreiche Parteien mit nur wenigen Abgeordneten vertreten wären. Dies könnte nach der vom Bundesverfassungsgericht nicht zu beanstandenden Einschätzung des Gesetzgebers die Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Parlaments gefährden (vgl. BVerfGE 73, 40 <101 f.>; 95, 193 <218 f.>). Um zugleich der Gefährdung der Integrationsfunktion der Wahl vorzubeugen, ist der Rückgriff auf die Wahlkreisklausel des Gesetzentwurfs (BTDrucks 20/5370, S. 6) sachgerecht. Sie ist den Parteien und Wählerinnen und Wählern bekannt. Da bei der kommenden Wahl erstmals das Zweitstimmendeckungsverfahren zum Zuge kommt, stärkt dies das Vertrauen darauf, dass die Wahlrechtsreform keine Partei benachteiligt.
G.
Die Auslagenentscheidung in Bezug auf die Beschwerdeführenden zu VI. und VII. beruht auf § 34a Abs. 2und Abs. 3 BVerfGG. Die von den Antragstellerinnen zu IV. und V. beantragte Auslagenerstattung nach § 34a Abs. 3 BVerfGG scheidet hier mangels Erfolgs ihrer Anträge im Organklageverfahren aus.
H.
Die Entscheidung ist zu C.II.3. und E.II. mit 7: 1 Stimmen, im Übrigen einstimmig ergangen.
I. Hintergrund und Kernaussagen des Urteils
Das BVerfG hatte zwei Kernfragen zu beantworten:
-
Das Zweitstimmendeckungsverfahren: Hierbei handelt es sich um eine Neuerung, die Mandate erfolgreicher Wahlkreisbewerber nur dann zuteilt, wenn ihre Partei ein entsprechendes Sitzkontingent aus den Zweitstimmen erhalten hat. Das Verfahren wurde einstimmig als verfassungsgemäß anerkannt.
-
Die 5 %-Sperrklausel: Die bisherige Zugangshürde wurde in ihrer jetzigen Form als verfassungswidrig eingestuft, da sie unter den gegenwärtigen rechtlichen und tatsächlichen Bedingungen über das Ziel hinausgeht, die Funktionsfähigkeit des Bundestages zu sichern. Sie bleibt jedoch mit der Maßgabe in Kraft, dass kooperierende Parteien wie CDU und CSU gemeinsam die Sperrklausel überwinden können.
II. Bewertung des Urteils
1. Verfassungsmäßigkeit des Zweitstimmendeckungsverfahrens
Das Gericht stellt klar, dass das Zweitstimmendeckungsverfahren keine Abkehr von den Grundprinzipien des bisherigen Wahlrechts darstellt, sondern eine zulässige Weiterentwicklung im Rahmen der Verhältnismäßigkeitswahl ist. Es würdigt den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, der zwischen Verhältniswahl und Personenwahl einen neuen Ausgleich schaffen wollte. Das BVerfG betont dabei die verfassungsrechtliche Legitimität, da das Verfahren sowohl den Grundsatz der Wahlgleichheit (Art. 38 Abs. 1 GG) als auch die Chancengleichheit der Parteien (Art. 21 Abs. 1 GG) wahrt.
Kritikpunkt: Die Kritik von Oppositionsparteien und Wahlrechtswissenschaftlern, dass das Verfahren die Regionalrepräsentation schwächen könnte, wird zurückgewiesen. Das BVerfG argumentiert überzeugend, dass die Legitimation der Mandate primär über die Zweitstimmen erfolgt und die regionale Verankerung kein Verfassungsgrundsatz ist. Diese Argumentation ist juristisch stimmig, doch bleibt fraglich, ob das Verfahren politisch konsensfähig bleibt.
2. Verfassungswidrigkeit der 5 %-Sperrklausel
Die Entscheidung zur Sperrklausel zeigt das differenzierte Verständnis des Gerichts für die Wahlrechtsgrundsätze. Zwar wird die generelle Legitimität der Klausel zur Vermeidung einer Zersplitterung des Bundestages anerkannt, jedoch stellt das BVerfG fest, dass sie unter den derzeitigen Bedingungen nicht erforderlich ist, um das Ziel der Funktionsfähigkeit zu erreichen. Besonders die CSU, die in Bayern allein antritt und in einer Fraktion mit der CDU kooperiert, profitiert von der Maßgabe, dass kooperierende Parteien gemeinsam betrachtet werden können.
Kritikpunkt: Die Differenzierung, kooperierende Parteien zu privilegieren, könnte als Bevorzugung spezifischer politischer Konstellationen wahrgenommen werden. Kritiker sehen darin eine potenzielle Gefahr der Ungleichbehandlung anderer kleiner Parteien. Das BVerfG argumentiert jedoch, dass eine solche Kooperation, die auf dauerhafter Fraktionsbildung basiert, den spezifischen Anforderungen des Bundestages entspricht.
III. Was lernen wir aus dem Urteil?
-
Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers: Das Urteil betont, dass der Gesetzgeber im Rahmen der Grundsätze des Wahlrechts weitgehende Spielräume hat, neue Regelungen einzuführen. Gleichzeitig unterstreicht das Gericht die Notwendigkeit, diese Regelungen streng an den Grundsätzen der Wahlgleichheit und Chancengleichheit zu messen.
-
Flexibilität der Verfassungsinterpretation: Das BVerfG zeigt eine bemerkenswerte Flexibilität in der Interpretation der Anforderungen an Sperrklauseln. Die Maßgabe für kooperierende Parteien stellt eine pragmatische, wenn auch umstrittene Lösung dar.
-
Stärkung der Wahlrechtsgrundsätze: Durch die Feststellung der Verfassungswidrigkeit der bisherigen Sperrklausel betont das Gericht die Bedeutung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Parteienvielfalt und Parlamentsfunktionalität.
IV. Abweichende Meinungen und Problemkreise
-
Sperrklausel und Gleichbehandlung: Die Maßgabe zur privilegierten Behandlung kooperierender Parteien ruft kontroverse Diskussionen hervor. Einige sehen hierin eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes, während andere dies als notwendige Differenzierung betrachten.
-
Zweitstimmendeckungsverfahren: Kritiker monieren, dass das Verfahren kleinere Parteien mit starken Wahlkreiskandidaten benachteiligen könnte. Das BVerfG weist diese Kritik zurück, doch bleibt die politische Umsetzung dieser Neuerung fraglich.
-
Pragmatische Fortgeltung verfassungswidriger Regelungen: Die Fortgeltung der 5 %-Sperrklausel trotz festgestellter Verfassungswidrigkeit ist ein politisch und rechtlich sensibler Punkt, da sie die Wahlrechtsreform in der Praxis vorerst nicht vollständig wirksam macht.
V. Fazit
Das Urteil des BVerfG ist ein bedeutender Beitrag zur Fortentwicklung des Wahlrechts in Deutschland. Es bestätigt die grundlegende Legitimität des Zweitstimmendeckungsverfahrens und fordert gleichzeitig eine differenziertere Gestaltung der 5 %-Sperrklausel. Während die juristischen Argumente des Gerichts überzeugen, bleibt die politische Diskussion um die Umsetzung der Maßgaben und die Akzeptanz des neuen Wahlrechts offen.
Für die Praxis zeigt das Urteil, wie wichtig es ist, Wahlrechtsreformen nicht nur verfassungskonform, sondern auch konsensfähig zu gestalten. Es bietet wertvolle Orientierungspunkte für zukünftige Reformen und unterstreicht die Rolle des BVerfG als Hüter der verfassungsrechtlichen Grundsätze im demokratischen System.
moreResultsText



Annotations
(1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.
(2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat; wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt.
(3) Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz.