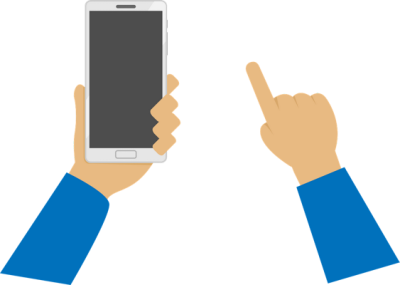Haftungsrecht: Schmerzensgeld wegen Fixierung ohne richterliche Genehmigung
Oberlandesgericht Frankfurt am Main Urteil, 16. Juli 2019 - 8 U 59/18
Das OLG Frankfurt a. M. - 4. Zivilkammer – hat mit Urteil vom 16.07.2019 – 8 U 59/18 – entschieden:
Tenor
Auf die Berufung der Klägerin wird das am 15. Januar 2018 verkündete Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main unter Zurückweisung der weitergehenden Berufung abgeändert.
Das beklagte Land wird verurteilt, an die Klägerin ein Schmerzensgeld in Höhe von € 12.000,00 zuzüglich Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 29. April 2017 zu zahlen. Es wird festgestellt, dass das beklagte Land verpflichtet ist, der Klägerin sämtliche ihr aus der Fixierung und Zwangsmedikation im A-Krankenhaus vom XX. April 2014 bis XX. Mai 2014 entstandenen materiellen und noch entstehenden materiellen und immateriellen Schäden zu ersetzen.
Das beklagte Land wird ferner verurteilt, an die Klägerin nicht anrechenbare vorgerichtliche Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von € 562,16 zu zahlen.
Im Übrigen bleibt die Klage abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits in beiden Rechtszügen hat das beklagte Land zu tragen.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Gründe
I.
Die Klägerin macht im Zusammenhang mit ihrer Einweisung und Behandlung in einer psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses im Rahmen einer Freiheitsentziehungsmaßnahme insbesondere Schmerzensgeld und die Feststellung der Einstandspflicht des beklagten Landes für materielle Schäden geltend.
Die Klägerin brachte am XX.XX.2014 einen Sohn als Frühgeburt zur Welt. Die häusliche Situation in der Folgezeit war sehr schwierig; es kam zu Konfliktsituationen und Streitigkeiten zwischen der Klägerin und ihrem Ehemann und in diesem Zusammenhang zu drei Polizeieinsätzen am XX.XX.2014.
Am XX. April 2014 ging ein Notruf des Ehemanns der Klägerin auf dem … Polizeirevier in Stadt1 ein. In diesem Notruf gab der Ehemann der Klägerin sinngemäß an, dass diese krankheitsbedingt in ihrer Wohnung gegenüber ihrer dort ebenfalls anwesenden Mutter tätlich zu werden drohe und die Situation von den Anwesenden nicht mehr zu bewältigen sei.
Daraufhin begaben sich eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter des … Polizeireviers zur Wohnung der Klägerin. Durch das Polizeirevier wurden zudem Rettungswagen und Notarzt verständigt.
Die Notärztin diagnostizierte eine „ausgeprägte Wochenbettpsychose“ und verabreichte der sehr erregten Klägerin 2,5 mg Dormicum nasal. Die vor Ort anwesenden Polizeibeamten nahmen eine akute Gefahrenprognose an und unterrichteten entsprechend den Polizeibeamten B auf dem … Polizeirevier, der die sofortige Ingewahrsamnahme der Klägerin anordnete .
Der Rettungsdienst erstellte ein Einsatzprotokoll und brachte die Klägerin gegen ihren Willen in das A-Krankenhaus, Abteilung Psychiatrie.
Dort befand sich die Klägerin im Zeitraum vom XX. April 2014 bis zum XX. Mai 2014. Die Klägerin wurde in diesem Klinikum teilweise fixiert und mit Medikamenten therapiert.
Am XX. April 2014 wurde in der Klinik ein psychiatrisches Gutachten erstellt, in dem es unter der Überschrift „Diagnose“ heißt: „Verdacht auf postpartale Psychose mit manischen Anteilen“. Unterzeichnet wurde dieses Gutachten von dem Chefarzt der Psychiatrie und Psychotherapie, C, der Assistenzärztin D und der Oberärztin E. Wegen der Einzelheiten des Gutachtens wird auf die als Anlage K 2 zu den Akten gereichte Kopie verwiesen.
Das Amtsgericht - Betreuungsgericht -‚ stellte mit Beschluss vom XX. April 2014 die Zulässigkeit der sofortigen Ingewahrsamnahme vom XX. April 2014 fest und ordnete die vorläufige Unterbringung der Klägerin in einer geschlossenen Einrichtung bis längstens XX. Mai 2014 an . Die dagegen eingelegte Beschwerde der Klägerin wies das Landgericht mit Beschluss vom XX. April 2014 zurück .
Die Klägerin hat behauptet, die Notärztin sei überfordert und unerfahren gewesen und habe demzufolge eine unzutreffende Diagnose gestellt. Sie - die Klägerin - sei bei dem Eintreffen der Notärztin und der Polizeibeamten lediglich erregt gewesen. Zu keinem Zeitpunkt habe eine Eigen- oder Fremdgefährdung vorgelegen. Die Maßnahmen der Polizeibeamten seien deshalb nicht angezeigt gewesen. Auch die Gabe des Mittels Dormicum sei nicht notwendig gewesen und habe sie - die Klägerin - in ihrer Bewusstseinslage extrem beeinträchtigt. Die falsche Diagnose der Notärztin sei von den Fachärzten in der Klinik übernommen worden. Die Behandlung in der Klinik mit zwangsweiser Verabreichung von Neuroleptika und zwangsweisem Abstillen sei nicht notwendig gewesen. Auch sei sie dort unter menschenunwürdigen Bedingungen am XX./XX. April 2014, vom XX. bis zum XX. April 2014 sowie vom XX. April bis XX. Mai 2014 fixiert worden. Zudem sei bei ihr dort am XX. April, am XX. April, am XX. April sowie am XX. Mai 2014 eine Zwangsmedikation erfolgt.
Die Klägerin hat erstinstanzlich beantragt,
1.das beklagte Land zu verurteilen, an sie ein angemessenes, der Höhe nach in das Ermessen des Gerichts gestelltes Schmerzensgeld zuzüglich Zinsen in Höhe von 5%-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen,
2.festzustellen, dass das beklagte Land verpflichtet ist, der Klägerin sämtliche ihr aus der ärztlichen Falschbehandlung im A-Krankenhaus vom XX. April 2014 bis XX. Mai 2014 entstandenen und noch entstehenden materiellen und immateriellen Schäden zu ersetzen und den für die Vergangenheit zu zahlenden Schaden mit 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Klageerhebung zu verzinsen, und
3.das beklagte Land zu verurteilen, an die Klägerin € 597,74 nicht an-rechenbare außergerichtliche Rechtsanwaltsgebühren zu zahlen.
Das beklagte Land und die Streithelferin haben erstinstanzlich jeweils beantragt,
die Klage abzuweisen.
Das beklagte Land hat behauptet, bei der Klägerin habe am XX. April 2014 eine akute Selbst- und Fremdgefährdung vorgelegen. Die Voraussetzungen für eine zwangsweise Unterbringung der Klägerin hätten vorgelegen.
Auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil wird ergänzend Bezug genommen .
Nach Vernehmung der Zeugen F, POK B und C hat das Landgericht die Klage mit dem angegriffenen Urteil vom 15. Januar 2018 abgewiesen.
Zur Begründung hat das Landgericht u. a. ausgeführt, die Klägerin habe keinen Anspruch aus § 839 Abs. 1 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG gegen das beklagte Land im Zusammenhang mit der freiheitsentziehenden Maßnahme.
Die sofortige Ingewahrsamnahme durch die Polizeibeamten des beklagten Landes sei nach § 10 des hessischen Gesetzes über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen - HFEG - rechtmäßig gewesen, weil die Voraussetzungen für eine Unterbringung der Klägerin nach § 1 Abs. 1 und Abs. 2 HFEG mit hoher Wahrscheinlichkeit vorgelegen hätten und Gefahr im Verzug bestanden habe.
Die Rechtmäßigkeit der Ingewahrsamnahme durch die Polizeibeamten des beklagten Landes ergebe sich bereits aus dem Beschluss des Amtsgerichts vom XX. April 2014 und dem Beschluss des Landgerichts vom XX. April 2014. Auch nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sei nicht festzustellen, dass die sofortige Ingewahrsamnahme durch die Polizeibeamten amtspflichtwidrig gewesen sei.
Auch „hinsichtlich der Entscheidungen des Amtsgerichts vom XX. April 2014 und des Landgerichts gemäß § 331 FamFG in Verbindung mit § 1 HFEG“ ergäben sich keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer gegenüber der Klägerin bestehenden Amtspflicht.
Soweit die Klägerin die Entscheidung der Notärztin beanstande, sei das beklagte Land bereits nicht passivlegitimiert.
Auch hinsichtlich „der beanstandeten Behandlung im Rahmen der Unterbringung einschließlich der beanstandeten Zwangsmedikation“ sei eine Haftung des beklagten Landes schon aus Rechtsgründen ausgeschlossen, „weil nach § 16 HFEG die vom Gericht angeordneten Unterbringungen durch die Verwaltungsbehörde“ durchgeführt würden und zuständige Verwaltungsbehörde nach den §§ 2 und 3 HFEG hier „der Gemeindevorstand der Stadt1“ sei, nicht aber das beklagte Land.
Hinsichtlich der näheren Einzelheiten der Entscheidungsgründe wird auf das Urteil des Landgerichts vom 15. Januar 2018 Bezug genommen.
Gegen dieses ihrem Prozessbevollmächtigten am 26. März 2018 zugestellte Urteil hat die Klägerin mit einem hier am 25. April 2018 eingegangenen Schriftsatz vom selben Tage Berufung eingelegt . Nach Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist bis zum 11. Juni 2018 hat die Klägerin sodann mit Anwaltsschriftsatz vom 8. Juni 2018, der hier per Fax am 11. Juni 2018 eingegangen ist , die Berufung begründet.
Mit der Berufung verfolgt die Klägerin ihre erstinstanzlichen Klageziele weiter.
Sie rügt u. a., das Landgericht habe verkannt, dass der Zeuge B als verantwortlicher Polizeibeamter nur eine vage Vorstellung von dem Geschehen vor Ort gehabt habe, da er „lediglich vom Hörensagen Angaben“ erhalten habe. Dies reiche nicht aus, um eine Unterbringung zu veranlassen. Für die Feststellung einer Eigen- und/oder Fremdgefährdung habe es keine Anhaltspunkte gegeben. Im Übrigen reiche eine nur allgemeine Unberechenbarkeit für eine Unterbringung allein nicht aus.
Der Zeuge C habe eine Fremdgefährdung für den 14-tägigen Säugling behauptet, obwohl hierzu keinerlei Anzeichen oder Angaben vorhanden gewesen seien. Offensichtlich habe die Annahme einer Fremd- und Eigengefährdung aus einer unkritisch übernommenen Information vom Hörensagen aus verschiedenen Quellen beruht.
Das Landgericht sei im Übrigen zu Unrecht der mehr als unzureichenden, geradezu fahrlässigen Anamnese und Diagnostik durch den Zeugen C gefolgt. Aus dem ärztlichen Kurzgutachten des Zeugen C ergebe sich auch nicht, dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz für die Zwangsunterbringung gewahrt worden sei. Der Zeuge C sei seinen ärztlichen Pflichten auf jeden Fall äußerst nachlässig und keineswegs gewissenhaft nachgekommen.
Die Zwangsfixierungen und Zwangsmedikation, die der Klägerin im Rahmen ihres Aufenthaltes in der Psychiatrie zugefügt worden seien, seien rechtswidrig gewesen. Alle Maßnahmen hätten einer eigenen richterlichen Genehmigung bedurft, insbesondere als über mehrere Stunden und Tage hinweg eine Fixierung unter menschenunwürdigsten Bedingungen vorgenommen worden sei.
Wegen der weiteren Einzelheiten der Berufungsbegründung wird auf den Anwaltsschriftsatz vom 8. Juni 2018 Bezug genommen.
Die Klägerin beantragt,
1.unter Abänderung des am 15. Januar 2018 verkündeten und am 26. März 2018 zugestellten Urteils des Landgerichts Frankfurt, Az. 2-04 O 82/17, das beklagte Land zu verurteilen, an sie ein angemessenes, der Höhe nach in das Ermessen des Gerichts gestelltes Schmerzensgeld zuzüglich Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen,
2.unter Abänderung des am 15. Januar 2018 verkündeten und am 26. März 2018 zugestellten Urteils des Landgerichts Frankfurt, Az. 2-04 O 82/17, festzustellen, dass das beklagte Land verpflichtet ist, der Klägerin sämtliche ihr aus der ärztlichen Falschbehandlung im A-Krankenhaus vom XX. April 2014 bis XX. Mai 2014 entstandenen und noch entstehenden materiellen und immateriellen Schäden zu ersetzen und den für die Vergangenheit zu zahlenden Schaden mit 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Klageerhebung zu verzinsen, und
3.das beklagte Land zu verurteilen, an die Klägerin € 597,74 nicht an-rechenbare außergerichtliche Rechtsanwaltsgebühren zu zahlen.
Das beklagte Land sowie die Streithelferin des beklagten Landes beantragen jeweils,
die Berufung zurückzuweisen.
Sie verteidigen jeweils das angegriffene Urteil. Wegen der weiteren Einzelheiten der Berufungserwiderung des beklagten Landes wird auf den Anwaltsschriftsatz vom 10. Juli 2018 und wegen der weiteren Einzelheiten der Berufungserwiderung der Streithelferin wird auf den Anwaltsschriftsatz vom 20. August 2018 Bezug genommen.
Der erkennende Einzelrichter des Senats hat durch Vernehmung des Zeugen F ergänzend Beweis erhoben. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 17. Mai 2019 verwiesen.
34Die Akten des Amtsgerichts mit dem Aktenzeichen … sowie der Staatsanwaltschaft mit dem Aktenzeichen … waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung.
II.
1. Die Berufung der Klägerin ist statthaft und auch im Übrigen zulässig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt und begründet worden.
2. In der Sache hat die Berufung der Klägerin den aus dem Tenor ersichtlichen Erfolg.
a. Die zulässige Klage ist hinsichtlich des Schmerzensgeldbegehrens in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfange begründet.
Der entsprechende Anspruch der Klägerin ergibt sich aus § 839 Abs. 1 BGB in Verbindung mit Art. 34 Satz 1 GG.
Zwischen den einzelnen von der Klägerin beanstandeten Maßnahmen ist zu differenzieren.
aa. Soweit die Klägerin nach wie vor der Ansicht ist, die Anordnung der sofortigen Ingewahrsamnahme durch die Polizei sei rechtswidrig gewesen, irrt sie. Die Voraussetzungen, unter denen zum damaligen Zeitpunkt nach § 10 HFEG die sofortige Ingewahrsamnahme durch die Polizei angeordnet und vollzogen werden konnte, lagen vor.
Zur Begründung kann zunächst zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden Erwägungen des Landgerichts auf den S. 5 f. des angegriffenen Urteils Bezug genommen werden.
Die dagegen erhobenen Einwände der Klägerin sind nicht stichhaltig. Entgegen der Ansicht der Klägerin ist es insbesondere nicht zu beanstanden, dass der Zeuge POK B die sofortigen Ingewahrsamnahme anordnete, ohne sich selbst ein Bild von der Klägerin verschafft zu haben. Der Zeuge POK B hat bei seiner Vernehmung vor dem Landgericht nachvollziehbar dargelegt, dass er von einem eindeutigen Fall ausgegangen ist, bei dem es nicht notwendig sei, dass er sich selbst ein Bild verschaffe. Diese Einschätzung ist nicht zu beanstanden. In diesem Zusammenhang blendet die Klägerin bei ihrer Argumentation im Übrigen aus, dass es aufgrund von Streitigkeiten zwischen der Klägerin und ihrem Ehemann bereits zwei Tage zuvor zu drei Polizeieinsätzen gekommen war. Bei einer Gesamtschau dieses Umstandes und der Informationen, die der Zeuge POK B von den vor Ort anwesenden Polizeikräften erhalten hatte, durfte er davon ausgehen, dass die Tatbestandsvoraussetzungen der §§ 10 und 1 HFEG erfüllt waren.
bb. Soweit die Klägerin Vorwürfe gegen die Notärztin und die Rettungsassistenten erhebt, fehlt es ganz offensichtlich an der Passivlegitimation des beklagten Landes.
Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes einschließlich der notärztlichen Versorgung sind gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Rettungsdienstgesetzes nämlich die Landkreise und kreisfreien Städte, hier also die Stadt1. Etwaige Amtshaftungsansprüche wegen der Tätigkeit der Notärztin und der Rettungsassistenten wären daher gegenüber der Stadt1 geltend zu machen.
cc. Soweit die Klägerin die Entscheidungen des Amts- und des Landgerichts vom XX. April 2014 bzw. vom XX. April 2014 als amtspflichtwidrig ansieht, bestehen an der Passivlegitimation des beklagten Landes zwar keine Zweifel, da bei den von diesen beiden Gerichten getroffenen Entscheidungen Hoheitsgewalt des beklagten Landes ausgeübt worden ist.
Gleichwohl kommt eine Haftung des beklagten Landes insoweit nicht in Betracht.
Eine einstweilige Anordnung betreffend eine vorläufige Unterbringungsmaßnahme ist kein „Urteil in einer Rechtssache“ im Sinne des § 839 Abs. 2 Satz 1 BGB.
Bei richterlichen Amtspflichtverletzungen außerhalb des Anwendungsbereichs des § 839 Abs. 2 Satz 1 BGB ist der Verfassungsgrundsatz der richterlichen Unabhängigkeit zu beachten. Soweit in solchen Fällen im Amtshaftungsprozess darüber zu befinden ist, ob ein Richter bei der Rechtsanwendung und Gesetzesauslegung schuldhaft amtspflichtwidrig gehandelt hat, kann dem Richter in diesem Bereich ein Schuldvorwurf nur bei besonders groben Verstößen gemacht werden; inhaltlich läuft das auf eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit hinaus.
Vor diesem Hintergrund sind Entscheidungen über den Erlass einer einstweiligen Anordnung im Unterbringungsverfahren in einem nachfolgenden Amtshaftungsprozess nicht uneingeschränkt auf ihre sachliche Richtigkeit, sondern nur daraufhin zu überprüfen, ob sie - bei voller Würdigung auch der Belange einer funktionstüchtigen Rechtspflege - vertretbar sind.
Nach diesen Maßstäben sind im Streitfall sowohl die Entscheidung des Amtsgerichts als auch die des Landgerichts nicht zu beanstanden.
Die Voraussetzungen des § 10 HFEG lagen im Zeitpunkt der Entscheidung des Amtsgerichts vor. Das Amtsgericht durfte davon ausgehen, dass die Angaben in dem psychiatrischen Gutachten vom XX. April 2014 zutrafen, wonach der „Verdacht auf [eine] postpartale Psychose mit manischen Anteilen“ bestand. Die Klägerin war ausweislich dieses psychiatrischen Gutachtens „nicht in der Lage, sich oder ihr Verhalten adäquat zu steuern“; bei einer Entlassung der Klägerin sei „mit einer Eigengefährdung und Fremdgefährdung, vor allem des neugeborenen Kindes“ zu rechnen. Diese Einschätzung korrespondierte zudem mit dem Eindruck der zuständigen Richterin, die in ihrem Anhörungsvermerk u. a. notierte, die Klägerin habe „absolut nicht den Eindruck [erweckt], als dass sie zu adäquatem Verhalten und vor allem adäquatem Umgang mit einem Säugling in der Lage wäre“ . Nach alledem durfte die Richterin dringende Gründe dafür annehmen, dass die Voraussetzungen des § 1 HFEG a. F. gegeben seien und mit einem Aufschub Gefahr verbunden wäre.
Entsprechendes gilt für die Entscheidung des Landgerichts vom XX. April 2014, die ausweislich ihrer Begründung ganz wesentlich auf dem psychiatrischen Gutachten vom XX. April 2014 beruhte. Überdies korrespondierte die in diesem Gutachten niedergelegte Einschätzung auch mit dem in ihrer Stellungnahme vom XX. April 2014 niedergelegten Eindruck der Verfahrenspflegerin.
Vor diesem Hintergrund ist bereits zweifelhaft, ob hier überhaupt die Tatbestandsvoraussetzungen einer einfachen Amtspflichtverletzung vorgelegen haben. Erst recht sind keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass die entscheidenden Richterinnen der Vorwurf einer groben Pflichtverletzung im vorbezeichneten Sinne getroffen hat und dass die Grenzen des erweiterten Beurteilungsspielraums nicht eingehalten worden sind, deren Überschreitung eine amtshaftungsrechtliche Verantwortlichkeit überhaupt erst hätte begründen können.
cc. Soweit die Klägerin ein Schmerzensgeld mit dem Hinweis auf die in der Klinik zum Teil erfolgte Fixierung sowie die dortige Zwangsmedikation begehrt, ist das beklagte Land hier passivlegitimiert.
Dies ergibt sich aus den folgenden Erwägungen:
Die Ärzte des A-Krankenhauses handelten im Zusammenhang mit der Behandlung und Fixierung der Klägerin in Ausübung eines öffentlichen Amtes im Sinne von Art. 34 Satz 1 GG. Maßnahmen der gegen den Willen des Betroffenen erfolgenden Unterbringung und der ärztlichen Zwangsbehandlung aufgrund der Unterbringungsgesetze sind stets öffentlich-rechtlicher Natur.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass das in dem Rechtsstreit … zunächst verklagte A-Krankenhaus nicht als Körperschaft in Betracht kommt, das den Ärztinnen und Ärzten des A-Krankenhauses die Unterbringung und Behandlung der Klägerin im Sinne von Art. 34 Satz 1 GG anvertraut hat. Juristische Personen des Privatrechts scheiden aus dem Kreis der nach Art. 34 GG haftpflichtigen Körperschaften nämlich generell aus.
Zur Ermittlung der passivlegitimierten Körperschaft kann hier nicht auf die Anstellungskörperschaft abgestellt werden, da die behandelnden Ärztinnen und Ärzte Angestellte des A-Krankenhauses und damit eines privaten Rechtsträgers waren.
In Fällen, in denen - wie hier - eine als Haftungssubjekt in Betracht kommende Anstellungskörperschaft nicht existent ist, trifft die Passivlegitimation denjenigen Träger öffentlicher Gewalt, der dem Amtsträger die konkrete Aufgabe, bei deren Erfüllung er die Pflichtverletzung begangen hat, übertragen beziehungsweise anvertraut hat.
Dies ist im Streitfall das Land Hessen. Die Unterbringung von psychisch Kranken oder psychisch Gestörten zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in einem psychiatrischen Krankenhaus ist eine genuin staatliche Aufgabe . Das gilt auch dann, wenn die Patientin - wie hier - in einem privaten Krankenhaus untergebracht wird. Der Inhaber des Privatkrankenhauses ist insoweit als kraft Gewohnheitsrecht beliehener Unternehmer anzusehen.
Wurde also eine Person auf der Grundlage des damals noch in Kraft befindlichen HFEG in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, dann erfolgten die dort konkret ergriffenen Maßnahmen zum Schutz der Patientin vor sich selbst in erster Linie in Erfüllung der Pflicht des Krankenhauses, denjenigen aufzunehmen, der auf Veranlassung der zuständigen Behörde untergebracht werden muss. Das Krankenhaus wurde hierdurch unabhängig von dem allgemeinen Einrichtungsbetrieb unmittelbar in die Unterbringung eingebunden. Die Maßnahmen der Ärztinnen und Ärzte des A-Krankenhauses stellten sich insofern im Rahmen eines einheitlichen Vollzugs der staatlichen Unterbringung als Fortsetzung der gem. § 10 HFEG a. F. durch die Polizei erfolgten Einlieferung der Klägerin dar.
Entgegen der Ansicht des beklagten Landes steht auch § 16 HFEG a. F., nach dem die Verwaltungsbehörde die vom Gericht angeordneten Unterbringungen durchführt, der Passivlegitimation des beklagten Landes nicht entgegen. Der Freiheitsentzug der Klägerin findet für den Zeitraum ab dem XX. April 2014 seine Grundlage allein in der richterlichen Anordnung. Eine Rechtfertigung einer Fixierung in diesem Zeitraum wäre allenfalls in Form einer weiteren richterlichen Anordnung möglich gewesen; eine Verantwortlichkeit der Stadt1 für derartige erfolgte oder nicht erfolgte richterliche Anordnungen besteht jedoch nicht. Die Zuständigkeit nach § 16 HFEG a. F. ist daher insoweit kein eigenständiger Anknüpfungspunkt für eine Passivlegitimation der Stadt.
Nach dem gesamten Inhalt der Verhandlungen und des Ergebnisses der Beweisaufnahme unterliegt es keinem Zweifel, dass die Klägerin hier am XX./XX. April 2014, vom XX. bis zum XX. April 2014 sowie vom XX. April bis XX. Mai 2014 fixiert gewesen ist.
Dies ergibt sich zum einen bereits aus den vorgelegten Behandlungsunterlagen, so dass nicht ersichtlich ist, warum das beklagte Land Ausmaß und Umfang der Fixierung bestritten hat. Es ist schlechterdings nicht vorstellbar, dass eine Klinik einen derart tiefgreifenden und sich oftmals über Stunden hinziehenden Grundrechtseingriff dokumentiert, wenn dieser in Wirklichkeit gar nicht stattgefunden hat.
Im Übrigen ergibt sich die Richtigkeit der aus den Behandlungsunterlagen ersichtlichen Fixierungszeiträumen aus den glaubhaften Bekundungen des Zeugen F. Dieser hat glaubhaft und gut nachvollziehbar seine Erinnerungen an die damaligen Fixierungen seiner Ehefrau wiedergegeben, wobei er sorgsam zwischen den Beobachtungen getrennt hat, die er selbst gemacht hat und denjenigen, die er lediglich über Dritte erfahren hat.
Diese Fixierungen waren hier rechtswidrig.
Die Fixierung einer Patientin stellt einen Eingriff in deren Grundrecht auf Freiheit der Person im Sinne von Art. 5 der Hessischen Verfassung - HV - und von Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG in Verbindung mit Art. 104 GG dar. Sowohl bei einer 5-Punkt- als auch bei einer 7-Punkt-Fixierung von nicht nur kurzfristiger Dauer handelt es sich um eine Freiheitsentziehung im Sinne des Art. 104 Abs. 2 Satz 2 GG. Das gilt auch dann, wenn der Betroffenen - wie hier - im Rahmen der Unterbringung die Freiheit bereits entzogen worden ist .
Die vollständige Aufhebung der Bewegungsfreiheit durch die 5-Punkt- oder die 7-Punkt-Fixierung am Bett nimmt der Betroffenen nämlich die ihr bei der Unterbringung auf einer geschlossenen psychiatrischen Station noch verbliebene Freiheit, sich innerhalb dieser Station - oder zumindest innerhalb des Krankenzimmers - zu bewegen. Diese Form der Fixierung ist darauf angelegt, die Betroffene auf ihrem Krankenbett vollständig bewegungsunfähig zu halten . Aufgrund der besonderen Eingriffsqualität sowohl einer 5-Punkt- als auch einer 7-Punkt-Fixierung sind diese von der richterlichen Unterbringungsanordnung nicht gedeckt.
An einer danach erforderlichen richterlichen Genehmigung der erfolgten Fixierungen hat es im Streitfall gefehlt, so dass die Fixierungen schon aus diesem Grunde rechtswidrig sind.
Entsprechendes gilt in Bezug auf die Zwangsbehandlung der Klägerin. Die medizinische Behandlung einer Untergebrachten gegen ihren natürlichen Willen greift in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit ein . Dieses Grundrecht schützt die körperliche Integrität des Grundrechtsträgers und damit auch das diesbezügliche Selbstbestimmungsrecht. Zu seinem traditionellen Gehalt gehört der Schutz gegen staatliche Zwangsbehandlung. Dem Eingriffscharakter einer Zwangsbehandlung steht auch nicht entgegen, dass sie zum Zweck der Heilung vorgenommen wird.
Vor diesem Hintergrund scheidet eine Auslegung der richterlichen Anordnung vom XX. April 2014 im Sinne einer Genehmigung auch einer ärztlichen Zwangsbehandlung aus. Auch die Zwangsbehandlung der Klägerin war daher rechtswidrig.
Soweit die Beklagte eingewandt hat, ein Anspruch der Klägerin aus § 839 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG komme hier zumindest deswegen nicht in Betracht, weil es am Verschulden fehle, ist dies nicht stichhaltig. Dass eine Fixierung nicht von der Genehmigung der Unterbringung als solcher abgedeckt ist, sondern als eigenständige Freiheitsentziehung einer eigenen richterlichen Genehmigung bedarf, entsprach auch vor dem Urteil des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juli 2018 der ganz herrschenden Auffassung in Rechtsprechung und Literatur.
Da nach Art. 104 Abs. 2 GG über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung nur der Richter zu entscheiden hat und es sich bei dieser Bestimmung um unmittelbar geltendes und anzuwendendes Recht handelt, lag es daher auch im Jahre 2014 auf der Hand, dass eine Fixierung einer eigenständigen richterlichen Genehmigung bedarf.
Dementsprechend wird auch in den in der rechtswissenschaftlichen Literatur veröffentlichten Anmerkungen zu der Entscheidung des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juli 2018 immer wieder betont, dass die Entscheidung keine Überraschung dargestellt habe.
Entsprechendes gilt für die Frage der Zwangsbehandlung. Die oben zitierten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes sowie des Bundesgerichtshofes ergingen mit Ausnahme des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes in dem Verfahren 2 BvR 1698/12 allesamt deutlich vor April 2014.
Auch die übrigen Voraussetzungen eines Anspruches nach § 839 BGB in Verbindung mit Art. 34 Satz 1 GG liegen vor.
Der erkennende Einzelrichter erachtet ein Schmerzensgeld in Höhe von € 12.000,00 als angemessen, aber auch als ausreichend.
Für die Höhe des Schmerzensgeldes ist primär das Ausmaß der konkreten Beeinträchtigungen maßgebend, wobei an die Funktionen des Schmerzensgeldes anzuknüpfen ist, die wegen der Unmöglichkeit der tatsächlichen Wiedergutmachung in einem Ausgleich der Lebensbeeinträchtigung, des Weiteren auch in einer Genugtuung für das zugefügte Leid bestehen . Besonderes Gewicht kommt etwaigen Dauerfolgen der Verletzungen zu.
Bei der Bemessung des Schmerzensgeldes hat sich der erkennende Einzelrichter u. a. an dem Urteil des Landgerichts Berlin vom 28. Januar 2015 in dem Verfahren 86 O 88/14 orientiert, wobei allerdings die teilweise anderen Umstände des hiesigen Verfahrens zu berücksichtigen waren.
b. Der Feststellungsantrag ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfange begründet.
Es erscheint zumindest möglich, dass die Klägerin auf Grund etwaiger verbleibenden eingriffsbedingter Schäden in der Zukunft immaterielle Beeinträchtigungen erleiden wird, die durch das ausgeurteilte Schmerzensgeld nicht erfasst werden. Dass die Klägerin aus dem gleichen Grund zukünftig materielle Schäden erleiden kann, liegt auf der Hand. Zudem ist es möglich, dass der Klägerin bereits materielle Schäden entstanden sind.
Soweit die Klägerin jedoch insoweit auch die Feststellung begehrt hat, dass der „für die Vergangenheit zu zahlenden Schaden mit fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Klageerhebung zu verzinsen“ sei, ist ihr Feststellungsantrag unbegründet. § 291 BGB greift nämlich bei einer Klage, die auf die Feststellung einer Verbindlichkeit gerichtet ist, nicht ein; die Klage auf Feststellung einer Verbindlichkeit löst daher keine Verzinsungspflicht nach § 291 BGB aus.
c. Der Antrag zu 3 ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfange begründet.
3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 Nr. 1und Nr. 2 Fall 1 ZPO.
4. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat seine Grundlage in den §§ 708 Nr. 10 Satz 1, 713 ZPO.
5. Gründe, die Revision zuzulassen, liegen nicht vor.
Der Sache kommt keine grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO zu. Dies ist nur dann der Fall, wenn die Sache eine klärungsbedürftige und klärungsfähige Rechtsfrage aufwirft, die sich in einer unbestimmten Vielzahl weiterer Fälle stellen kann und deshalb das abstrakte Interesse der Allgemeinheit an der einheitlichen Entwicklung und Handhabung des Rechts berührt. Klärungsbedürftig sind dabei solche Rechtsfragen, deren Beantwortung zweifelhaft ist oder zu denen unterschiedliche Auffassungen vertreten werden und die noch nicht oder nicht hinreichend höchstrichterlich geklärt sind.
Nach diesen Maßstäben wirft die vorliegende Sache keine klärungsbedürftigen Rechtsfragen auf. Es handelt sich vielmehr um eine von den tatsächlichen Besonderheiten des Sachverhalts geprägte Einzelfallentscheidung. Die rechtlichen Fragen sind in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes und des Bundesgerichtshofes geklärt.
Die Zulassung der Revision ist im vorliegenden Fall auch nicht zur „Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung“ erforderlich. Dieser Zulassungsgrund ist insbesondere dann gegeben, wenn das Berufungsgericht von einer Entscheidung eines höherrangigen Gerichts, namentlich des Bundesgerichtshofes, abweicht. Eine Abweichung in diesem Sinne liegt dann vor, wenn das Berufungsgericht ein und dieselbe Rechtsfrage anders beantwortet als die Vergleichsentscheidung, also einen Rechtssatz aufstellt, der sich mit dem in der Vergleichsentscheidung aufgestellten Rechtssatz nicht deckt.
Eine so verstandene Abweichung von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes findet im vorliegenden Fall nicht statt.
Wird eine Patientin einer geschlossenen psychiatrischen Klinik ohne richterliche Genehmigung fixiert, hat sie Anspruch auf Schadenersatz.
Streifler&Kollegen - Anwalt für Haftungsrecht Berlin
Diese Klarstellung traf das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt a. M. im Fall einer Frau, die im Zusammenhang mit ihrer Einweisung und Behandlung in einer psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses Schmerzensgeld verlangt. Nach einer Frühgeburt gestaltete sich ihre häusliche Situation schwierig. Ein Notruf ihres Ehemanns führte 2014 dazu, dass sie gegen ihren Willen in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen wurde. Dort befand sie sich gut zwei Wochen. Sie wurde dabei teilweise fixiert und mit Medikamenten therapiert. Das Amts- und das Landgericht hatten damals die vorläufige Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung für zulässig erklärt. Die Frau begehrt nunmehr ein angemessenes Schmerzensgeld. Sie behauptet eine Falschbehandlung in der Klinik. Das Landgericht hatte die Klage abgewiesen.
Schmerzensgeld für grundrechtsverletzende Fixierung
Auf die Berufung hin hat das OLG das Land Hessen verurteilt, ein Schmerzensgeld von 12.000 EUR zu zahlen. Zu Recht nehme die Frau das Land Hessen in Anspruch, da die Unterbringung von psychisch Kranken zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in einem psychiatrischen Krankenhaus „eine genuin staatliche Aufgabe“ sei, stellt das OLG zunächst klar. Die nachgewiesenen Fixierungen seien hier auch rechtswidrig gewesen. Werde eine Patientin fixiert, sei das ein Eingriff in ihr Grundrecht auf Freiheit der Person. Sowohl bei einer 5-Punkt- als auch bei einer 7-Punkt-Fixierung von nicht nur kurzfristiger Dauer handele es sich um eine Freiheitsentziehung. Dies gelte auch, wenn – wie hier – die Freiheit bereits durch die Einweisung entzogen wurde. Die Fixierung nehme der Betroffenen die noch verbliebene Freiheit, sich innerhalb der Station oder jedenfalls im Zimmer frei zu bewegen. Infolge der besonderen Eingriffsqualität sei eine solche Fixierung nicht von der richterlichen Unterbringungsanordnung gedeckt.
Medikamente als Angriff der körperlichen Unversehrtheit
Für die Fixierungen wäre demnach eine richterliche Genehmigung erforderlich gewesen. Diese fehlte, sodass die Fixierungen bereits aus diesem Grund rechtswidrig gewesen seien. Gleiches gelte für die Zwangsbehandlung der Frau. „Die medizinische Behandlung einer Untergebrachten gegen ihren natürlichen Willen ... greift in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit ein“, betont das OLG. Dem Eingriffscharakter stehe auch nicht entgegen, dass sie zum Zweck der Heilung vorgenommen werde. Auch die Zwangsbehandlung sei durch die Unterbringungsanordnung selbst deshalb nicht gedeckt und damit rechtswidrig.
Das Schmerzensgeld sei angesichts des Ausmaßes der konkreten Beeinträchtigungen und der Funktion eines Schmerzensgelds mit 12.000 EUR angemessen, aber auch ausreichend bemessen.
Haben Sie Fragen zum Thema Haftungsrecht? Nehmen Sie Kontakt zu einen Fachanwalt der Kanzlei Streifler&Kollegen auf und lassen Sie sich fachkundig beraten.
moreResultsText
moreResultsText