Die Call Option im Gesellschafts und Restrukturierungsrecht
2. Begriff und Grundmechanik
Unter einer Call‑Option verstehen wir im Gesellschaftsrecht das einseitig ausübbares Erwerbsrecht des Begünstigten (Optionsberechtigten) auf Übertragung bestimmter Geschäftsanteile oder Aktien zu einem festgelegten oder zumindest bestimmbaren Preis. Üblich sind zwei technische Grundformen: Entweder wird ein Optionsvertrag geschlossen, der den späteren Abschluss eines Anteilskaufvertrags (SPA) vorsieht, oder es wird bereits heute ein aufschiebend bedingter Kauf‑ und Abtretungsvertrag beurkundet, dessen Wirksamkeit allein vom Eintritt bestimmter Bedingungen (Covenant‑Bruch, Zahlungsverzug, Scheitern definierter Meilensteine, „Default Events“) oder von der Optionserklärung abhängt.
Bei GmbH‑Anteilen ist wegen § 15 Abs. 3 GmbHG Notarform zu beachten. In der Praxis wird daher meist ein notariell beurkundetes, unwiderrufliches Angebot auf Abtretung der Anteile formuliert, das der Optionsberechtigte bei Eintritt der Bedingungen annehmen kann, ohne eine weitere Beurkundung zu benötigen; alternativ wird ein vollständiger, aufschiebend bedingter SPA beurkundet. Für AG‑Aktien gelten demgegenüber die sachenrechtlichen Übertragungsregeln; Formfragen sind weniger rigide, gesellschaftsrechtliche Vinkulierungen in der Satzung oder in Pool‑/Aktionärsverträgen können aber Zustimmungserfordernisse auslösen.
Wesentliche Vertragsbausteine sind eine präzise Trigger‑Definition (wann darf ausgeübt werden), eine Preisformel (fest, „locked box“, multiple‑basierte Bestimmbarkeit oder Fair‑Market‑Value mit Gutachterklausel), Closing‑Mechaniken einschließlich Zustimmungen nach Satzung oder Gesellschaftervereinbarung, aufsichts‑ und investitionskontrollrechtliche Freigaben, sowie die Risikoallokation für Gewährleistungen und Haftung (in der Sanierung meist stark reduziert).
3. Typische Einsatzfelder – außerhalb und innerhalb der Krise
In „gesunden“ Transaktionen begegnet uns die Call‑Option als Kontrollinstrument in Joint Ventures (z.B. Deadlock‑Lösung), als Leaver‑Mechanik in Management‑Beteiligungen oder zur Sicherung von Vorkaufsrechten. Ihre besondere Schlagkraft entfaltet sie jedoch im Restrukturierungs‑ und Distressed‑Kontext. Kreditgeber, die ihr Engagement notfalls in Eigenkapital transformieren wollen („loan‑to‑own“), sichern sich durch eine Call‑Option an der HoldCo die Möglichkeit, bei Scheitern des Sanierungspfads rasch die Kontrolle zu übernehmen – ohne die Unsicherheiten einer Zwangsverwertung verpfändeter Anteile. Diese Unsicherheiten haben zugenommen: Die nach dem BEG IV geänderte öffentliche Versteigerung (§ 383 BGB n.F.) erleichtert zwar technisch digitale Verfahren, hat aber den Kreis der berechtigten Versteigerer verengt; bei nichtbörslichen Geschäftsanteilen bedeutet das regelmäßig Mehrzeit, Mehrangreifbarkeit und damit Wertvernichtung in der Zielgesellschaft. Eine Call‑Option kann hier die Transaktionssicherheit erhöhen – rechtssicher ausgestaltet und im Einklang mit § 1229 BGB.
4. Das Verfallsverbot des § 1229 BGB – Dreh‑ und Angelpunkt jeder Call‑Struktur
4.1. Ratio und Leitentscheidungen
§ 1229 BGB verbietet Verfallsklauseln: Vor Eintritt der Verkaufsberechtigung getroffene Abreden, wonach dem Pfandgläubiger bei Nichtbefriedigung das Eigentum an der Pfandsache zufallen soll, sind nichtig. Der Gedanke dahinter: Wer ein Pfand hält, soll nicht ohne geregelte Verwertung zum Eigentümer werden; der Verwertungserlös soll notfalls überschießende Werte schützen. Der Bundesgerichtshof hat in zwei Grundsatzentscheidungen klargestellt, dass § 1229 BGB nicht analog auf Fälle anzuwenden ist, in denen der Begünstigte der Verfallsabrede gerade kein Pfandgläubiger an der betroffenen Sache ist (BGH, Urt. v. 23. 6. 1995 – V ZR 265/93; Urt. v. 25. 10. 2002 – V ZR 253/01). Das Verfallsverbot sei sachenrechtliche Sonderregel und keine Generalklausel zum Schutz des Eigentümers; Abwehrmechanismen ergäben sich im Übrigen aus § 138 BGB und aus der Vertragsstrafen‑Herabsetzung.
4.2. Konsequenzen für die Gestaltung
Die Rechtsprechung liefert eine klare Leitplanke: Gefährlich ist die Kombination „Pfandrecht an bestimmten Anteilen + Call‑Option auf genau diese Anteile zugunsten des Pfandgläubigers“. Das ist verbotene Verfallsgestaltung. Dagegen ist eine Call‑Option auf andere Anteile – etwa auf die Holding‑Anteile, während die Sicherheiten auf Ebene der operativen Tochtergesellschaften liegen – grundsätzlich zulässig, solange Pfandgläubiger und Optionsbegünstigter nicht identisch sind und keine wirtschaftlich eindeutige Einheit bilden.
Praxisrelevant ist die Einschaltung eines Sicherheitenagenten mit Parallel Debt: Zivilrechtlich ist dann der AgentPfandgläubiger, wirtschaftlich stehen die Sicherheiten aber ausschließlich den Kreditgebern zu. Wird gleichzeitig den Kreditgebern (nicht dem Agenten) eine Call‑Option an den verpfändeten Anteilen eingeräumt, stellt sich die Frage, ob § 1229 BGB trotz formaler Trennung greift. Man kann argumentieren, dass die Kreditgeber wirtschaftlich „Pfandgläubiger“ sind; ebenso lässt sich mit der BGH‑Linie einwenden, dass das Gesetz formale Pfandrechtsinhaberschaft meint und eine Analogie unerwünscht ist. Mangels höchstrichterlicher Klärung bleibt hier Rechtsunsicherheit. Wer diese vermeiden will, ordnet Pfandrechte und Call‑Option auf unterschiedlichen Ebenen an (Pfand auf OpCos, Call auf HoldCo) oder wählt als Optionsbegünstigten eine Zweckgesellschaft, die gesellschafts‑ und vertragsrechtlich unabhängig ist – und auf die der Pfandgläubiger keine beherrschenden Einflussrechte hat. Werden solche Einflussrechte doch eingeräumt, liegt der Vorwurf der Umgehung nahe.
4.3. Restrukturierungsspezifik: Eingeschränkter Schutzbedarf?
In Sanierungsverhandlungen ist die Fälligkeit häufig absehbar oder bereits eingetreten; die Beteiligten wissen, dass Anteile im Raum stehen. Es spricht einiges dafür, den Schutzzweck des § 1229 BGB in dieser Lage enger zu lesen, als in „normalen“ Kreditverhältnissen. Rechtssicher wird die Gestaltung dadurch jedoch nicht automatisch; sie bleibt vom konkreten Setup abhängig (Zeitpunkt, Beteiligte, Ebene der Sicherheiten, Einflussrechte). Das Ergebnis muss daher stets struktur‑ und satzungsspezifisch hergeleitet werden.
5. Gesellschaftsrechtliche Flanken
Jede Call‑Option scheitert, wenn sie an Satzungsklauseln oder Poolvereinbarungen vorbei geplant wird. Zustimmungserfordernisse, Vinkulierungen, Mitveräußerungsrechte und ‑pflichten (drag/tag), Vorkaufsrechte sowie Change‑of‑Control‑Klauseln in Finanzierungs‑, Liefer‑ oder Mietverträgen sind frühzeitig zu adressieren. Bei der GmbH ist die Notarform zu sichern; irrevisible Angebote sollten inhaltlich bestimmt sein (Anteil, Preis oder klare Bestimmungsmechanik, Closing‑Voraussetzungen).
Kapitalerhaltung bleibt Leitplanke: Der Erwerb von Anteilen durch die Gesellschaft selbst oder verdeckte Rückgewährvorgänge (§ 30 GmbHG) dürfen nicht durch Optionsmechaniken umgangen werden. Bei Management‑Optionen sind arbeits‑ und mitbestimmungsrechtliche Vorgaben, steuerliche Dry‑Income‑Risiken und das Equal‑Treatment der Belegschaft zu prüfen.
6. Kartell‑, Aufsichts‑ und Außenwirtschaftsrecht
Der bloße Optionsvertrag löst regelmäßig noch keine fusionskontrollrechtliche Anmeldepflicht aus. Entscheidend ist, ob mit der Option bereits Kontrolle im Sinne eines entscheidenden Einflusses übertragen wird. Weitreichende Vetorechte, Informations‑ und Zustimmungsvorbehalte oder Interims‑Governance können schnell in die Nähe eines Gun‑Jumping geraten. Bei Erreichen bestimmter Beteiligungsschwellen (GWB) oder in sensitiven Sektoren nach AWG/AWV kann vor oder bei Ausübung eine Freigabe erforderlich sein. Bei börsennotierten Zielgesellschaften sind Stimmrechtszurechnungen und Pflichten nach dem WpÜG (30 %‑Kontrollschwelle) mitzudenken.
7. Insolvenzrechtliche Stolpersteine: Anfechtung, Nachrang, Sanierungsprivileg
Die Option selbst ist meist wertneutral. Problematisch wird es bei Ausübung oder bei Vorverlagerung des wirtschaftlichen Eigentums. Erfolgt der Erwerb unter Wert, drohen Anfechtungen wegen unentgeltlicher Leistung (§ 134 InsO) oder wegen vorsätzlicher Benachteiligung (§ 133 InsO); bei „marktgerechtem“ Preis schwächt eine tragfähige Wertermittlung (Gutachter, Fairness Opinion) dieses Risiko. Werden Kreditgeber durch Ausübung der Call‑Option zu Gesellschaftern, geraten bestehende Darlehen in den Fokus des § 135 InsO und (über § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO) in den Nachrang. Abhilfe schafft – richtig dokumentiert – das Sanierungsprivileg des § 39 Abs. 4 S. 2 InsO: Tritt der Kreditgeber zum Zwecke der Sanierung und bei Insolvenzreife in die Gesellschafterstellung ein und liegt ein substantielles, drittprüfbares Sanierungskonzept vor, entfällt der Nachrang (und die Erleichterung des § 135 InsO) bis zur nachhaltigen Sanierung. In der Praxis ist deshalb ein IDW‑S6‑fähiges Konzept samt Fortführungsprognose und ein stringenter Maßnahmenplan unverzichtbar.
Daneben sind Zahlungen nach Eintritt der Insolvenzreife streng reglementiert (§ 15b InsO). Zwar adressiert die Haftungsnorm vorrangig Geschäftsleiter; im Hintergrund stehen aber Überwachungs‑ und Eskalationspflichten von Aufsichts‑ und Beiratsgremien, die in der Krise auch Optionsausübungen begleiten. Wer die Option nutzt, um noch Liquidität zu entziehen, riskiert Anfechtungs‑ und Haftungsfolgen.
8. Steuerliche Randthemen (Überblick)
Optionsprämien können bilanz‑ und ertragsteuerlich unterschiedlich zu behandeln sein; die Ausübung führt grundsätzlich zu einem Anschaffungsvorgang beim Erwerber, die Veräußererseite realisiert – je nach Struktur – laufende Einkünfte oder Veräußerungsgewinne (bei Kapitalgesellschaften mit § 8b KStG‑Thematik). In Immobilien‑strukturierten Gruppen ist die Grunderwerbsteuer bei Share‑Deals und Schwellenwerten (90 %) im Blick zu behalten. In Sanierungen begegnet zudem die Ertragsteuer eines Forderungsverzichts (Sanierungsgewinn) und die Zinsabzugsbeschränkung. Eine frühe steuerliche Strukturierung ist ratsam, dieser Aufsatz beschränkt sich auf den zivil‑ und insolvenzrechtlichen Kern.
9. Vertragsgestaltung: Was „gute“ Call‑Optionen auszeichnet
Eine tragfähige Call‑Option beginnt mit klaren, objektivierbaren Triggern, die Missbrauch ausschließen. Preis und Gegenstand müssen bestimmt oder jedenfalls bestimmbar sein; Bewertungsmechaniken mit Sachverständigen‑Bestimmung vermeiden Streit. Kollisionen mit § 1229 BGB werden durch Ebenentrennung von Sicherheiten und Option, durch Unabhängigkeit des Optionsbegünstigten und durch Verzicht auf beherrschende Einflussrechte entschärft. Genehmigungen (Satzung, Pool, Kartell‑ und Außenwirtschaftsrecht) gehören als aufschiebende Bedingungen in den Vertrag. Gewährleistungen werden im Distressed‑Setting realistisch reduziert; Risiken werden über W&I‑Versicherung nur ausnahmsweise gedeckt. Schließlich sind Dokumentation und Governance entscheidend: Ein sauberer Board‑Record, die Hinweise an die Geschäftsführung zu § 15a/§ 15b InsO, ein abgegrenztes Payment‑Regime und – bei Sanierungsziel – ein belastbares Konzept schützen die Beteiligten.
10. Fazit
Die Call‑Option ist im deutschen Unternehmens‑ und Restrukturierungsalltag ein hochwirksames Instrument, wenn sie rechtssicher gebaut wird. Ihr größter Wert liegt in der Transaktionssicherheit: Sie ersetzt in kritischen Momenten eine langwierige, angreifbare Zwangsverwertung. Zugleich ist sie rechtlich anspruchsvoll – insbesondere dort, wo sie mit Sicherheiten zusammentrifft. Wer die Leitplanken des § 1229 BGB beachtet, Sicherheiten‑ und Optionsebenen sauber trennt, beherrschende Einflussrechte vermeidet und die insolvenzrechtlichen Folgen (Anfechtung, Nachrang, Sanierungsprivileg) vordenkt, nutzt ihr Potential ohne „Bumerang‑Effekt“. Für Kreditgeber ist sie die Eintrittskarte in die Gesellschafterrolle, für Unternehmen und Organe ein Pfad zu planbaren Kontrollwechseln – und für Berater ein Feld, in dem Detailkenntnis den Unterschied macht.
moreResultsText
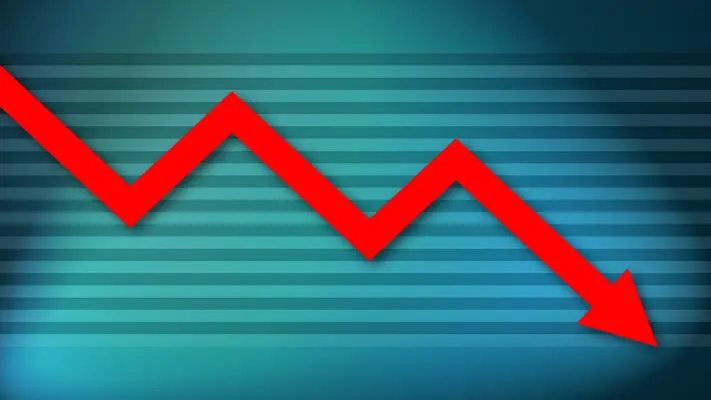
Annotations
(1) Die Geschäftsanteile sind veräußerlich und vererblich.
(2) Erwirbt ein Gesellschafter zu seinem ursprünglichen Geschäftsanteil weitere Geschäftsanteile, so behalten dieselben ihre Selbständigkeit.
(3) Zur Abtretung von Geschäftsanteilen durch Gesellschafter bedarf es eines in notarieller Form geschlossenen Vertrags.
(4) Der notariellen Form bedarf auch eine Vereinbarung, durch welche die Verpflichtung eines Gesellschafters zur Abtretung eines Geschäftsanteils begründet wird. Eine ohne diese Form getroffene Vereinbarung wird jedoch durch den nach Maßgabe des vorigen Absatzes geschlossenen Abtretungsvertrag gültig.
(5) Durch den Gesellschaftsvertrag kann die Abtretung der Geschäftsanteile an weitere Voraussetzungen geknüpft, insbesondere von der Genehmigung der Gesellschaft abhängig gemacht werden.
(1) Ist die geschuldete bewegliche Sache zur Hinterlegung nicht geeignet, so kann der Schuldner sie im Falle des Verzugs des Gläubigers am Leistungsort versteigern lassen und den Erlös hinterlegen. Das Gleiche gilt in den Fällen des § 372 Satz 2, wenn der Verderb der Sache zu besorgen oder die Aufbewahrung mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist.
(2) Ist von der Versteigerung am Leistungsort ein angemessener Erfolg nicht zu erwarten, so ist die Sache an einem geeigneten anderen Orte zu versteigern.
(3) Die Versteigerung hat durch einen für den Versteigerungsort bestellten Gerichtsvollzieher oder zu Versteigerungen befugten anderen Beamten oder öffentlich angestellten Versteigerer öffentlich zu erfolgen (öffentliche Versteigerung). Zeit und Ort der Versteigerung sind unter allgemeiner Bezeichnung der Sache öffentlich bekannt zu machen.
(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten nicht für eingetragene Schiffe und Schiffsbauwerke.
Eine vor dem Eintritt der Verkaufsberechtigung getroffene Vereinbarung, nach welcher dem Pfandgläubiger, falls er nicht oder nicht rechtzeitig befriedigt wird, das Eigentum an der Sache zufallen oder übertragen werden soll, ist nichtig.
BUNDESGERICHTSHOF
für Recht erkannt:
Die Beklagte trägt die Kosten der Rechtsmittelverfahren.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Beklagte ist Eigentümerin eines Grundstücks in K. -W. , das mit einem Einfamilienhaus bebaut ist und von ihr bewohnt wird. Im Jahr 1993 verkaufte sie das Grundstück zum Preis von 480.000 DM an einen Bauträger. Einen Teilbetrag von 290.000 DM erhielt sie vorab und verwandte ihn zur Tilgung von Hypotheken und anderen Verpflichtungen. Da der Bauträger in Konkurs fiel und der Kaufvertrag nicht durchgeführt wurde, mußte die Beklagte die 290.000 DM zurückzahlen. Um das Geld aufbringen zu können, entschloß sie sich Ende 1997, das Einfamilienhaus zu einem Dreifamilienhaus auszubauen und zu veräußern.
Zur Durchführung des Bauvorhabens erwarb die Beklagte mit notariell beurkundetem Vertrag vom 20. November 1998 eine ihrem Grundstück benachbarte Parzelle von ca. 288 qm für 86.400 DM. Da sie für den Erwerb der Parzelle keine Barmittel besaß, zudem die Rückzahlung des Betrags von 290.000 DM drängte und weitere Verbindlichkeiten aus dem in Angriff genommenen Bauvorhaben bereits entstanden waren, gewährte ihr der Kläger, der ihr als Architekt empfohlen worden war, ein Darlehen von 410.000 DM zu einem Zinssatz von 5 % p.a. Der Darlehensvertrag wurde ebenfalls am 20. November 1998 beurkundet. Für den Fall, daß die Rückzahlung des Darlehens nicht fristgemäß (31. Oktober 1999) erfolgte, erhielt der Kläger einen Anspruch auf Übereignung des Grundstücks eingeräumt. Weiter bevollmächtigte die Beklagte den Kläger, das Grundstück mit Grundpfandrechten bis zur Höhe von 410.000 DM zuzüglich Zinsen zu belasten, soweit dies der Sicherung des an die Beklagte ausgezahlten Darlehensbetrags diente. Von dieser Möglichkeit machte der Kläger noch an demselben Tag Gebrauch; er bestellte zugunsten der R. bank M. für ein von ihm aufgenommenes Darlehen von 410.000 DM eine Grundschuld. Die Darlehenssumme leitete er an die Beklagte weiter.
Die Beklagte erbrachte keine Zahlungen auf das ihr vom Kläger gewährte Darlehen. Deswegen verlangt der Kläger die Übertragung des Eigentums an dem Grundstück. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben; die auf Erteilung der Löschungsbewilligung für die zugunsten des Klägers im Grundbuch eingetragene Auflassungsvormerkung gerichtete Widerklage der Beklagten hat es abgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben.
Mit seiner Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, begehrt der Kläger die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.
Entscheidungsgründe:
I.
Nach Auffassung des Berufungsgerichts entfällt der Anspruch des Klägers auf Rückzahlung des Darlehens und damit sein Eigentumsübertragungsanspruch nicht nach den Grundsätzen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage. Jedoch sei die Vereinbarung der Eigentumsübertragung nach § 134 BGB nichtig , weil sie als eine unzulässige Verfallabrede zu werten sei. Darüberhinaus sei die Vereinbarung auch wegen eines Verstoßes gegen die guten Sitten nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig, weil der Grundstückswert mehr als doppelt so hoch wie die der Beklagten vom Kläger zur Verfügung gestellte Darlehenssumme sei. Schließlich bestünden auch erhebliche Bedenken gegen die Begründetheit des Klageanspruchs unter dem Gesichtspunkt der Herabsetzung einer unangemessenen Vertragsstrafe (§ 343 Abs. 1 BGB).
Das hält einer revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
II.
1. Rechtlich nicht zu beanstanden ist allerdings die Auffassung des Berufungsgerichts , die Geschäftsgrundlage für den Darlehensrückzahlungsan-
spruch des Klägers sei nicht entfallen. Das greift die Revision als ihr günstig nicht an. 2. Zu Unrecht wendet das Berufungsgericht jedoch die Vorschriften über das Verbot einer Verfallabrede auf die Vereinbarung der Eigentumsübertragung entsprechend an.
a) Nach §§ 1149, 1192 BGB kann der Grundstückseigentümer, solange nicht die durch die Grundschuld gesicherte Forderung ihm gegenüber fällig geworden ist, dem Gläubiger nicht das Recht einräumen, zum Zweck der Befriedigung die Übertragung des Eigentums an dem Grundstück zu verlangen. Danach liegt eine unzulässige Verfallvereinbarung dann vor, wenn das Recht dem Gläubiger vor Fälligkeit seiner Forderung eingeräumt wird und ihm gerade unter der Bedingung zustehen soll, daß er trotz Fälligkeit seiner Forderung nicht ordnungsgemäß befriedigt wird; ferner muß die Eigentumsverschaffung zum Zweck der Befriedigung des Gläubigers erfolgen und der Zwang zur Sachverwertung durch die vereinbarte Sachübertragung ersetzt werden (Senat, BGHZ 130, 101, 105 m.w.N.). Eine solche Fallkonstellation liegt hier nicht vor. Der Kläger ist nicht Grundschuldgläubiger, sondern nur Gläubiger der Darlehensforderung. Bei der Zwangsvollstreckung könnte er nicht bevorzugt auf das Grundstück der Beklagten zugreifen, weil er daran kein Pfandrecht besitzt. Die vereinbarte Eigentumsübertragung stellt deswegen keine Umgehung einer zwingend notwendigen Sachverwertung dar.
b) Die entsprechende Anwendung des § 1149 BGB ist entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht möglich, weil der vorliegende Sachverhalt trotz ggf. ähnlicher Interessenlage auf der Seite der Beklagten nicht mit dem im Gesetz geregelten vergleichbar ist (vgl. BGHZ 105, 140, 143).
aa) Das Verbot der Verfallabrede kann nicht losgelöst von der Hingabe eines dinglichen Sicherungsrechts als Schutznorm für jeden Eigentümer gegenüber seinen Gläubigern verstanden und ausgeweitet werden; es würde dann nämlich auf Fälle angewendet, die dem im Gesetz entschiedenen gerade nicht rechtsähnlich sind, weil sie sich in einem maßgeblichen Punkt nicht gleichen. Das hat der Senat bereits in seinem in BGHZ 130, 101 ff. veröffentlichten Urteil ausgesprochen. Davon abzuweichen, besteht trotz der in der Literatur geäußerten Kritik (MünchKomm-BGB/Eickmann, 3. Aufl., § 1149 Rdn. 12; Schulz, JR 1996, 245, 246; Tiedtke, ZIP 1995, 57 ff.) kein Anlaß. Sie verkennt nämlich, daß der in § 1149 BGB auch zum Ausdruck kommende Schutz des Schuldners vor der Gefahr, sein Grundstückseigentum aus Unerfahrenheit oder aus einer Notlage heraus lediglich gegen die Tilgung von Schulden, die unter Umständen erheblich geringer sein können als der Wert des Grundstücks, zu verlieren (vgl. Tiedtke aaO, 59), nicht der maßgebliche Gesetzeszweck ist. Dieser Schutz wird dem Grundstückseigentümer nämlich bereits über § 138 BGB und, falls die Verfallabrede als eine wirksame Vertragsstrafenvereinbarung anzusehen ist, über § 343 BGB gewährt. Das Verbot der Verfallabrede ist vielmehr ein sachenrechtliches Instrument zur Regelung der Art der Realisierung eines Pfandrechts (vgl. Senat aaO, 106).
bb) Der von dem Berufungsgericht hervorgehobene Umstand, daß hier die Kreditbeschaffung und die Kreditsicherung in zwei Geschäfte aufgespalten sind, rechtfertigt keine andere Betrachtungsweise. Der Kläger steht einem durch Grundpfandrechte gesicherten Gläubiger nicht gleich, obwohl er zur Aufbringung des der Beklagten zur Verfügung gestellten Darlehensbetrags seinerseits ein Darlehen aufgenommen hat und zugunsten seines Kreditgebers eine
Grundschuld an dem verfallsbedrohten Grundstück bestellt wurde. Die Pflicht der Beklagten zur Eigentumsübertragung stellt sich deswegen nicht als ein im Vorgriff vereinbarter Verfall unter Umgehung der gesetzlich angeordneten Verwertung (§§ 1147, 1192 BGB) dar. Es ist nicht ersichtlich, daß ein rechtlich erheblicher innerer Zusammenhang zwischen der Verpfändung des Grundstücks und der Verfallabrede besteht. Sie berührt die Verwertung des Grundstücks durch die Grundschuldgläubigerin in keiner Weise, sondern beinhaltet die Vereinbarung über die Ersetzung der Rückzahlungsverpflichtung durch eine andere als die nach § 607 Abs. 1 BGB a.F. geschuldete Leistung (§ 364 Abs. 1 BGB). Der Eigentumsübertragungsanspruch des Klägers entsteht somit unabhängig von dem Schicksal der für die Raiffeisenbank eingetragenen Grundschuld. Damit haftet das Grundstück nicht in gleicher Weise als Sicherheit für die Zahlungsverpflichtung der Beklagten wie im Fall der direkten Kreditbeschaffung bei der Grundschuldgläubigerin.
3. Rechtlich nicht haltbar ist auch die Auffassung des Berufungsgerichts, die Vereinbarung der Eigentumsübertragung sei nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig. Zwar verkennt es nicht die Voraussetzungen, unter denen nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, insbesondere auch des Senats , eine vertragliche Regelung nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig sein kann, wenn zwischen Leistung und Gegenleistung ein besonders grobes Mißverhältnis besteht (siehe nur Senat, BGHZ 146, 298, 301 f.). Aber es stellt schon nicht fehlerfrei das Vorliegen eines solchen Mißverhältnisses fest. Die übereinstimmenden Vorstellungen der Parteien, durch die Baumaßnahmen habe eine Wertsteigerung des Grundstücks bis zu einem Betrag von ca. 900.000 DM eintreten können, entbindet das Berufungsgericht nicht von der Verpflichtung zur Ermittlung des tatsächlichen Verkehrswerts. Sie kann jedoch ohne Beweiser-
hebung nur bei eigener Sachkunde des Berufungsgerichts erfolgen, welche in dem Berufungsurteil darzulegen ist (Senatsurt. v. 11. Dezember 1992, V ZR 204/91, NJW-RR 1993, 396, 397; vgl. auch BGH, Urt. v. 21. März 2000, VI ZR 158/99, NJW 2000, 1946, 1947). Daran fehlt es hier. Somit kann vom Vorliegen eines besonders groben Mißverhältnisses zwischen dem Darlehensbetrag und dem Grundstückswert im Zeitpunkt der Vereinbarung der Verfallabrede (vgl. Senatsurt. v. 26. Januar 2001, V ZR 408/99, BGH-Report 2001, 448 m.w.N.) nicht ausgegangen werden. Auch erkennt das Berufungsgericht nicht, daß die auf dem besonders groben Mißverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung beruhende tatsächliche Vermutung der verwerflichen Gesinnung des Begünstigten durch die übereinstimmenden Vorstellungen der Parteien von dem späteren Grundstückswert erschüttert wird (vgl. Senat, BGHZ 146, 298, 305). Es wäre deswegen Sache der Beklagten gewesen, im einzelnen Umstände darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, welche die Annahme einer verwerflichen Gesinnung des Klägers rechtfertigen. Daran fehlt es hier.
4. Unbegründet sind schließlich die Bedenken des Berufungsgerichts gegen das Klagebegehren unter dem Gesichtspunkt der Herabsetzung einer unangemessenen Vertragsstrafe (§ 343 Abs. 1 BGB). Zwar können Verfallklauseln dem Versprechen einer Vertragsstrafe gleichzusetzen sein, so daß die Vorschriften der §§ 339 ff BGB zumindest entsprechend anzuwenden sind (BGH, Urt. v. 8. Oktober 1992, IX ZR 98/91, NJW-RR 1993, 243, 246 m.w.N.). Aber das kommt hier nicht in Betracht; denn die Übertragung des Grundstückseigentums sollte nicht Druckmittel zur rechtzeitigen Darlehensrückzahlung sein, sondern dazu dienen, gegebenenfalls den Rückzahlungsanspruch des Klägers zu befriedigen.
5. Besteht der Eigentumsübertragungsanspruch des Klägers nach wie vor, hat die zu seinen Gunsten im Grundbuch eingetragene Auflassungsvormerkung weiter Bestand. Die Widerklage der Beklagten ist deswegen unbegründet.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO.
Tropf Krüger Klein
Lemke Schmidt-Räntsch
(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig.
(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen.
Eine vor dem Eintritt der Verkaufsberechtigung getroffene Vereinbarung, nach welcher dem Pfandgläubiger, falls er nicht oder nicht rechtzeitig befriedigt wird, das Eigentum an der Sache zufallen oder übertragen werden soll, ist nichtig.
(1) Das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen der Gesellschaft darf an die Gesellschafter nicht ausgezahlt werden. Satz 1 gilt nicht bei Leistungen, die bei Bestehen eines Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrags (§ 291 des Aktiengesetzes) erfolgen oder durch einen vollwertigen Gegenleistungs- oder Rückgewähranspruch gegen den Gesellschafter gedeckt sind. Satz 1 ist zudem nicht anzuwenden auf die Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens und Leistungen auf Forderungen aus Rechtshandlungen, die einem Gesellschafterdarlehen wirtschaftlich entsprechen.
(2) Eingezahlte Nachschüsse können, soweit sie nicht zur Deckung eines Verlustes am Stammkapital erforderlich sind, an die Gesellschafter zurückgezahlt werden. Die Zurückzahlung darf nicht vor Ablauf von drei Monaten erfolgen, nachdem der Rückzahlungsbeschluß nach § 12 bekanntgemacht ist. Im Fall des § 28 Abs. 2 ist die Zurückzahlung von Nachschüssen vor der Volleinzahlung des Stammkapitals unzulässig. Zurückgezahlte Nachschüsse gelten als nicht eingezogen.
(1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die der Schuldner in den letzten zehn Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach diesem Antrag mit dem Vorsatz, seine Gläubiger zu benachteiligen, vorgenommen hat, wenn der andere Teil zur Zeit der Handlung den Vorsatz des Schuldners kannte. Diese Kenntnis wird vermutet, wenn der andere Teil wußte, daß die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners drohte und daß die Handlung die Gläubiger benachteiligte.
(2) Hat die Rechtshandlung dem anderen Teil eine Sicherung oder Befriedigung gewährt oder ermöglicht, beträgt der Zeitraum nach Absatz 1 Satz 1 vier Jahre.
(3) Hat die Rechtshandlung dem anderen Teil eine Sicherung oder Befriedigung gewährt oder ermöglicht, welche dieser in der Art und zu der Zeit beanspruchen konnte, tritt an die Stelle der drohenden Zahlungsunfähigkeit des Schuldners nach Absatz 1 Satz 2 die eingetretene. Hatte der andere Teil mit dem Schuldner eine Zahlungsvereinbarung getroffen oder diesem in sonstiger Weise eine Zahlungserleichterung gewährt, wird vermutet, dass er zur Zeit der Handlung die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners nicht kannte.
(4) Anfechtbar ist ein vom Schuldner mit einer nahestehenden Person (§ 138) geschlossener entgeltlicher Vertrag, durch den die Insolvenzgläubiger unmittelbar benachteiligt werden. Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag früher als zwei Jahre vor dem Eröffnungsantrag geschlossen worden ist oder wenn dem anderen Teil zur Zeit des Vertragsschlusses ein Vorsatz des Schuldners, die Gläubiger zu benachteiligen, nicht bekannt war.
(1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die für die Forderung eines Gesellschafters auf Rückgewähr eines Darlehens im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 5 oder für eine gleichgestellte Forderung
- 1.
Sicherung gewährt hat, wenn die Handlung in den letzten zehn Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach diesem Antrag vorgenommen worden ist, oder - 2.
Befriedigung gewährt hat, wenn die Handlung im letzten Jahr vor dem Eröffnungsantrag oder nach diesem Antrag vorgenommen worden ist.
(2) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, mit der eine Gesellschaft einem Dritten für eine Forderung auf Rückgewähr eines Darlehens innerhalb der in Absatz 1 Nr. 2 genannten Fristen Befriedigung gewährt hat, wenn ein Gesellschafter für die Forderung eine Sicherheit bestellt hatte oder als Bürge haftete; dies gilt sinngemäß für Leistungen auf Forderungen, die einem Darlehen wirtschaftlich entsprechen.
(3) Wurde dem Schuldner von einem Gesellschafter ein Gegenstand zum Gebrauch oder zur Ausübung überlassen, so kann der Aussonderungsanspruch während der Dauer des Insolvenzverfahrens, höchstens aber für eine Zeit von einem Jahr ab der Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht geltend gemacht werden, wenn der Gegenstand für die Fortführung des Unternehmens des Schuldners von erheblicher Bedeutung ist. Für den Gebrauch oder die Ausübung des Gegenstandes gebührt dem Gesellschafter ein Ausgleich; bei der Berechnung ist der Durchschnitt der im letzten Jahr vor Verfahrenseröffnung geleisteten Vergütung in Ansatz zu bringen, bei kürzerer Dauer der Überlassung ist der Durchschnitt während dieses Zeitraums maßgebend.
(4) § 39 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.
(1) Im Rang nach den übrigen Forderungen der Insolvenzgläubiger werden in folgender Rangfolge, bei gleichem Rang nach dem Verhältnis ihrer Beträge, berichtigt:
- 1.
die seit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens laufenden Zinsen und Säumniszuschläge auf Forderungen der Insolvenzgläubiger; - 2.
die Kosten, die den einzelnen Insolvenzgläubigern durch ihre Teilnahme am Verfahren erwachsen; - 3.
Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungsgelder und Zwangsgelder sowie solche Nebenfolgen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit, die zu einer Geldzahlung verpflichten; - 4.
Forderungen auf eine unentgeltliche Leistung des Schuldners; - 5.
nach Maßgabe der Absätze 4 und 5 Forderungen auf Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens oder Forderungen aus Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechen.
(2) Forderungen, für die zwischen Gläubiger und Schuldner der Nachrang im Insolvenzverfahren vereinbart worden ist, werden im Zweifel nach den in Absatz 1 bezeichneten Forderungen berichtigt.
(3) Die Zinsen der Forderungen nachrangiger Insolvenzgläubiger und die Kosten, die diesen Gläubigern durch ihre Teilnahme am Verfahren entstehen, haben den gleichen Rang wie die Forderungen dieser Gläubiger.
(4) Absatz 1 Nr. 5 gilt für Gesellschaften, die weder eine natürliche Person noch eine Gesellschaft als persönlich haftenden Gesellschafter haben, bei der ein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist. Erwirbt ein Gläubiger bei drohender oder eingetretener Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder bei Überschuldung Anteile zum Zweck ihrer Sanierung, führt dies bis zur nachhaltigen Sanierung nicht zur Anwendung von Absatz 1 Nr. 5 auf seine Forderungen aus bestehenden oder neu gewährten Darlehen oder auf Forderungen aus Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechen.
(5) Absatz 1 Nr. 5 gilt nicht für den nicht geschäftsführenden Gesellschafter einer Gesellschaft im Sinne des Absatzes 4 Satz 1, der mit 10 Prozent oder weniger am Haftkapital beteiligt ist.
(1) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die für die Forderung eines Gesellschafters auf Rückgewähr eines Darlehens im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 5 oder für eine gleichgestellte Forderung
- 1.
Sicherung gewährt hat, wenn die Handlung in den letzten zehn Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach diesem Antrag vorgenommen worden ist, oder - 2.
Befriedigung gewährt hat, wenn die Handlung im letzten Jahr vor dem Eröffnungsantrag oder nach diesem Antrag vorgenommen worden ist.
(2) Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, mit der eine Gesellschaft einem Dritten für eine Forderung auf Rückgewähr eines Darlehens innerhalb der in Absatz 1 Nr. 2 genannten Fristen Befriedigung gewährt hat, wenn ein Gesellschafter für die Forderung eine Sicherheit bestellt hatte oder als Bürge haftete; dies gilt sinngemäß für Leistungen auf Forderungen, die einem Darlehen wirtschaftlich entsprechen.
(3) Wurde dem Schuldner von einem Gesellschafter ein Gegenstand zum Gebrauch oder zur Ausübung überlassen, so kann der Aussonderungsanspruch während der Dauer des Insolvenzverfahrens, höchstens aber für eine Zeit von einem Jahr ab der Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht geltend gemacht werden, wenn der Gegenstand für die Fortführung des Unternehmens des Schuldners von erheblicher Bedeutung ist. Für den Gebrauch oder die Ausübung des Gegenstandes gebührt dem Gesellschafter ein Ausgleich; bei der Berechnung ist der Durchschnitt der im letzten Jahr vor Verfahrenseröffnung geleisteten Vergütung in Ansatz zu bringen, bei kürzerer Dauer der Überlassung ist der Durchschnitt während dieses Zeitraums maßgebend.
(4) § 39 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.
(1) Die nach § 15a Absatz 1 Satz 1 antragspflichtigen Mitglieder des Vertretungsorgans und Abwickler einer juristischen Person dürfen nach dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung der juristischen Person keine Zahlungen mehr für diese vornehmen. Dies gilt nicht für Zahlungen, die mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar sind.
(2) Zahlungen, die im ordnungsgemäßen Geschäftsgang erfolgen, insbesondere solche Zahlungen, die der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs dienen, gelten vorbehaltlich des Absatzes 3 als mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar. Im Rahmen des für eine rechtzeitige Antragstellung maßgeblichen Zeitraums nach § 15a Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt dies nur, solange die Antragspflichtigen Maßnahmen zur nachhaltigen Beseitigung der Insolvenzreife oder zur Vorbereitung eines Insolvenzantrags mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters betreiben. Zahlungen, die im Zeitraum zwischen der Stellung des Antrags und der Eröffnung des Verfahrens geleistet werden, gelten auch dann als mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar, wenn diese mit Zustimmung eines vorläufigen Insolvenzverwalters vorgenommen wurden.
(3) Ist der nach § 15a Absatz 1 Satz 1 und 2 für eine rechtzeitige Antragstellung maßgebliche Zeitpunkt verstrichen und hat der Antragspflichtige keinen Antrag gestellt, sind Zahlungen in der Regel nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar.
(4) Werden entgegen Absatz 1 Zahlungen geleistet, sind die Antragspflichtigen der juristischen Person zur Erstattung verpflichtet. Ist der Gläubigerschaft der juristischen Person ein geringerer Schaden entstanden, beschränkt sich die Ersatzpflicht auf den Ausgleich dieses Schadens. Soweit die Erstattung oder der Ersatz zur Befriedigung der Gläubiger der juristischen Person erforderlich ist, wird die Pflicht nicht dadurch ausgeschlossen, dass dieselben in Befolgung eines Beschlusses eines Organs der juristischen Person gehandelt haben. Ein Verzicht der juristischen Person auf Erstattungs- oder Ersatzansprüche oder ein Vergleich der juristischen Person über diese Ansprüche ist unwirksam. Dies gilt nicht, wenn der Erstattungs- oder Ersatzpflichtige zahlungsunfähig ist und sich zur Abwendung des Insolvenzverfahrens mit seinen Gläubigern vergleicht, wenn die Erstattungs- oder Ersatzpflicht in einem Insolvenzplan geregelt wird oder wenn ein Insolvenzverwalter für die juristische Person handelt.
(5) Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 gelten auch für Zahlungen an Personen, die an der juristischen Person beteiligt sind, soweit diese zur Zahlungsunfähigkeit der juristischen Person führen mussten, es sei denn, dies war auch bei Beachtung der in Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Sorgfalt nicht erkennbar. Satz 1 ist auf Genossenschaften nicht anwendbar.
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten auch für die nach § 15a Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 zur Stellung des Antrags verpflichteten organschaftlichen Vertreter der zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigten Gesellschafter.
(7) Die Ansprüche aufgrund der vorstehenden Bestimmungen verjähren in fünf Jahren. Besteht zum Zeitpunkt der Pflichtverletzung eine Börsennotierung, verjähren die Ansprüche in zehn Jahren.
(8) Eine Verletzung steuerrechtlicher Zahlungspflichten liegt nicht vor, wenn zwischen dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit nach § 17 oder der Überschuldung nach § 19 und der Entscheidung des Insolvenzgerichts über den Insolvenzantrag Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt werden, sofern die Antragspflichtigen ihren Verpflichtungen nach § 15a nachkommen. Wird entgegen der Verpflichtung nach § 15a ein Insolvenzantrag verspätet gestellt, gilt dies nur für die nach Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters oder Anordnung der vorläufigen Eigenverwaltung fällig werdenden Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis. Wird das Insolvenzverfahren nicht eröffnet und ist dies auf eine Pflichtverletzung der Antragspflichtigen zurückzuführen, gelten die Sätze 1 und 2 nicht.
Eine vor dem Eintritt der Verkaufsberechtigung getroffene Vereinbarung, nach welcher dem Pfandgläubiger, falls er nicht oder nicht rechtzeitig befriedigt wird, das Eigentum an der Sache zufallen oder übertragen werden soll, ist nichtig.
(1) Die nach § 15a Absatz 1 Satz 1 antragspflichtigen Mitglieder des Vertretungsorgans und Abwickler einer juristischen Person dürfen nach dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung der juristischen Person keine Zahlungen mehr für diese vornehmen. Dies gilt nicht für Zahlungen, die mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar sind.
(2) Zahlungen, die im ordnungsgemäßen Geschäftsgang erfolgen, insbesondere solche Zahlungen, die der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs dienen, gelten vorbehaltlich des Absatzes 3 als mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar. Im Rahmen des für eine rechtzeitige Antragstellung maßgeblichen Zeitraums nach § 15a Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt dies nur, solange die Antragspflichtigen Maßnahmen zur nachhaltigen Beseitigung der Insolvenzreife oder zur Vorbereitung eines Insolvenzantrags mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters betreiben. Zahlungen, die im Zeitraum zwischen der Stellung des Antrags und der Eröffnung des Verfahrens geleistet werden, gelten auch dann als mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar, wenn diese mit Zustimmung eines vorläufigen Insolvenzverwalters vorgenommen wurden.
(3) Ist der nach § 15a Absatz 1 Satz 1 und 2 für eine rechtzeitige Antragstellung maßgebliche Zeitpunkt verstrichen und hat der Antragspflichtige keinen Antrag gestellt, sind Zahlungen in der Regel nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar.
(4) Werden entgegen Absatz 1 Zahlungen geleistet, sind die Antragspflichtigen der juristischen Person zur Erstattung verpflichtet. Ist der Gläubigerschaft der juristischen Person ein geringerer Schaden entstanden, beschränkt sich die Ersatzpflicht auf den Ausgleich dieses Schadens. Soweit die Erstattung oder der Ersatz zur Befriedigung der Gläubiger der juristischen Person erforderlich ist, wird die Pflicht nicht dadurch ausgeschlossen, dass dieselben in Befolgung eines Beschlusses eines Organs der juristischen Person gehandelt haben. Ein Verzicht der juristischen Person auf Erstattungs- oder Ersatzansprüche oder ein Vergleich der juristischen Person über diese Ansprüche ist unwirksam. Dies gilt nicht, wenn der Erstattungs- oder Ersatzpflichtige zahlungsunfähig ist und sich zur Abwendung des Insolvenzverfahrens mit seinen Gläubigern vergleicht, wenn die Erstattungs- oder Ersatzpflicht in einem Insolvenzplan geregelt wird oder wenn ein Insolvenzverwalter für die juristische Person handelt.
(5) Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 gelten auch für Zahlungen an Personen, die an der juristischen Person beteiligt sind, soweit diese zur Zahlungsunfähigkeit der juristischen Person führen mussten, es sei denn, dies war auch bei Beachtung der in Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Sorgfalt nicht erkennbar. Satz 1 ist auf Genossenschaften nicht anwendbar.
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten auch für die nach § 15a Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 zur Stellung des Antrags verpflichteten organschaftlichen Vertreter der zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigten Gesellschafter.
(7) Die Ansprüche aufgrund der vorstehenden Bestimmungen verjähren in fünf Jahren. Besteht zum Zeitpunkt der Pflichtverletzung eine Börsennotierung, verjähren die Ansprüche in zehn Jahren.
(8) Eine Verletzung steuerrechtlicher Zahlungspflichten liegt nicht vor, wenn zwischen dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit nach § 17 oder der Überschuldung nach § 19 und der Entscheidung des Insolvenzgerichts über den Insolvenzantrag Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt werden, sofern die Antragspflichtigen ihren Verpflichtungen nach § 15a nachkommen. Wird entgegen der Verpflichtung nach § 15a ein Insolvenzantrag verspätet gestellt, gilt dies nur für die nach Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters oder Anordnung der vorläufigen Eigenverwaltung fällig werdenden Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis. Wird das Insolvenzverfahren nicht eröffnet und ist dies auf eine Pflichtverletzung der Antragspflichtigen zurückzuführen, gelten die Sätze 1 und 2 nicht.
Eine vor dem Eintritt der Verkaufsberechtigung getroffene Vereinbarung, nach welcher dem Pfandgläubiger, falls er nicht oder nicht rechtzeitig befriedigt wird, das Eigentum an der Sache zufallen oder übertragen werden soll, ist nichtig.

