StaRUG unterm Brennglas: Shareholder‑Eingriffe und Rechtsschutz (VARTA/BVerfG)
Authors
Rechtsrahmen: Was darf der StaRUG‑Plan?
-
Gestaltung auch von Anteils‑/Mitgliedschaftsrechten: Bei juristischen Personen dürfen Eigenkapitalrechtegestaltet oder übertragen werden; zulässig sind u. a. Kapitalherabsetzung, Ausschluss von Bezugsrechten, Abfindungen.
-
Mehrheiten & Cram‑Down: Innerhalb jeder Gruppe 75 % Summenmehrheit (§ 25); fehlt sie, kann das Gericht bei Vorliegen der § 26‑Voraussetzungen die Zustimmung gruppensübergreifend ersetzen (Cross‑Class Cram‑Down), flankiert von absoluter Priorität (§ 27) und derenDurchbrechungstatbestand (§ 28).
Der VARTA‑Komplex als Praxisfall
-
Planbestätigung & Beschwerden: Das AG Stuttgart bestätigte den Plan am 11. 12. 2024; das LG Stuttgart wies die Beschwerden am 21. 01. 2025 ab. Die Aktionärsgruppe verfehlte die 3/4‑Mehrheit; maßgeblich waren daher Cram‑Down‑Kriterien und der Maßstab der wesentlichen Schlechterstellung (§ 66 Abs. 2 Nr. 3 StaRUG). Das LG verlangt dazu eine überwiegende Wahrscheinlichkeit (> 50 %) konkreter Schlechterstellung und realistischer Alternativszenarien – die Beschwerdeführer genügten dem nicht.
-
Verfassungsrechtlicher Schlusspunkt (vorläufig): Das BVerfG nahm die Verfassungsbeschwerde nicht an (fehlende Substantiierung i. S. v. § 93a BVerfGG); eine inhaltliche Klärung zu Reichweite/Eingriffstiefe blieb damit aus. Signalwirkung: Der einfachrechtliche Rechtsschutz im StaRUG (v. a. § 64/§ 66) isternst zu nehmen; der Weg nach Karlsruhe ist kein Ersatz für versäumten Tatsachenvortrag im Fachverfahren.
Einordnung
Der Fall zeigt die praktische Schlagkraft des StaRUG auch gegenüber Aktionärsinteressen – dogmatisch abgesichert durch die Planbefugnisse gegenüber Eigenkapital und das Cram‑Down‑Regime. Zugleich wird deutlich: Minderheitenschutz ist kein Papiertiger; wer eine wesentliche Schlechterstellung rügen will, muss vergleichsrechnungen liefern und Alternativen plausibilisieren.
Praxis‑To‑dos
-
Für Schuldner/Boards:
-
Planarchitektur früh „gerichtsfest“ aufbauen: Werteallokation transparent, Vergleichsrechnung belastbar, Minderheitenschutztopf (vgl. § 64 Abs. 3 StaRUG) sinnvoll dimensionieren; Aktienrecht(Kapitalmaßnahmen/Bezugsrechte) konsistent mit Planrecht.
-
-
Für (Minderheits‑)Aktionäre:
-
Timing & Schwelle im Blick: Widerspruch und Gegenstimme im Abstimmungsverfahren sind Zulässigkeitsvoraussetzungen (§ 66 Abs. 2 Nr. 1–2); danach Glaubhaftmachung der wesentlichen Schlechterstellung (> 50 %). Nur Kritik an der unternehmerischen Planpräferenz genügt nicht.
-
-
Für Gläubiger:
-
Klassenbildung und Prioritäten prüfen; bei drohendem Cram‑Down No‑Worse‑Off‑Test (nicht schlechter als ohne Plan) und absolute Priorität systematisch angreifen.
-
moreResultsText
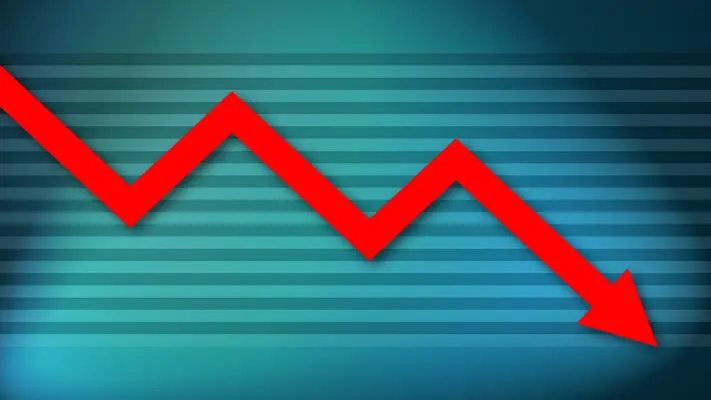
Annotations
(1) Gegen den Beschluss, durch den der Restrukturierungsplan bestätigt wird, steht jedem Planbetroffenen die sofortige Beschwerde zu. Dem Schuldner steht die sofortige Beschwerde zu, wenn die Bestätigung des Restrukturierungsplans abgelehnt worden ist.
(2) Die sofortige Beschwerde gegen die Bestätigung des Restrukturierungsplans ist nur zulässig, wenn der Beschwerdeführer
- 1.
dem Plan im Abstimmungsverfahren widersprochen hat (§ 64 Absatz 2), - 2.
gegen den Plan gestimmt hat und - 3.
glaubhaft macht, dass er durch den Plan wesentlich schlechter gestellt wird als er ohne den Plan stünde und dass dieser Nachteil nicht durch eine Zahlung aus den in § 64 Absatz 3 genannten Mitteln ausgeglichen werden kann.
(3) Absatz 2 Nummer 1 und 2 gilt nur, wenn im Einberufungsschreiben oder in der Ladung zum Termin auf die Notwendigkeit des Widerspruchs und der Ablehnung des Plans besonders hingewiesen wurde. Hat weder eine Versammlung der Planbetroffenen (§ 20) noch ein Erörterungs- und Abstimmungstermin (§ 45) stattgefunden, so gilt Absatz 2 Nummer 1 und 2 nur, wenn im Planangebot auf die Notwendigkeit des Widerspruchs und der Ablehnung des Plans besonders hingewiesen wurde.
(4) Auf Antrag des Beschwerdeführers ordnet das Gericht die aufschiebende Wirkung der Beschwerde an, wenn der Vollzug des Restrukturierungsplans mit schwerwiegenden, insbesondere nicht rückgängig zu machenden Nachteilen für den Beschwerdeführer einhergeht, die außer Verhältnis zu den Vorteilen des sofortigen Planvollzugs stehen.
(5) Das Beschwerdegericht weist die Beschwerde gegen die Bestätigung des Restrukturierungsplans auf Antrag des Schuldners unverzüglich zurück, wenn die alsbaldige Rechtskraft der Planbestätigung vorrangig erscheint, weil die Nachteile eines verzögerten Planvollzugs die Nachteile für den Beschwerdeführer überwiegen; ein Abhilfeverfahren findet nicht statt. Dies gilt nicht, wenn ein besonders schwerer Rechtsverstoß vorliegt. Weist das Beschwerdegericht die Beschwerde nach Satz 1 zurück, ist der Schuldner dem Beschwerdeführer zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der ihm durch den Planvollzug entsteht; die Rückgängigmachung der Wirkungen des Restrukturierungsplans kann nicht als Schadensersatz verlangt werden. Für Klagen, mit denen Schadensersatzansprüche nach Satz 3 geltend gemacht werden, ist das Landgericht ausschließlich zuständig, das die Beschwerde zurückgewiesen hat.
(1) Die Verfassungsbeschwerde bedarf der Annahme zur Entscheidung.
(2) Sie ist zur Entscheidung anzunehmen,
- a)
soweit ihr grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung zukommt, - b)
wenn es zur Durchsetzung der in § 90 Abs. 1 genannten Rechte angezeigt ist; dies kann auch der Fall sein, wenn dem Beschwerdeführer durch die Versagung der Entscheidung zur Sache ein besonders schwerer Nachteil entsteht.
(1) Auf Antrag eines Planbetroffenen, der gegen den Restrukturierungsplan gestimmt hat, ist die Bestätigung des Plans zu versagen, wenn der Antragsteller durch den Restrukturierungsplan voraussichtlich schlechter gestellt wird als er ohne den Plan stünde. Hat der Schuldner gegen den Inhaber einer Absonderungsanwartschaft eine Vollstreckungs- oder Verwertungssperre erwirkt, die diesen an der Verwertung der Anwartschaft hinderte, bleiben Minderungen im Wert der Anwartschaft, die sich während der Dauer der Anordnung ergeben, für die Bestimmung der Stellung des Berechtigten ohne Plan außer Betracht, es sei denn, die Wertminderung hätte sich auch ohne die Anordnung ergeben.
(2) Der Antrag nach Absatz 1 ist nur zulässig, wenn der Antragsteller bereits im Abstimmungsverfahren dem Plan widersprochen und geltend gemacht hat, dass er durch den Plan voraussichtlich schlechter gestellt wird als er ohne Plan stünde. Ist die Planabstimmung in einem gerichtlichen Erörterungs- und Abstimmungstermin erfolgt, muss der Antragsteller spätestens in diesem Termin glaubhaft machen, durch den Plan voraussichtlich schlechter gestellt zu werden.
(3) Der Antrag nach Absatz 1 ist abzuweisen, wenn im gestaltenden Teil des Restrukturierungsplans Mittel für den Fall bereitgestellt werden, dass ein Planbetroffener eine Schlechterstellung nachweist. Ob der Antragsteller einen Ausgleich aus diesen Mitteln erhält, ist außerhalb der Restrukturierungssache zu klären.
(4) Hat weder eine Versammlung der Planbetroffenen (§ 20) noch ein Erörterungs- und Abstimmungstermin (§ 45) stattgefunden, gilt Absatz 2 Satz 1 nur, wenn im Planangebot besonders auf das Erfordernis der Geltendmachung der voraussichtlichen Schlechterstellung durch den Plan im Abstimmungsverfahren hingewiesen wurde. Hat eine Versammlung der Planbetroffenen stattgefunden, gilt Absatz 2 Satz 1 nur, wenn in dem Einberufungsschreiben besonders auf das Erfordernis der Geltendmachung der voraussichtlichen Schlechterstellung durch den Plan im Abstimmungsverfahren hingewiesen wurde. Absatz 2 Satz 2 gilt nur, wenn in der Ladung besonders auf das Erfordernis der Glaubhaftmachung der voraussichtlichen Schlechterstellung durch den Plan spätestens im Erörterungs- und Abstimmungstermin hingewiesen wurde.

